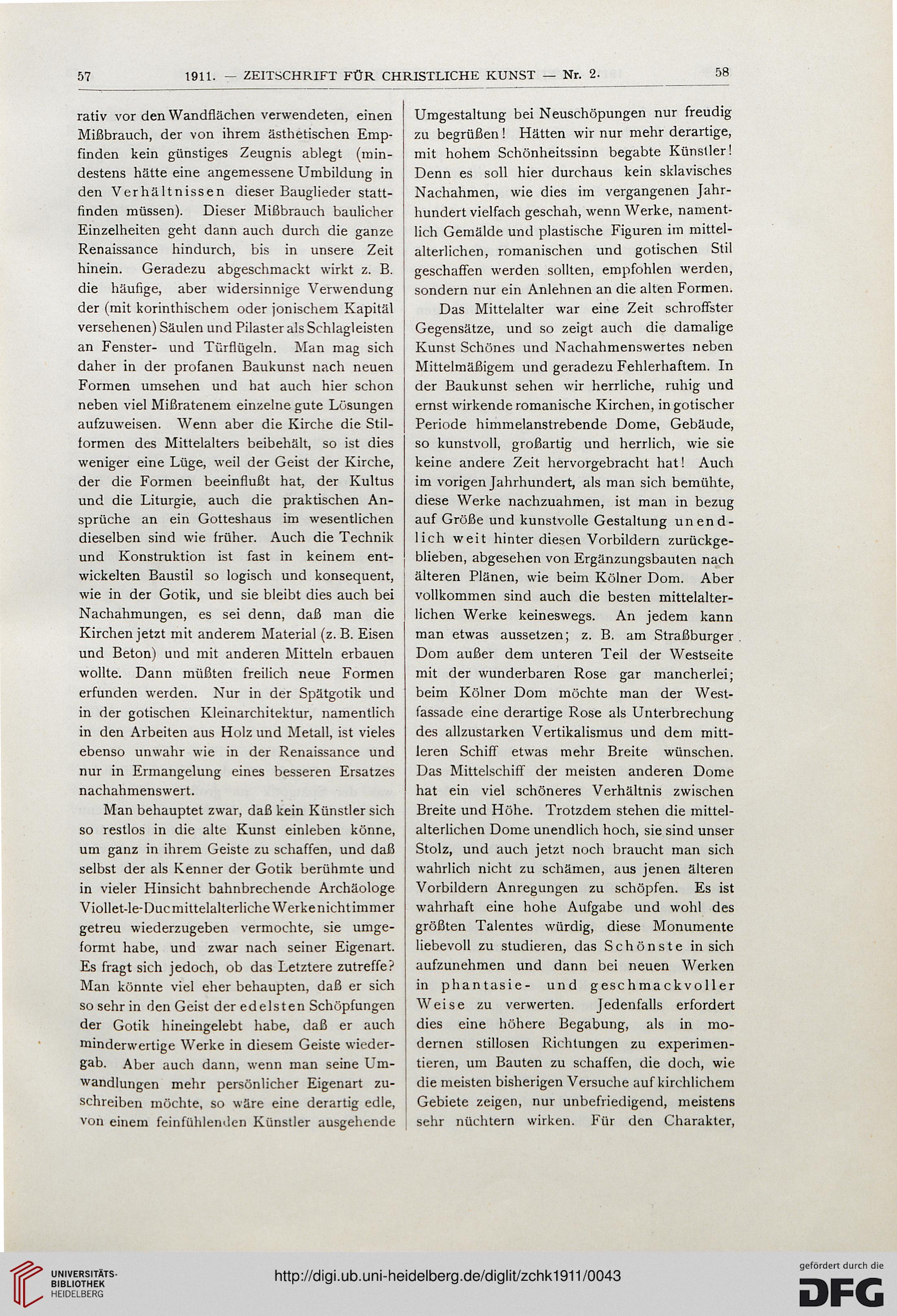57
1911. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 2.
58
rativ vor den Wandflächen verwendeten, einen
Mißbrauch, der von ihrem ästhetischen Emp-
finden kein günstiges Zeugnis ablegt (min-
destens hätte eine angemessene Umbildung in
den Verhältnissen dieser Bauglieder statt-
finden müssen). Dieser Mißbrauch baulicher
Einzelheiten geht dann auch durch die ganze
Renaissance hindurch, bis in unsere Zeit
hinein. Geradezu abgeschmackt wirkt z. B.
die häufige, aber widersinnige Verwendung
der (mit korinthischem oder jonischem Kapital
versehenen) Säulen und Pilaster als Schlagleisten
an Fenster- und Türflügeln. Man mag sich
daher in der profanen Baukunst nach neuen
Formen umsehen und hat auch hier schon
neben viel Mißratenem einzelne gute Lösungen
aufzuweisen. Wenn aber die Kirche die Stil-
formen des Mittelalters beibehält, so ist dies
weniger eine Lüge, weil der Geist der Kirche,
der die Formen beeinflußt hat, der Kultus
und die Liturgie, auch die praktischen An-
sprüche an ein Gotteshaus im wesentlichen
dieselben sind wie früher. Auch die Technik
und Konstruktion ist fast in keinem ent-
wickelten Baustil so logisch und konsequent,
wie in der Gotik, und sie bleibt dies auch bei
Nachahmungen, es sei denn, daß man die
Kirchen jetzt mit anderem Material (z. B. Eisen
und Beton) und mit anderen Mitteln erbauen
wollte. Dann müßten freilich neue Formen
erfunden werden. Nur in der Spätgotik und
in der gotischen Kleinarchitektur, namentlich
in den Arbeiten aus Holz und Metall, ist vieles
ebenso unwahr wie in der Renaissance und
nur in Ermangelung eines besseren Ersatzes
nachahmenswert.
Man behauptet zwar, daß kein Künstler sich
so restlos in die alte Kunst einleben könne,
um ganz in ihrem Geiste zu schaffen, und daß
selbst der als Kenner der Gotik berühmte und
in vieler Hinsicht bahnbrechende Archäologe
Viollet-le-Duc mittelalterliche Werke nicht immer
getreu wiederzugeben vermochte, sie umge-
formt habe, und zwar nach seiner Eigenart.
Es fragt sich jedoch, ob das Letztere zutreffe?
Man könnte viel eher behaupten, daß er sich
so sehr in den Geist der edelsten Schöpfungen
der Gotik hineingelebt habe, daß er auch
minderwertige Werke in diesem Geiste wieder-
gab. Aber auch dann, wenn man seine Um-
wandlungen mehr persönlicher Eigenart zu-
schreiben möchte, so wäre eine derartig edle,
von einem feinfühlenden Künstler ausgehende
Umgestaltung bei Neuschöpungen nur freudig
zu begrüßen! Hätten wir nur mehr derartige,
mit hohem Schönheitssinn begabte Künstler!
Denn es soll hier durchaus kein sklavisches
Nachahmen, wie dies im vergangenen Jahr-
hundert vielfach geschah, wenn Werke, nament-
lich Gemälde und plastische Figuren im mittel-
alterlichen, romanischen und gotischen Stil
geschaffen werden sollten, empfohlen werden,
sondern nur ein Anlehnen an die alten Formen.
Das Mittelalter war eine Zeit schroffster
Gegensätze, und so zeigt auch die damalige
Kunst Schönes und Nachahmenswertes neben
Mittelmäßigem und geradezu Fehlerhaftem. In
der Baukunst sehen wir herrliche, ruhig und
ernst wirkende romanische Kirchen, in gotischer
Periode himmelanstrebende Dome, Gebäude,
so kunstvoll, großartig und herrlich, wie sie
keine andere Zeit hervorgebracht hat! Auch
im vorigen Jahrhundert, als man sich bemühte,
diese Werke nachzuahmen, ist man in bezug
auf Größe und kunstvolle Gestallung unend-
lich weit hinter diesen Vorbildern zurückge-
blieben, abgesehen von Ergänzungsbauten nach
älteren Plänen, wie beim Kölner Dom. Aber
vollkommen sind auch die besten mittelalter-
lichen Werke keineswegs. An jedem kann
man etwas aussetzen; z. B. am Straßburger
Dom außer dem unteren Teil der Westseite
mit der wunderbaren Rose gar mancherlei;
beim Kölner Dom möchte man der West-
fassade eine derartige Rose als Unterbrechung
des allzustarken Vertikalismus und dem mitt-
leren Schiff etwas mehr Breite wünschen.
Das Mittelschiff der meisten anderen Dome
hat ein viel schöneres Verhältnis zwischen
Breite und Höhe. Trotzdem stehen die mittel-
alterlichen Dome unendlich hoch, sie sind unser
Stolz, und auch jetzt noch braucht man sich
wahrlich nicht zu schämen, aus jenen älteren
Vorbildern Anregungen zu schöpfen. Es ist
wahrhaft eine hohe Aufgabe und wohl des
größten Talentes würdig, diese Monumente
liebevoll zu studieren, das Schönste in sich
aufzunehmen und dann bei neuen Werken
in phantasie- und geschmackvoller
Weise zu verwerten. Jedenfalls erfordert
dies eine höhere Begabung, als in mo-
dernen stillosen Richtungen zu experimen-
tieren, um Bauten zu schaffen, die doch, wie
die meisten bisherigen Versuche auf kirchlichem
Gebiete zeigen, nur unbefriedigend, meistens
sehr nüchtern wirken. Für den Charakter,
1911. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 2.
58
rativ vor den Wandflächen verwendeten, einen
Mißbrauch, der von ihrem ästhetischen Emp-
finden kein günstiges Zeugnis ablegt (min-
destens hätte eine angemessene Umbildung in
den Verhältnissen dieser Bauglieder statt-
finden müssen). Dieser Mißbrauch baulicher
Einzelheiten geht dann auch durch die ganze
Renaissance hindurch, bis in unsere Zeit
hinein. Geradezu abgeschmackt wirkt z. B.
die häufige, aber widersinnige Verwendung
der (mit korinthischem oder jonischem Kapital
versehenen) Säulen und Pilaster als Schlagleisten
an Fenster- und Türflügeln. Man mag sich
daher in der profanen Baukunst nach neuen
Formen umsehen und hat auch hier schon
neben viel Mißratenem einzelne gute Lösungen
aufzuweisen. Wenn aber die Kirche die Stil-
formen des Mittelalters beibehält, so ist dies
weniger eine Lüge, weil der Geist der Kirche,
der die Formen beeinflußt hat, der Kultus
und die Liturgie, auch die praktischen An-
sprüche an ein Gotteshaus im wesentlichen
dieselben sind wie früher. Auch die Technik
und Konstruktion ist fast in keinem ent-
wickelten Baustil so logisch und konsequent,
wie in der Gotik, und sie bleibt dies auch bei
Nachahmungen, es sei denn, daß man die
Kirchen jetzt mit anderem Material (z. B. Eisen
und Beton) und mit anderen Mitteln erbauen
wollte. Dann müßten freilich neue Formen
erfunden werden. Nur in der Spätgotik und
in der gotischen Kleinarchitektur, namentlich
in den Arbeiten aus Holz und Metall, ist vieles
ebenso unwahr wie in der Renaissance und
nur in Ermangelung eines besseren Ersatzes
nachahmenswert.
Man behauptet zwar, daß kein Künstler sich
so restlos in die alte Kunst einleben könne,
um ganz in ihrem Geiste zu schaffen, und daß
selbst der als Kenner der Gotik berühmte und
in vieler Hinsicht bahnbrechende Archäologe
Viollet-le-Duc mittelalterliche Werke nicht immer
getreu wiederzugeben vermochte, sie umge-
formt habe, und zwar nach seiner Eigenart.
Es fragt sich jedoch, ob das Letztere zutreffe?
Man könnte viel eher behaupten, daß er sich
so sehr in den Geist der edelsten Schöpfungen
der Gotik hineingelebt habe, daß er auch
minderwertige Werke in diesem Geiste wieder-
gab. Aber auch dann, wenn man seine Um-
wandlungen mehr persönlicher Eigenart zu-
schreiben möchte, so wäre eine derartig edle,
von einem feinfühlenden Künstler ausgehende
Umgestaltung bei Neuschöpungen nur freudig
zu begrüßen! Hätten wir nur mehr derartige,
mit hohem Schönheitssinn begabte Künstler!
Denn es soll hier durchaus kein sklavisches
Nachahmen, wie dies im vergangenen Jahr-
hundert vielfach geschah, wenn Werke, nament-
lich Gemälde und plastische Figuren im mittel-
alterlichen, romanischen und gotischen Stil
geschaffen werden sollten, empfohlen werden,
sondern nur ein Anlehnen an die alten Formen.
Das Mittelalter war eine Zeit schroffster
Gegensätze, und so zeigt auch die damalige
Kunst Schönes und Nachahmenswertes neben
Mittelmäßigem und geradezu Fehlerhaftem. In
der Baukunst sehen wir herrliche, ruhig und
ernst wirkende romanische Kirchen, in gotischer
Periode himmelanstrebende Dome, Gebäude,
so kunstvoll, großartig und herrlich, wie sie
keine andere Zeit hervorgebracht hat! Auch
im vorigen Jahrhundert, als man sich bemühte,
diese Werke nachzuahmen, ist man in bezug
auf Größe und kunstvolle Gestallung unend-
lich weit hinter diesen Vorbildern zurückge-
blieben, abgesehen von Ergänzungsbauten nach
älteren Plänen, wie beim Kölner Dom. Aber
vollkommen sind auch die besten mittelalter-
lichen Werke keineswegs. An jedem kann
man etwas aussetzen; z. B. am Straßburger
Dom außer dem unteren Teil der Westseite
mit der wunderbaren Rose gar mancherlei;
beim Kölner Dom möchte man der West-
fassade eine derartige Rose als Unterbrechung
des allzustarken Vertikalismus und dem mitt-
leren Schiff etwas mehr Breite wünschen.
Das Mittelschiff der meisten anderen Dome
hat ein viel schöneres Verhältnis zwischen
Breite und Höhe. Trotzdem stehen die mittel-
alterlichen Dome unendlich hoch, sie sind unser
Stolz, und auch jetzt noch braucht man sich
wahrlich nicht zu schämen, aus jenen älteren
Vorbildern Anregungen zu schöpfen. Es ist
wahrhaft eine hohe Aufgabe und wohl des
größten Talentes würdig, diese Monumente
liebevoll zu studieren, das Schönste in sich
aufzunehmen und dann bei neuen Werken
in phantasie- und geschmackvoller
Weise zu verwerten. Jedenfalls erfordert
dies eine höhere Begabung, als in mo-
dernen stillosen Richtungen zu experimen-
tieren, um Bauten zu schaffen, die doch, wie
die meisten bisherigen Versuche auf kirchlichem
Gebiete zeigen, nur unbefriedigend, meistens
sehr nüchtern wirken. Für den Charakter,