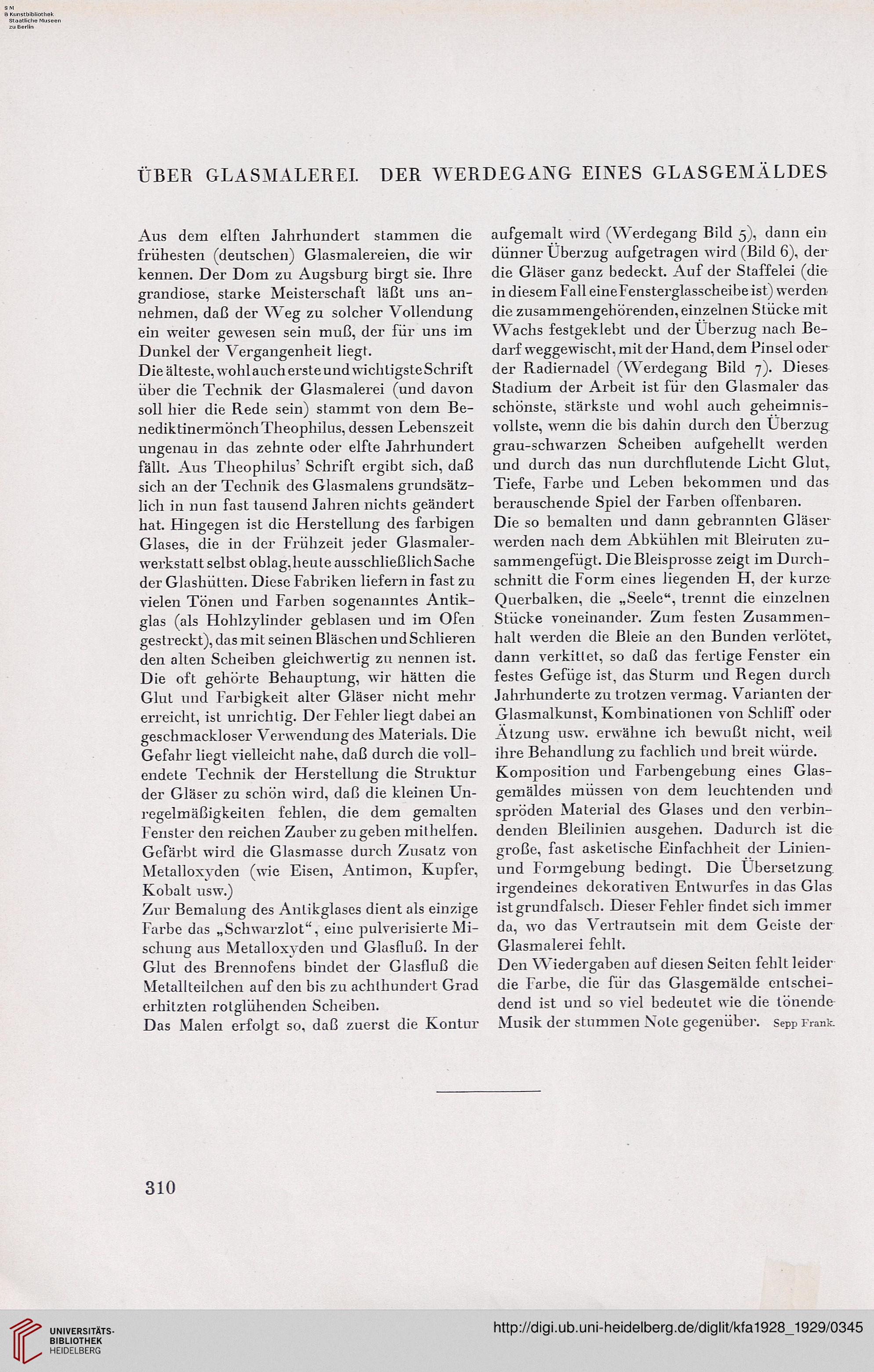UBER GLASMALEREI. DER WERDEGANG EINES GLAS GEMÄLDES
Aus dem elften Jahrhundert stammen die
frühesten (deutschen) Glasmalereien, die wir
kennen. Der Dom zu Augsburg birgt sie. Ihre
grandiose, starke Meisterschaft läßt uns an-
nehmen, daß der Weg zu solcher Vollendung
ein weiter gewesen sein muß, der für uns im
Dunkel der Vergangenheit liegt.
Die älteste, wohl auch erste und wichligsteSchrift
über die Technik der Glasmalerei (und davon
soll hier die Rede sein) stammt von dem Be-
nediktinermönch Theophilus, dessen Lebenszeit
ungenau in das zehnte oder elfte Jahrhundert
fällt. Aus Theophilus" Schrift ergibt sich, daß
sich an der Technik des Glasmalens grundsätz-
lich in nun fast tausend Jahren nichts geändert
hat. Hingegen ist die Herstellung des farbigen
Glases, die in der Frühzeit jeder Glasmaler-
werkstatt selbst oblag, heute ausschließlich Sache
der Glashütten. Diese Fabriken liefern in fast zu
vielen Tönen und Farben sogenanntes Antik-
glas (als Hohlzylinder geblasen und im Ofen
gestreckt), das mit seinen Bläschen und Schlieren
den alten Scheiben gleichwertig zu nennen ist.
Die oft gehörte Behauptung, wir hätten die
Glut und Farbigkeit alter Gläser nicht mehr
erreicht, ist unrichtig. Der Fehler liegt dabei an
geschmackloser Verwendung des Materials. Die
Gefahr liegt vielleicht nahe, daß durch die voll-
endete Technik der Herstellung die Struktur
der Gläser zu schön wird, daß die kleinen Un-
regelmäßigkeiten fehlen, die dem gemalten
Fenster den reichen Zauber zugeben mithelfen.
Gefärbt wird die Glasmasse durch Zusatz von
Metalloxyden (wie Eisen, Antimon, Kupfer,
Kobalt usw.)
Zur Bemalung des Antikglases dient als einzige
Farbe das „Schwarzlot", eine pulverisierte Mi-
schung aus Metalloxyden und Glasfluß. In der
Glut des Brennofens bindet der Glasfluß die
Metall teilchen auf den bis zu achthundert Grad
erhitzten rotglühenden Scheiben.
Das Malen erfolgt so, daß zuerst die Kontur
aufgemalt wird (Werdegang Bild 5), dann ein
dünner Uberzug aufgetragen wird (Bild 6), der
die Gläser ganz bedeckt. Auf der Staffelei (die
in diesem Fall eine Fensterglasscheibe ist) werden
die zusammengehörenden, einzelnen Stücke mit
Wachs festgeklebt und der Uberzug nach Be-
darf weggewischt, mit der Hand, dem Pinsel oder
der Radiernadel (Werdegang Bild 7). Dieses
Stadium der Arbeit ist für den Glasmaler das
schönste, stärkste und wohl auch geheimnis-
vollste, wenn die bis dahin durch den L berzug
grau-schwarzen Scheiben aufgehellt werden
und durch das nun durchflutende Licht Glut,
Tiefe, Farbe und Leben bekommen und das
berauschende Spiel der Farben offenbaren.
Die so bemalten und dann gebrannten Gläser
werden nach dem Abkühlen mit Bleiruten zu-
sammengefügt. Die Bleisprosse zeigt im Durch-
schnitt die Form eines liegenden H, der kurze
Querbalken, die „Seele", trennt die einzelnen
Stücke voneinander. Zum festen Zusammen-
halt werden die Bleie an den Bunden verlötet,
dann verkittet, so daß das fertige Fenster ein
festes Gefüge ist, das Sturm und Begen durch
Jahrhunderte zu trotzen vermag. Varianten der
Glasmalkunst, Kombinationen von Schliff oder
Atzung usw. erwähne ich bewußt nicht, weil
ihre Behandlung zu fachlich und breit würde.
Komposition und Farbengebung eines Glas-
gemäldes müssen von dem leuchtenden und
spröden Material des Glases und den verbin-
denden Bleilinien ausgehen. Dadurch ist die
große, fast asketische Einfachheit der Linien-
und Formgebung bedingt. Die Übersetzung
irgendeines dekorativen Entwurfes in das Glas
ist grundfalsch. Dieser Fehler findet sich immer
da, wo das Vertrautsein mit dem Geiste der
Glasmalerei fehlt.
Den Wiedergaben auf diesen Seiten fehlt leider
die Farbe, die für das Glasgemälde entschei-
dend ist und so viel bedeutet wie die tönende
Musik der stummen Note gegenüber. Sepp Frank.
310
Aus dem elften Jahrhundert stammen die
frühesten (deutschen) Glasmalereien, die wir
kennen. Der Dom zu Augsburg birgt sie. Ihre
grandiose, starke Meisterschaft läßt uns an-
nehmen, daß der Weg zu solcher Vollendung
ein weiter gewesen sein muß, der für uns im
Dunkel der Vergangenheit liegt.
Die älteste, wohl auch erste und wichligsteSchrift
über die Technik der Glasmalerei (und davon
soll hier die Rede sein) stammt von dem Be-
nediktinermönch Theophilus, dessen Lebenszeit
ungenau in das zehnte oder elfte Jahrhundert
fällt. Aus Theophilus" Schrift ergibt sich, daß
sich an der Technik des Glasmalens grundsätz-
lich in nun fast tausend Jahren nichts geändert
hat. Hingegen ist die Herstellung des farbigen
Glases, die in der Frühzeit jeder Glasmaler-
werkstatt selbst oblag, heute ausschließlich Sache
der Glashütten. Diese Fabriken liefern in fast zu
vielen Tönen und Farben sogenanntes Antik-
glas (als Hohlzylinder geblasen und im Ofen
gestreckt), das mit seinen Bläschen und Schlieren
den alten Scheiben gleichwertig zu nennen ist.
Die oft gehörte Behauptung, wir hätten die
Glut und Farbigkeit alter Gläser nicht mehr
erreicht, ist unrichtig. Der Fehler liegt dabei an
geschmackloser Verwendung des Materials. Die
Gefahr liegt vielleicht nahe, daß durch die voll-
endete Technik der Herstellung die Struktur
der Gläser zu schön wird, daß die kleinen Un-
regelmäßigkeiten fehlen, die dem gemalten
Fenster den reichen Zauber zugeben mithelfen.
Gefärbt wird die Glasmasse durch Zusatz von
Metalloxyden (wie Eisen, Antimon, Kupfer,
Kobalt usw.)
Zur Bemalung des Antikglases dient als einzige
Farbe das „Schwarzlot", eine pulverisierte Mi-
schung aus Metalloxyden und Glasfluß. In der
Glut des Brennofens bindet der Glasfluß die
Metall teilchen auf den bis zu achthundert Grad
erhitzten rotglühenden Scheiben.
Das Malen erfolgt so, daß zuerst die Kontur
aufgemalt wird (Werdegang Bild 5), dann ein
dünner Uberzug aufgetragen wird (Bild 6), der
die Gläser ganz bedeckt. Auf der Staffelei (die
in diesem Fall eine Fensterglasscheibe ist) werden
die zusammengehörenden, einzelnen Stücke mit
Wachs festgeklebt und der Uberzug nach Be-
darf weggewischt, mit der Hand, dem Pinsel oder
der Radiernadel (Werdegang Bild 7). Dieses
Stadium der Arbeit ist für den Glasmaler das
schönste, stärkste und wohl auch geheimnis-
vollste, wenn die bis dahin durch den L berzug
grau-schwarzen Scheiben aufgehellt werden
und durch das nun durchflutende Licht Glut,
Tiefe, Farbe und Leben bekommen und das
berauschende Spiel der Farben offenbaren.
Die so bemalten und dann gebrannten Gläser
werden nach dem Abkühlen mit Bleiruten zu-
sammengefügt. Die Bleisprosse zeigt im Durch-
schnitt die Form eines liegenden H, der kurze
Querbalken, die „Seele", trennt die einzelnen
Stücke voneinander. Zum festen Zusammen-
halt werden die Bleie an den Bunden verlötet,
dann verkittet, so daß das fertige Fenster ein
festes Gefüge ist, das Sturm und Begen durch
Jahrhunderte zu trotzen vermag. Varianten der
Glasmalkunst, Kombinationen von Schliff oder
Atzung usw. erwähne ich bewußt nicht, weil
ihre Behandlung zu fachlich und breit würde.
Komposition und Farbengebung eines Glas-
gemäldes müssen von dem leuchtenden und
spröden Material des Glases und den verbin-
denden Bleilinien ausgehen. Dadurch ist die
große, fast asketische Einfachheit der Linien-
und Formgebung bedingt. Die Übersetzung
irgendeines dekorativen Entwurfes in das Glas
ist grundfalsch. Dieser Fehler findet sich immer
da, wo das Vertrautsein mit dem Geiste der
Glasmalerei fehlt.
Den Wiedergaben auf diesen Seiten fehlt leider
die Farbe, die für das Glasgemälde entschei-
dend ist und so viel bedeutet wie die tönende
Musik der stummen Note gegenüber. Sepp Frank.
310