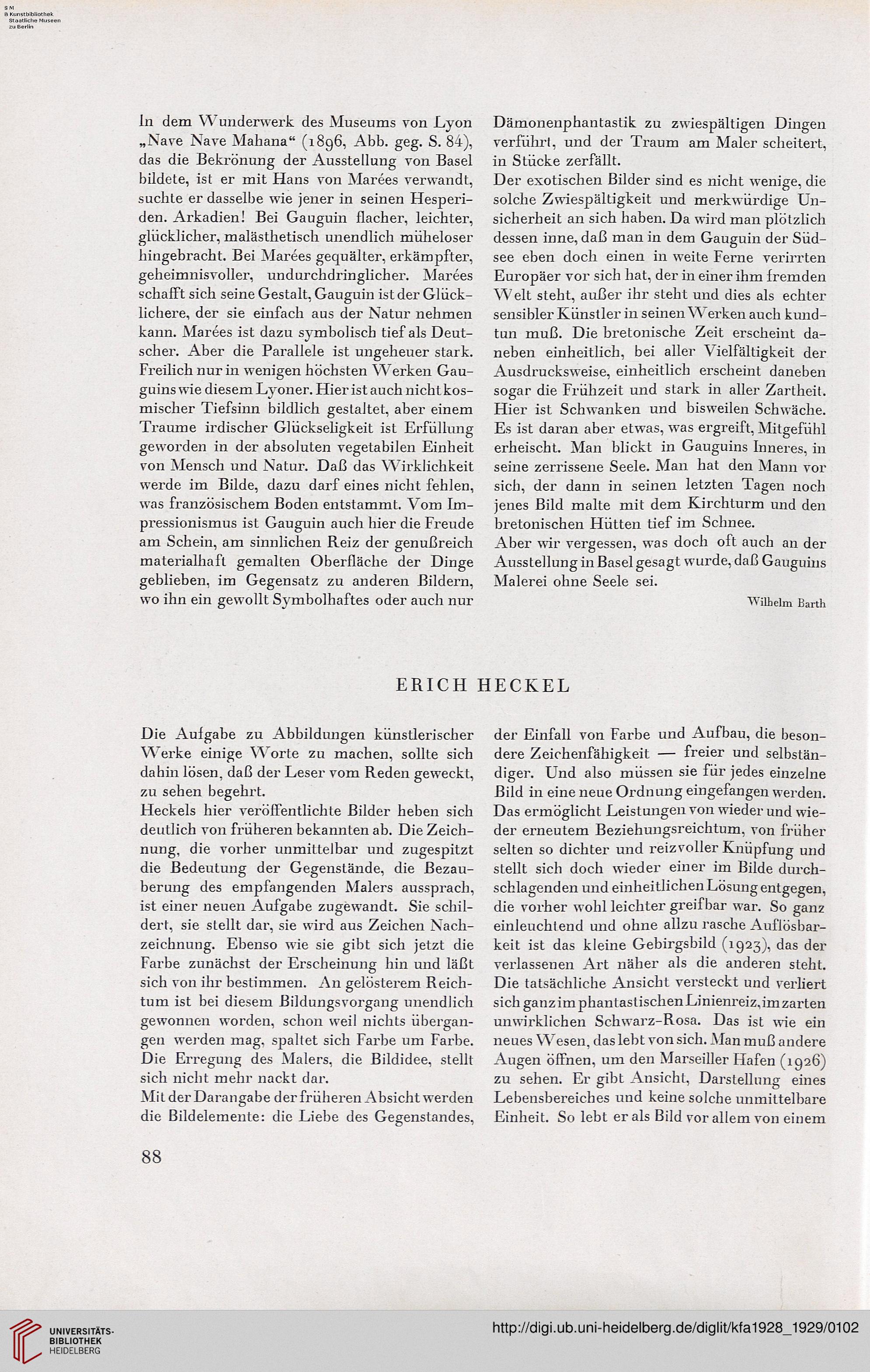In dem Wunderwerk des Museums von Lyon
„Nave Nave Mahana" (1896, Abb. geg. S. 84),
das die Bekrönung der Ausstellung von Basel
bildete, ist er mit Hans von Marees verwandt,
suchte er dasselbe wie jener in seinen Hesperi-
den. Arkadien! Bei Gauguin flacher, leichter,
glücklicher, malästhetisch unendlich müheloser
hingebracht. Bei Marees gequälter, erkämpfter,
geheimnisvoller, undurchdringlicher. Marees
schafft sich seine Gestalt, Gauguin ist der Glück-
lichere, der sie einfach aus der Natur nehmen
kann. Marees ist dazu symbolisch tief als Deut-
scher. Aber die Parallele ist ungeheuer stark.
Freilich nur in wenigen höchsten Werken Gau-
guins wie diesem Lyoner. Hier ist auch nich t kos-
mischer Tiefsinn bildlich gestaltet, aber einem
Traume irdischer Glückseligkeit ist Erfüllung
geworden in der absoluten vegetabilen Einheit
von Mensch und Natur. Daß das Wirklichkeit
werde im Bilde, dazu darf eines nicht fehlen,
was französischem Boden entstammt. Vom Im-
pressionismus ist Gauguin auch hier die Freude
am Schein, am sinnlichen Reiz der genußreich
materialhafl gemalten Oberfläche der Dinge
geblieben, im Gegensatz zu anderen Bildern,
wo ihn ein gewollt Symbolhaftes oder auch nur
Dämonenphantastik zu zwiespältigen Dingen
verführt, und der Traum am Maler scheitert,
in Stücke zerfällt.
Der exotischen Bilder sind es nicht wenige, die
solche Zwiespältigkeit und merkwürdige Un-
sicherheit an sich haben. Da wird man plötzlich
dessen inne, daß man in dem Gauguin der Süd-
see eben doch einen in weite Ferne verirrten
Europäer vor sich hat, der in einer ihm fremden
Welt steht, außer ihr steht und dies als echter
sensibler Künstler in seinen W erken auch kund-
tun muß. Die bretonische Zeit erscheint da-
neben einheitlich, bei aller Vielfältigkeit der
Ausdrucksweise, einheitlich erscheint daneben
sogar die Frühzeit und stark in aller Zartheit.
Hier ist Schwanken und bisweilen Schwäche.
Es ist daran aber etwas, was ergreift, Mitgefühl
erheischt. Man blickt in Gauguins Inneres, in
seine zerrissene Seele. Man hat den Mann vor
sich, der dann in seinen letzten Tagen noch
jenes Bild malte mit dem Kirchturm und den
bretonischen Hütten tief im Schnee.
Aber wir vergessen, was doch oft auch an der
Ausstellung in Basel gesagt wurde, daß Gauguins
Malerei ohne Seele sei.
■Wilhelm Barth
ERICH HECKEL
Die Aufgabe zu Abbildungen künstlerischer
V\ erke einige Worte zu machen, sollte sich
dahin lösen, daß der Leser vom Reden geweckt,
zu sehen begehrt.
Heckeis hier veröffentlichte Bilder heben sich
deutlich von früheren bekannten ab. Die Zeich-
nung, die vorher unmittelbar und zugespitzt
die Bedeutung der Gegenstände, die Bezau-
berung des empfangenden Malers aussprach,
ist einer neuen Aufgabe zugewandt. Sie schil-
dert, sie stellt dar, sie wird aus Zeichen Nach-
zeichnung. Ebenso wie sie gibt sich jetzt die
Farbe zunächst der Erscheinung hin und läßt
sich von ihr bestimmen. An gelösterem Beich-
tum ist bei diesem ßildungsvorgang unendlich
gewonnen worden, schon weil nichts übergan-
gen werden mag, spaltet sich Farbe um Farbe.
Die Erregung des Malers, die Bildidee, stellt
sich nicht mehr nackt dar.
Mit der Darangabe der früheren Absicht werden
die Bildelemente: die Liebe des Gegenstandes,
der Einfall von Farbe und Aufbau, die beson-
dere Zeichenfähigkeit — freier und selbstän-
diger. Und also müssen sie für jedes einzelne
Bild in eine neue Ordnung eingefangen werden.
Das ermöglicht Leistungen von wieder und wie-
der erneutem Beziehungsreichtum, von früher
selten so dichter und reizvoller Knüpfung und
stellt sich doch wieder einer im Bilde durch-
schlagenden und einheitlichen Lösung entgegen,
die vorher wohl leichter greifbar war. So ganz
einleuchtend und ohne allzu rasche Auflösbar-
keit ist das kleine Gebirgsbild (1923), das der
verlassenen Art näher als die anderen steht.
Die tatsächliche Ansicht versteckt und verliert
sich ganz im phant astischen Linienreiz.im zarten
unwirklichen Schwarz-Rosa. Das ist wie ein
neues Wesen, das lebt von sich. Man muß andere
Augen öffnen, um den Marseiller Hafen (1926)
zu sehen. Er gibt Ansicht, Darstellung eines
Lebensbereiches und keine solche unmittelbare
Einheit. So lebt er als Bild vor allem von einem
88
„Nave Nave Mahana" (1896, Abb. geg. S. 84),
das die Bekrönung der Ausstellung von Basel
bildete, ist er mit Hans von Marees verwandt,
suchte er dasselbe wie jener in seinen Hesperi-
den. Arkadien! Bei Gauguin flacher, leichter,
glücklicher, malästhetisch unendlich müheloser
hingebracht. Bei Marees gequälter, erkämpfter,
geheimnisvoller, undurchdringlicher. Marees
schafft sich seine Gestalt, Gauguin ist der Glück-
lichere, der sie einfach aus der Natur nehmen
kann. Marees ist dazu symbolisch tief als Deut-
scher. Aber die Parallele ist ungeheuer stark.
Freilich nur in wenigen höchsten Werken Gau-
guins wie diesem Lyoner. Hier ist auch nich t kos-
mischer Tiefsinn bildlich gestaltet, aber einem
Traume irdischer Glückseligkeit ist Erfüllung
geworden in der absoluten vegetabilen Einheit
von Mensch und Natur. Daß das Wirklichkeit
werde im Bilde, dazu darf eines nicht fehlen,
was französischem Boden entstammt. Vom Im-
pressionismus ist Gauguin auch hier die Freude
am Schein, am sinnlichen Reiz der genußreich
materialhafl gemalten Oberfläche der Dinge
geblieben, im Gegensatz zu anderen Bildern,
wo ihn ein gewollt Symbolhaftes oder auch nur
Dämonenphantastik zu zwiespältigen Dingen
verführt, und der Traum am Maler scheitert,
in Stücke zerfällt.
Der exotischen Bilder sind es nicht wenige, die
solche Zwiespältigkeit und merkwürdige Un-
sicherheit an sich haben. Da wird man plötzlich
dessen inne, daß man in dem Gauguin der Süd-
see eben doch einen in weite Ferne verirrten
Europäer vor sich hat, der in einer ihm fremden
Welt steht, außer ihr steht und dies als echter
sensibler Künstler in seinen W erken auch kund-
tun muß. Die bretonische Zeit erscheint da-
neben einheitlich, bei aller Vielfältigkeit der
Ausdrucksweise, einheitlich erscheint daneben
sogar die Frühzeit und stark in aller Zartheit.
Hier ist Schwanken und bisweilen Schwäche.
Es ist daran aber etwas, was ergreift, Mitgefühl
erheischt. Man blickt in Gauguins Inneres, in
seine zerrissene Seele. Man hat den Mann vor
sich, der dann in seinen letzten Tagen noch
jenes Bild malte mit dem Kirchturm und den
bretonischen Hütten tief im Schnee.
Aber wir vergessen, was doch oft auch an der
Ausstellung in Basel gesagt wurde, daß Gauguins
Malerei ohne Seele sei.
■Wilhelm Barth
ERICH HECKEL
Die Aufgabe zu Abbildungen künstlerischer
V\ erke einige Worte zu machen, sollte sich
dahin lösen, daß der Leser vom Reden geweckt,
zu sehen begehrt.
Heckeis hier veröffentlichte Bilder heben sich
deutlich von früheren bekannten ab. Die Zeich-
nung, die vorher unmittelbar und zugespitzt
die Bedeutung der Gegenstände, die Bezau-
berung des empfangenden Malers aussprach,
ist einer neuen Aufgabe zugewandt. Sie schil-
dert, sie stellt dar, sie wird aus Zeichen Nach-
zeichnung. Ebenso wie sie gibt sich jetzt die
Farbe zunächst der Erscheinung hin und läßt
sich von ihr bestimmen. An gelösterem Beich-
tum ist bei diesem ßildungsvorgang unendlich
gewonnen worden, schon weil nichts übergan-
gen werden mag, spaltet sich Farbe um Farbe.
Die Erregung des Malers, die Bildidee, stellt
sich nicht mehr nackt dar.
Mit der Darangabe der früheren Absicht werden
die Bildelemente: die Liebe des Gegenstandes,
der Einfall von Farbe und Aufbau, die beson-
dere Zeichenfähigkeit — freier und selbstän-
diger. Und also müssen sie für jedes einzelne
Bild in eine neue Ordnung eingefangen werden.
Das ermöglicht Leistungen von wieder und wie-
der erneutem Beziehungsreichtum, von früher
selten so dichter und reizvoller Knüpfung und
stellt sich doch wieder einer im Bilde durch-
schlagenden und einheitlichen Lösung entgegen,
die vorher wohl leichter greifbar war. So ganz
einleuchtend und ohne allzu rasche Auflösbar-
keit ist das kleine Gebirgsbild (1923), das der
verlassenen Art näher als die anderen steht.
Die tatsächliche Ansicht versteckt und verliert
sich ganz im phant astischen Linienreiz.im zarten
unwirklichen Schwarz-Rosa. Das ist wie ein
neues Wesen, das lebt von sich. Man muß andere
Augen öffnen, um den Marseiller Hafen (1926)
zu sehen. Er gibt Ansicht, Darstellung eines
Lebensbereiches und keine solche unmittelbare
Einheit. So lebt er als Bild vor allem von einem
88