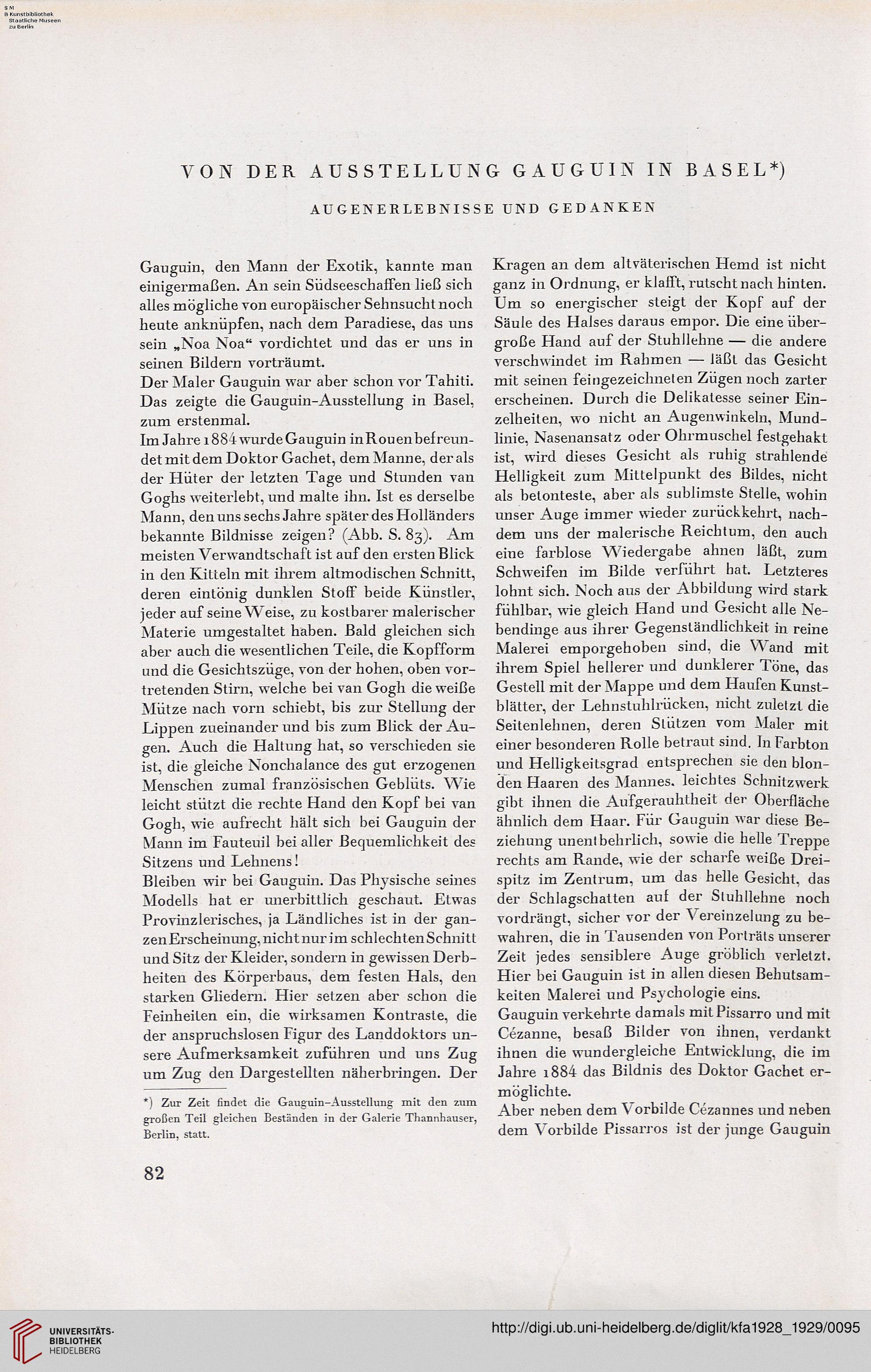VON DER AUSSTELLUNG GAUGUIN IN BASEL*)
AUGENERLEBNISSE UND GEDANKEN
Gauguin, den Mann der Exotik, kannte man
einigermaßen. An sein Südseeschaffen ließ sich
alles mögliche von europäischer Sehnsucht noch
heute anknüpfen, nach dem Paradiese, das uns
sein »Noa Noa" vordichtet und das er uns in
seinen Bildern vorträumt.
Der Maler Gauguin war aber schon vor Tahiti.
Das zeigte die Gauguin-Ausstellung in Basel,
zum erstenmal.
Im Jahre 1884 wurde Gauguin in Bouen befreun-
det mit dem Doktor Gachet, dem Manne, der als
der Hüter der letzten Tage und Stunden van
Goghs weiterlebt, und malte ihn. Ist es derselbe
Mann, den uns sechs Jahre später des Holländers
bekannte Bildnisse zeigen? (Abb. S. 83). Am
meisten Verwandtschaft ist auf den ersten Blick
in den Kitteln mit ihrem altmodischen Schnitt,
deren eintönig dunklen Stoff beide Künstler,
jeder auf seine Weise, zu kostbarer malerischer
Materie umgestaltet haben. Bald gleichen sich
aber auch die wesentlichen Teile, die Kopfform
und die Gesichtszüge, von der hohen, oben vor-
tretenden Stirn, welche bei van Gogh die weiße
Mütze nach vorn schiebt, bis zur Stellung der
Lippen zueinander und bis zum Blick der Au-
gen. Auch die Haltung hat, so verschieden sie
ist, die gleiche Nonchalance des gut erzogenen
Menschen zumal französischen Geblüts. Wie
leicht stützt die rechte Hand den Kopf bei van
Gogh, wie aufrecht hält sich bei Gauguin der
Mann im Fauteuil bei aller Bequemlichkeit des
Sitzens und Lehnens!
Bleiben wir bei Gauguin. Das Physische seines
Modells hat er unerbittlich geschaut. Etwas
Provinzlerisches, ja Ländliches ist in der gan-
zen Erscheinung, nicht nur im schlechten Schnitt
und Sitz der Kleider, sondern in gewissen Derb-
heiten des Körperbaus, dem festen Hals, den
starken Gliedern. Hier setzen aber schon die
Feinheiten ein, die wirksamen Kontraste, die
der anspruchslosen Figur des Landdoktors un-
sere Aufmerksamkeit zuführen und uns Zug
um Zug den Dargestellten näherbringen. Der
*) Zur Zeit findet die Gauguin-Ausstellung mit den zum
großen Teil gleichen Beständen in der Galerie Thannhauser,
Berlin, statt.
Kragen an dem altvaterischen Hemd ist nicht
ganz in Ordnung, er klafft, rutscht nach hinten.
Um so energischer steigt der Kopf auf der
Säule des Halses daraus empor. Die eine über-
große Hand auf der Stuhllehne — die andere
verschwindet im Rahmen — läßt das Gesicht
mit seinen feingezeichnelen Zügen noch zarter
erscheinen. Durch die Delikatesse seiner Ein-
zelbeiten, wo nicht an Augenwinkeln, Mund-
linie, Nasenansatz oder Ohrmuschel festgehakt
ist, wird dieses Gesicht als ruhig strahlende
Helligkeit zum Mittelpunkt des Bildes, nicht
als betonteste, aber als sublimste Stelle, wohin
unser Auge immer wieder zurückkehrt, nach-
dem uns der malerische Reichtum, den auch
eine farblose Wiedergabe ahnen läßt, zum
Schweifen im Bilde verführt hat. Letzteres
lohnt sich. Noch aus der Abbildung wird stark
fühlbar, wie gleich Hand und Gesicht alle Ne-
bendinge aus ihrer Gegenständlichkeit in reine
Malerei emporgehoben sind, die Wand mit
ihrem Spiel hellerer und dunklerer Töne, das
Gestell mit der Mappe und dem Haufen Kunst-
blätter, der Lehnstuhlrücken, nicht zuletzt die
Seitenlehnen, deren Stützen vom Maler mit
einer besonderen Rolle betraut sind. Jn Farbton
und Helligkeitsgrad entsprechen sie den blon-
den Haaren des Mannes, leichtes Schnitzwerk
gibt ihnen die Aufgerauhtheit der Oberfläche
ähnlich dem Haar. Für Gauguin war diese Be-
ziehung unentbehrlich, sowie die helle Treppe
rechts am Rande, wie der scharfe weiße Drei-
spitz im Zentrum, um das helle Gesicht, das
der Schlagschalten aul der Stuhllehne noch
vordrängt, sicher vor der Vereinzelung zu be-
wahren, die in Tausenden von Porträts unserer
Zeit jedes sensiblere Auge gröblich verletzt.
Hier bei Gauguin ist in allen diesen Behutsam-
keiten Malerei und Psychologie eins.
Gauguin verkehrte damals mit Pissarro und mit
Cezanne, besaß Bilder von ihnen, verdankt
ihnen die wundergleiche Entwicklung, die im
Jahre i884 das Bildnis des Doktor Gachet er-
möglichte.
Aber neben dem Vorbilde Cezannes und neben
dem Vorbilde Pissarros ist der junge Gauguin
82
AUGENERLEBNISSE UND GEDANKEN
Gauguin, den Mann der Exotik, kannte man
einigermaßen. An sein Südseeschaffen ließ sich
alles mögliche von europäischer Sehnsucht noch
heute anknüpfen, nach dem Paradiese, das uns
sein »Noa Noa" vordichtet und das er uns in
seinen Bildern vorträumt.
Der Maler Gauguin war aber schon vor Tahiti.
Das zeigte die Gauguin-Ausstellung in Basel,
zum erstenmal.
Im Jahre 1884 wurde Gauguin in Bouen befreun-
det mit dem Doktor Gachet, dem Manne, der als
der Hüter der letzten Tage und Stunden van
Goghs weiterlebt, und malte ihn. Ist es derselbe
Mann, den uns sechs Jahre später des Holländers
bekannte Bildnisse zeigen? (Abb. S. 83). Am
meisten Verwandtschaft ist auf den ersten Blick
in den Kitteln mit ihrem altmodischen Schnitt,
deren eintönig dunklen Stoff beide Künstler,
jeder auf seine Weise, zu kostbarer malerischer
Materie umgestaltet haben. Bald gleichen sich
aber auch die wesentlichen Teile, die Kopfform
und die Gesichtszüge, von der hohen, oben vor-
tretenden Stirn, welche bei van Gogh die weiße
Mütze nach vorn schiebt, bis zur Stellung der
Lippen zueinander und bis zum Blick der Au-
gen. Auch die Haltung hat, so verschieden sie
ist, die gleiche Nonchalance des gut erzogenen
Menschen zumal französischen Geblüts. Wie
leicht stützt die rechte Hand den Kopf bei van
Gogh, wie aufrecht hält sich bei Gauguin der
Mann im Fauteuil bei aller Bequemlichkeit des
Sitzens und Lehnens!
Bleiben wir bei Gauguin. Das Physische seines
Modells hat er unerbittlich geschaut. Etwas
Provinzlerisches, ja Ländliches ist in der gan-
zen Erscheinung, nicht nur im schlechten Schnitt
und Sitz der Kleider, sondern in gewissen Derb-
heiten des Körperbaus, dem festen Hals, den
starken Gliedern. Hier setzen aber schon die
Feinheiten ein, die wirksamen Kontraste, die
der anspruchslosen Figur des Landdoktors un-
sere Aufmerksamkeit zuführen und uns Zug
um Zug den Dargestellten näherbringen. Der
*) Zur Zeit findet die Gauguin-Ausstellung mit den zum
großen Teil gleichen Beständen in der Galerie Thannhauser,
Berlin, statt.
Kragen an dem altvaterischen Hemd ist nicht
ganz in Ordnung, er klafft, rutscht nach hinten.
Um so energischer steigt der Kopf auf der
Säule des Halses daraus empor. Die eine über-
große Hand auf der Stuhllehne — die andere
verschwindet im Rahmen — läßt das Gesicht
mit seinen feingezeichnelen Zügen noch zarter
erscheinen. Durch die Delikatesse seiner Ein-
zelbeiten, wo nicht an Augenwinkeln, Mund-
linie, Nasenansatz oder Ohrmuschel festgehakt
ist, wird dieses Gesicht als ruhig strahlende
Helligkeit zum Mittelpunkt des Bildes, nicht
als betonteste, aber als sublimste Stelle, wohin
unser Auge immer wieder zurückkehrt, nach-
dem uns der malerische Reichtum, den auch
eine farblose Wiedergabe ahnen läßt, zum
Schweifen im Bilde verführt hat. Letzteres
lohnt sich. Noch aus der Abbildung wird stark
fühlbar, wie gleich Hand und Gesicht alle Ne-
bendinge aus ihrer Gegenständlichkeit in reine
Malerei emporgehoben sind, die Wand mit
ihrem Spiel hellerer und dunklerer Töne, das
Gestell mit der Mappe und dem Haufen Kunst-
blätter, der Lehnstuhlrücken, nicht zuletzt die
Seitenlehnen, deren Stützen vom Maler mit
einer besonderen Rolle betraut sind. Jn Farbton
und Helligkeitsgrad entsprechen sie den blon-
den Haaren des Mannes, leichtes Schnitzwerk
gibt ihnen die Aufgerauhtheit der Oberfläche
ähnlich dem Haar. Für Gauguin war diese Be-
ziehung unentbehrlich, sowie die helle Treppe
rechts am Rande, wie der scharfe weiße Drei-
spitz im Zentrum, um das helle Gesicht, das
der Schlagschalten aul der Stuhllehne noch
vordrängt, sicher vor der Vereinzelung zu be-
wahren, die in Tausenden von Porträts unserer
Zeit jedes sensiblere Auge gröblich verletzt.
Hier bei Gauguin ist in allen diesen Behutsam-
keiten Malerei und Psychologie eins.
Gauguin verkehrte damals mit Pissarro und mit
Cezanne, besaß Bilder von ihnen, verdankt
ihnen die wundergleiche Entwicklung, die im
Jahre i884 das Bildnis des Doktor Gachet er-
möglichte.
Aber neben dem Vorbilde Cezannes und neben
dem Vorbilde Pissarros ist der junge Gauguin
82