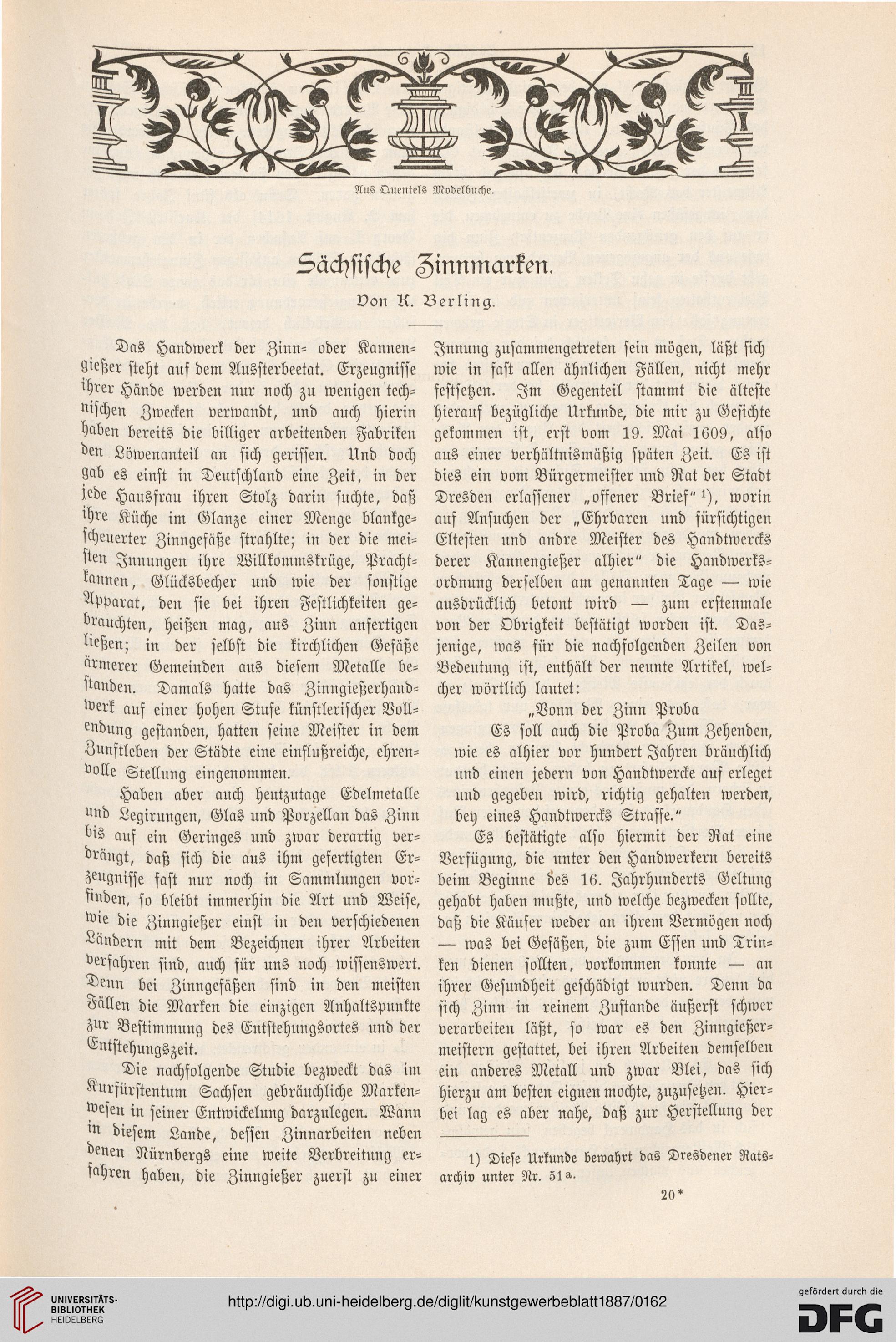Aus Quentels Modclbuche.
^ächsische Zinnmarken.
Von U. Berling.
Das Handwerk der Zinn- oder Kannen-
gießer steht auf dem Aussterbeetat. Erzeugnisse
ihrer Hände werden nur noch zn wenigen tech-
«ischen Zwecken verwandt, und auch hierin
haben bereits die billiger arbeitenden Fabriken
den Löwenanteil an sich gerissen. Und doch
3ab es einst in Deutschland eine Zeit, in der
lrde Hausfrau ihren Stolz darin suchte, daß
ihre Küche im Glanze eiuer Menge blankge-
scheuerter Zinngefäße strahlte; in der die mei-
sten Jnnungeu ihre Willkommskrüge, Pracht-
kannen, Glücksbecher und wie der sonstige
tiipparat, den sie bei ihren Festlichkeiteu ge-
brauchten, heißen mag, aus Zinn anfertigen
iießen; in der selbst die kirchlichen Gefäße
ärmerer Gemeinden aus diesem Metalle be-
sianden. Damals hatte das Zinngießerhand-
tverk auf einer hohen Stufe künstlerischer Voll-
endung gestanden, hatten seine Meister in dem
3unftleben der Städte eine einflußreiche, ehren-
bolle Stellung eingenommen.
Haben aber auch heutzutage Edelmetalle
and Legirungen, Glas und Porzellan das Zinn
dis auf ein Geringes und zwar derartig ver-
t>rängt, daß sich die aus ihm gefertigten Er-
zeugnisse sast nur noch in Sammlungen vor-
sinden, so bleibt immerhin die Art und Weise,
>vie die Zinngießer einst in den verschiedenen
Ländern mit dem Bezeichnen ihrer Arbeiten
berfahren sind, auch sür uns noch wissenswert.
Denn bei Zinngefäßen sind in den meisten
Fällen die Marken die einzigen Anhaltspunkte
zur Bestimmung des Entstehungsortes und der
^utstehungszeit.
Die nachfolgende Studie bezweckt das im
Kursürstentum Sachsen gebräuchliche Marken-
biesen in seiner Entwickelung darzulegen. Wann
'u diesem Lande, dessen Zinnarbeiten neben
denen Nürnbergs eine weite Verbreitung er-
sahren haben, die Zinngießer zuerst zu einer
Jnnung zusammengetreten sein mögen, läßt sich
wie in fast allen ähnlichen Fällen, nicht mehr
festsetzen. Jm Gegenteil stammt die älteste
hierauf bezügliche Urkunde, die mir zu Gesichte
gekommen ist, erst vom 19. Mai 1609, also
aus einer verhältnismäßig späten Zeit. Es ist
dies ein vom Bürgermeister und Rat der Stadt
Dresden erlassener „offener Brief"worin
auf Ansuchen der „Ehrbaren und fürsichtigeu
Eltesten und andre Meister des Handtwercks
derer Kannengießer alhier" die Handwerks-
ordnung derselben am genannten Tage — wie
ausdrücklich betont wird — zum erstenmale
von der Obrigkeit bestätigt worden ist. Das-
jenige, was sür die nachfolgenden Zeilen von
Bedeutung ist, enthält der neunte Artikel, wel-
cher wörtlich lautet:
„Vonn der Zinn Proba
Es soll auch die Proba Zum Zehenden,
wie es alhier vor hundert Jahren bräuchlich
und einen jedern von Handtwercke auf erleget
und gegeben wird, richtig gehalten werdcn,
bey eines Handtwercks Straffe."
Es bestätigte also hiermit der Rat eine
Verfügung, die unter den Handwerkern bereits
beim Beginne des 16. Jahrhunderts Geltung
gehabt haben mußte, und welche bezwecken sollte,
daß die Käufer weder an ihrem Vermögen noch
— was bei Gesäßen, die znm Essen und Trin-
ken dienen sollten, vorkommen konnte — an
ihrer Gesundheit geschädigt wurden. Denn da
sich Zinn in reinem Zustande äußerst schwer
verarbeiteu läßt, so war es den Zinngießer-
meisteru gestattet, bei ihren Arbeiten demselben
ein anderes Metall und zwar Blei, das sich
hierzu am besten eignen mochte, znzusetzen. Hier-
bei lag es aber nahe, daß zur Herstellung der
1) Diese Urkunde bewahrt das Dresdener Rats-
archiv unter Nr. Sl a.
20'
^ächsische Zinnmarken.
Von U. Berling.
Das Handwerk der Zinn- oder Kannen-
gießer steht auf dem Aussterbeetat. Erzeugnisse
ihrer Hände werden nur noch zn wenigen tech-
«ischen Zwecken verwandt, und auch hierin
haben bereits die billiger arbeitenden Fabriken
den Löwenanteil an sich gerissen. Und doch
3ab es einst in Deutschland eine Zeit, in der
lrde Hausfrau ihren Stolz darin suchte, daß
ihre Küche im Glanze eiuer Menge blankge-
scheuerter Zinngefäße strahlte; in der die mei-
sten Jnnungeu ihre Willkommskrüge, Pracht-
kannen, Glücksbecher und wie der sonstige
tiipparat, den sie bei ihren Festlichkeiteu ge-
brauchten, heißen mag, aus Zinn anfertigen
iießen; in der selbst die kirchlichen Gefäße
ärmerer Gemeinden aus diesem Metalle be-
sianden. Damals hatte das Zinngießerhand-
tverk auf einer hohen Stufe künstlerischer Voll-
endung gestanden, hatten seine Meister in dem
3unftleben der Städte eine einflußreiche, ehren-
bolle Stellung eingenommen.
Haben aber auch heutzutage Edelmetalle
and Legirungen, Glas und Porzellan das Zinn
dis auf ein Geringes und zwar derartig ver-
t>rängt, daß sich die aus ihm gefertigten Er-
zeugnisse sast nur noch in Sammlungen vor-
sinden, so bleibt immerhin die Art und Weise,
>vie die Zinngießer einst in den verschiedenen
Ländern mit dem Bezeichnen ihrer Arbeiten
berfahren sind, auch sür uns noch wissenswert.
Denn bei Zinngefäßen sind in den meisten
Fällen die Marken die einzigen Anhaltspunkte
zur Bestimmung des Entstehungsortes und der
^utstehungszeit.
Die nachfolgende Studie bezweckt das im
Kursürstentum Sachsen gebräuchliche Marken-
biesen in seiner Entwickelung darzulegen. Wann
'u diesem Lande, dessen Zinnarbeiten neben
denen Nürnbergs eine weite Verbreitung er-
sahren haben, die Zinngießer zuerst zu einer
Jnnung zusammengetreten sein mögen, läßt sich
wie in fast allen ähnlichen Fällen, nicht mehr
festsetzen. Jm Gegenteil stammt die älteste
hierauf bezügliche Urkunde, die mir zu Gesichte
gekommen ist, erst vom 19. Mai 1609, also
aus einer verhältnismäßig späten Zeit. Es ist
dies ein vom Bürgermeister und Rat der Stadt
Dresden erlassener „offener Brief"worin
auf Ansuchen der „Ehrbaren und fürsichtigeu
Eltesten und andre Meister des Handtwercks
derer Kannengießer alhier" die Handwerks-
ordnung derselben am genannten Tage — wie
ausdrücklich betont wird — zum erstenmale
von der Obrigkeit bestätigt worden ist. Das-
jenige, was sür die nachfolgenden Zeilen von
Bedeutung ist, enthält der neunte Artikel, wel-
cher wörtlich lautet:
„Vonn der Zinn Proba
Es soll auch die Proba Zum Zehenden,
wie es alhier vor hundert Jahren bräuchlich
und einen jedern von Handtwercke auf erleget
und gegeben wird, richtig gehalten werdcn,
bey eines Handtwercks Straffe."
Es bestätigte also hiermit der Rat eine
Verfügung, die unter den Handwerkern bereits
beim Beginne des 16. Jahrhunderts Geltung
gehabt haben mußte, und welche bezwecken sollte,
daß die Käufer weder an ihrem Vermögen noch
— was bei Gesäßen, die znm Essen und Trin-
ken dienen sollten, vorkommen konnte — an
ihrer Gesundheit geschädigt wurden. Denn da
sich Zinn in reinem Zustande äußerst schwer
verarbeiteu läßt, so war es den Zinngießer-
meisteru gestattet, bei ihren Arbeiten demselben
ein anderes Metall und zwar Blei, das sich
hierzu am besten eignen mochte, znzusetzen. Hier-
bei lag es aber nahe, daß zur Herstellung der
1) Diese Urkunde bewahrt das Dresdener Rats-
archiv unter Nr. Sl a.
20'