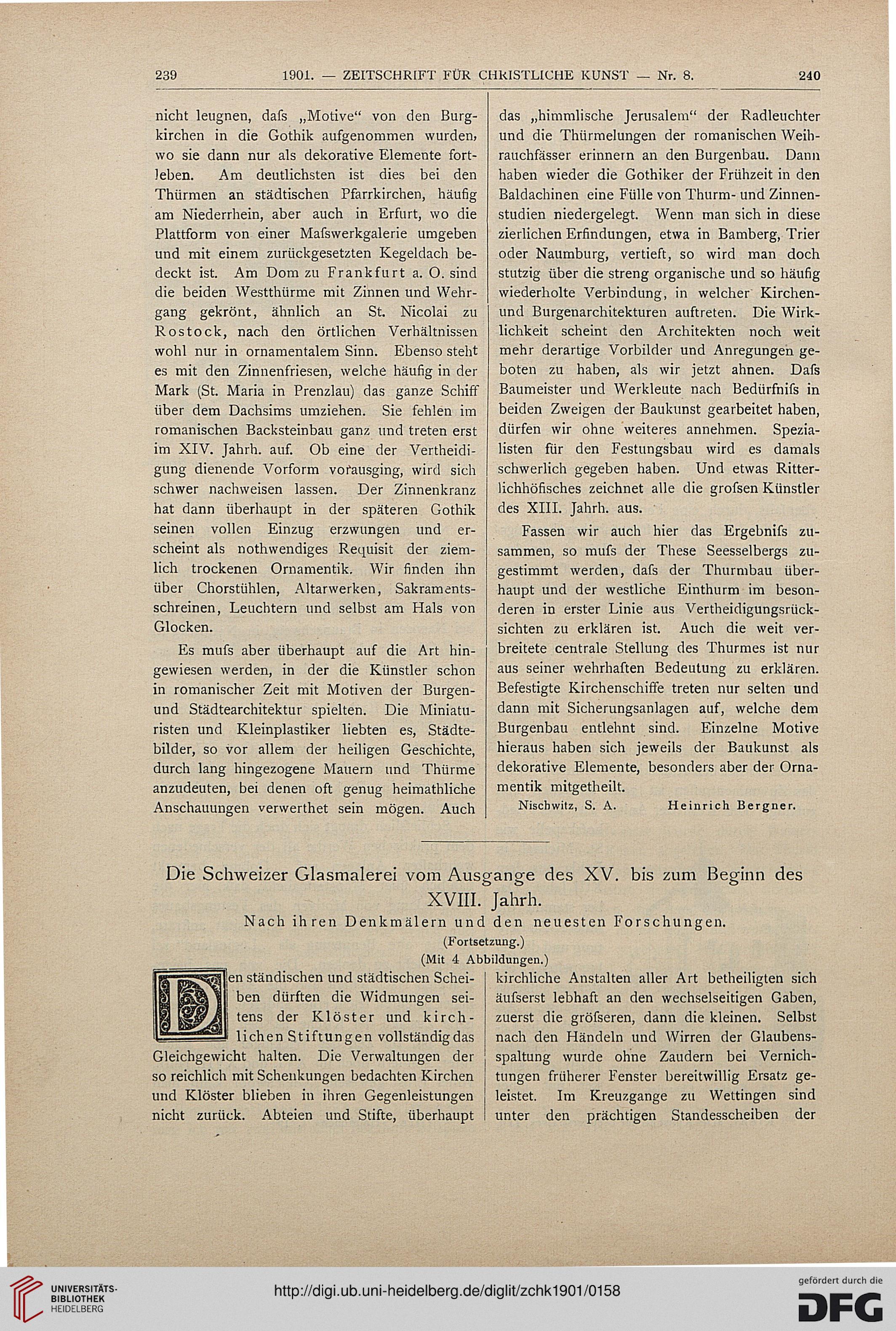239
1901.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTUCHE KUNST
Nr. 8.
240
nicht leugnen, dafs „Motive" von den Burg-
kirchen in die Gothik aufgenommen wurdenj
wo sie dann nur als dekorative Elemente fort-
leben. Am deutlichsten ist dies bei den
Thürmen an städtischen Pfarrkirchen, häufig
am Niederrhein, aber auch in Erfurt, wo die
Plattform von einer Mafsvverkgalerie umgeben
und mit einem zurückgesetzten Kegeldach be-
deckt ist. Am Dom zu Frankfurt a. O. sind
die beiden Westthürme mit Zinnen und Wehr-
gang gekrönt, ähnlich an St. Nicolai zu
Rostock, nach den örtlichen Verhältnissen
wohl nur in ornamentalem Sinn. Ebenso steht
es mit den Zinnenfriesen, welche häufig in der
Mark (St. Maria in Prenzlau) das ganze Schiff
über dem Dachsims umziehen. Sie fehlen im
romanischen Backsteinbau ganz und treten erst
im XIV. Jahrh. auf. Ob eine der Verteidi-
gung dienende Vorform vorausging, wird sich
schwer nachweisen lassen. Der Zinnenkranz
hat dann überhaupt in der späteren Gothik
seinen vollen Einzug erzwungen und er-
scheint als nothwendiges Requisit der ziem-
lich trockenen Ornamentik. Wir finden ihn
über Chorstühlen, Altarwerken, Sakraments-
schreinen, Leuchtern und selbst am Hals von
Glocken.
Es mufs aber überhaupt auf die Art hin-
gewiesen werden, in der die Künstler schon
in romanischer Zeit mit Motiven der Burgen-
und Städtearchitektur spielten. Die Miniatu-
risten und Kleinplastiker liebten es, Städte-
bilder, so vor allem der heiligen Geschichte,
durch lang hingezogene Mauern und Thürme
anzudeuten, bei denen oft genug heimathliche
Anschauungen verwerthet sein mögen. Auch
das „himmlische Jerusalem" der Radleuchter
und die Thürmelungen der romanischen Weih-
rauchfässer erinnern an den Burgenbau. Dann
haben wieder die Gothiker der Frühzeit in den
Baldachinen eine Fülle von Thurm- und Zinnen-
studien niedergelegt. Wenn man sich in diese
zierlichen Erfindungen, etwa in Bamberg, Trier
oder Naumburg, vertieft, so wird man doch
stutzig über die streng organische und so häufig
wiederholte Verbindung, in welcher Kirchen-
und Burgenarchitekturen auftreten. Die Wirk-
lichkeit scheint den Architekten noch weit
mehr derartige Vorbilder und Anregungen ge-
boten zu haben, als wir jetzt ahnen. Dafs
Baumeister und Werkleute nach Bedürfnifs in
beiden Zweigen der Baukunst gearbeitet haben,
dürfen wir ohne weiteres annehmen. Spezia-
listen für den Festungsbau wird es damals
schwerlich gegeben haben. Und etwas Ritter-
lichhöfisches zeichnet alle die grofsen Künstler
des XIII. Jahrh. aus.
Fassen wir auch hier das Ergebnifs zu-
sammen, so mufs der These Seesselbergs zu-
gestimmt werden, dafs der Thurmbau über-
haupt und der westliche Einthurm im beson-
deren in erster Linie aus Vertheidigungsrück-
sichten zu erklären ist. Auch die weit ver-
breitete centrale Stellung des Thurmes ist nur
aus seiner wehrhaften Bedeutung zu erklären.
Befestigte Kirchenschiffe treten nur selten und
dann mit Sicherungsanlagen auf, welche dem
Burgenbau entlehnt sind. Einzelne Motive
hieraus haben sich jeweils der Baukunst als
dekorative Elemente, besonders aber der Orna-
mentik mitgetheilt.
Niscbwitz, S. A. Heinrich Bergner.
Die Schweizer Glasmalerei vom Ausgange des XV. bis zum Beginn des
XVIII. Jahrh.
Nach ihren Denkmälern und den neuesten Forschungen.
(Fortsetzung.)
(Mit 4 Abbildungen.)
Ijen ständischen und städtischen Schei-
ben dürften die Widmungen sei-
tens der Klöster und kirch-
lichen Stiftungen vollständig das
Gleichgewicht halten. Die Verwaltungen der
so reichlich mit Schenkungen bedachten Kirchen
und Klöster blieben in ihren Gegenleistungen
nicht zurück. Abteien und Stifte, überhaupt
kirchliche Anstalten aller Art betheiligten sich
äufserst lebhaft an den wechselseitigen Gaben,
zuerst die gröfseren, dann die kleinen. Selbst
nach den Händeln und Wirren der Glaubens-
spaltung wurde ohne Zaudern bei Vernich-
tungen früherer Fenster bereitwillig Ersatz ge-
leistet. Im Kreuzgange zu Wettingen sind
unter den prächtigen Standesscheiben der
1901.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTUCHE KUNST
Nr. 8.
240
nicht leugnen, dafs „Motive" von den Burg-
kirchen in die Gothik aufgenommen wurdenj
wo sie dann nur als dekorative Elemente fort-
leben. Am deutlichsten ist dies bei den
Thürmen an städtischen Pfarrkirchen, häufig
am Niederrhein, aber auch in Erfurt, wo die
Plattform von einer Mafsvverkgalerie umgeben
und mit einem zurückgesetzten Kegeldach be-
deckt ist. Am Dom zu Frankfurt a. O. sind
die beiden Westthürme mit Zinnen und Wehr-
gang gekrönt, ähnlich an St. Nicolai zu
Rostock, nach den örtlichen Verhältnissen
wohl nur in ornamentalem Sinn. Ebenso steht
es mit den Zinnenfriesen, welche häufig in der
Mark (St. Maria in Prenzlau) das ganze Schiff
über dem Dachsims umziehen. Sie fehlen im
romanischen Backsteinbau ganz und treten erst
im XIV. Jahrh. auf. Ob eine der Verteidi-
gung dienende Vorform vorausging, wird sich
schwer nachweisen lassen. Der Zinnenkranz
hat dann überhaupt in der späteren Gothik
seinen vollen Einzug erzwungen und er-
scheint als nothwendiges Requisit der ziem-
lich trockenen Ornamentik. Wir finden ihn
über Chorstühlen, Altarwerken, Sakraments-
schreinen, Leuchtern und selbst am Hals von
Glocken.
Es mufs aber überhaupt auf die Art hin-
gewiesen werden, in der die Künstler schon
in romanischer Zeit mit Motiven der Burgen-
und Städtearchitektur spielten. Die Miniatu-
risten und Kleinplastiker liebten es, Städte-
bilder, so vor allem der heiligen Geschichte,
durch lang hingezogene Mauern und Thürme
anzudeuten, bei denen oft genug heimathliche
Anschauungen verwerthet sein mögen. Auch
das „himmlische Jerusalem" der Radleuchter
und die Thürmelungen der romanischen Weih-
rauchfässer erinnern an den Burgenbau. Dann
haben wieder die Gothiker der Frühzeit in den
Baldachinen eine Fülle von Thurm- und Zinnen-
studien niedergelegt. Wenn man sich in diese
zierlichen Erfindungen, etwa in Bamberg, Trier
oder Naumburg, vertieft, so wird man doch
stutzig über die streng organische und so häufig
wiederholte Verbindung, in welcher Kirchen-
und Burgenarchitekturen auftreten. Die Wirk-
lichkeit scheint den Architekten noch weit
mehr derartige Vorbilder und Anregungen ge-
boten zu haben, als wir jetzt ahnen. Dafs
Baumeister und Werkleute nach Bedürfnifs in
beiden Zweigen der Baukunst gearbeitet haben,
dürfen wir ohne weiteres annehmen. Spezia-
listen für den Festungsbau wird es damals
schwerlich gegeben haben. Und etwas Ritter-
lichhöfisches zeichnet alle die grofsen Künstler
des XIII. Jahrh. aus.
Fassen wir auch hier das Ergebnifs zu-
sammen, so mufs der These Seesselbergs zu-
gestimmt werden, dafs der Thurmbau über-
haupt und der westliche Einthurm im beson-
deren in erster Linie aus Vertheidigungsrück-
sichten zu erklären ist. Auch die weit ver-
breitete centrale Stellung des Thurmes ist nur
aus seiner wehrhaften Bedeutung zu erklären.
Befestigte Kirchenschiffe treten nur selten und
dann mit Sicherungsanlagen auf, welche dem
Burgenbau entlehnt sind. Einzelne Motive
hieraus haben sich jeweils der Baukunst als
dekorative Elemente, besonders aber der Orna-
mentik mitgetheilt.
Niscbwitz, S. A. Heinrich Bergner.
Die Schweizer Glasmalerei vom Ausgange des XV. bis zum Beginn des
XVIII. Jahrh.
Nach ihren Denkmälern und den neuesten Forschungen.
(Fortsetzung.)
(Mit 4 Abbildungen.)
Ijen ständischen und städtischen Schei-
ben dürften die Widmungen sei-
tens der Klöster und kirch-
lichen Stiftungen vollständig das
Gleichgewicht halten. Die Verwaltungen der
so reichlich mit Schenkungen bedachten Kirchen
und Klöster blieben in ihren Gegenleistungen
nicht zurück. Abteien und Stifte, überhaupt
kirchliche Anstalten aller Art betheiligten sich
äufserst lebhaft an den wechselseitigen Gaben,
zuerst die gröfseren, dann die kleinen. Selbst
nach den Händeln und Wirren der Glaubens-
spaltung wurde ohne Zaudern bei Vernich-
tungen früherer Fenster bereitwillig Ersatz ge-
leistet. Im Kreuzgange zu Wettingen sind
unter den prächtigen Standesscheiben der