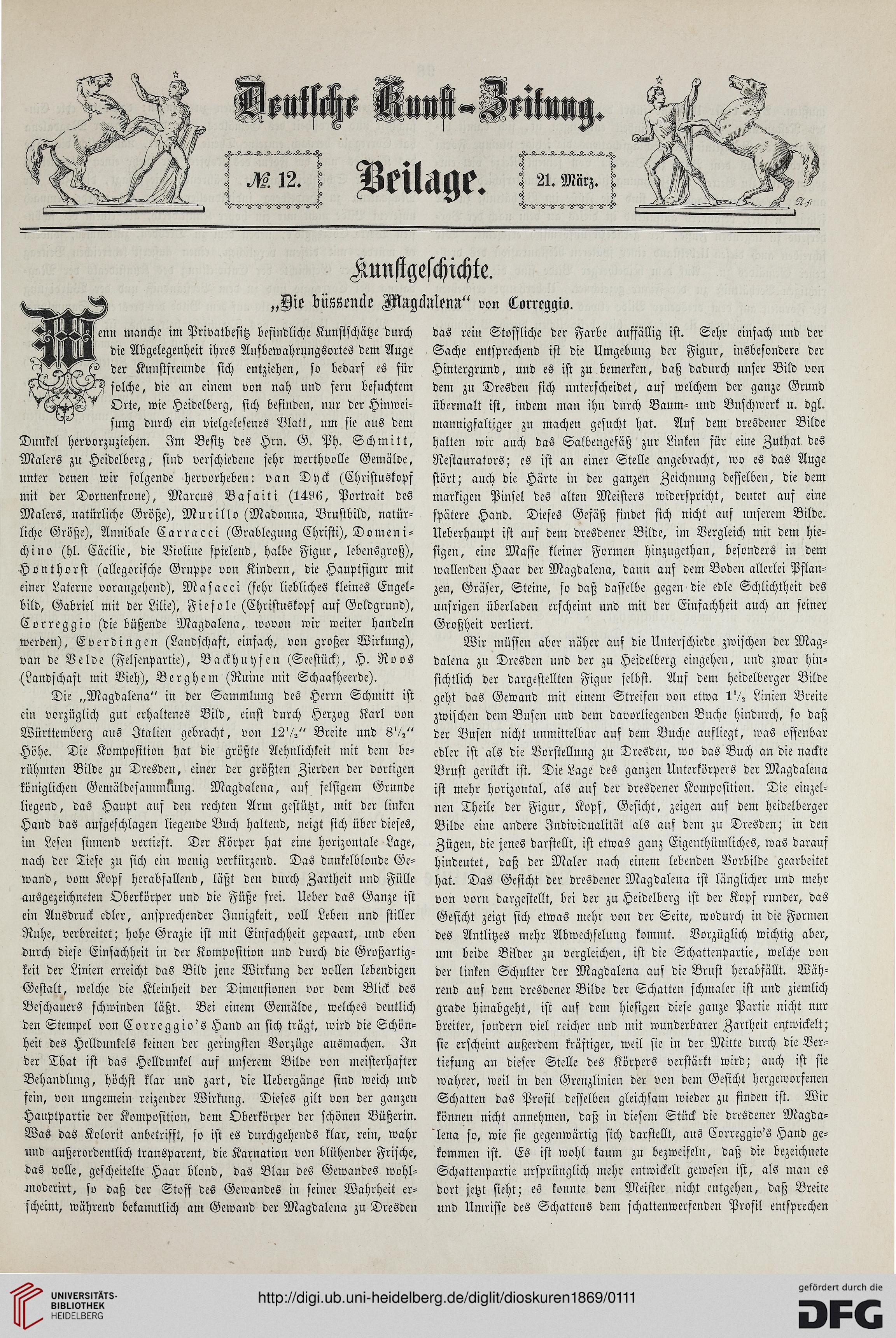Kunstgeschichte.
„Die düssenöe Ma-görrlena" von Correggio.
n manche im Privatbesitz befindliche Kunstschätze durch
die Abgelegenheit ihres Aufbewahrungsortes dem Auge
der Kunstfreunde sich entziehen, so bedarf es für
solche, die an einem von nah und fern besuchtem
Orte, wie Heidelberg, sich befinden, nur der Hinwei-
sung durch ein vielgelesenes Blatt, um sie aus dem
Dunkel hervorzuziehen. Im Besitz des Hrn. G. Ph. Schmitt,
Malers zu Heidelberg, sind verschiedene sehr werthvolle Gemälve,
unter denen wir folgende hervorheben: van Dyck (Christuskopf
mit der Dornenkrone), Marcus Basaiti (1496, Portrait des
Malers, natürliche Größe), Murillo (Madonna, Brustbild, natür-
liche Größe), Annibale Carracci (Grablegung Christi), Domeni-
chino (hl. Cäcilie, die Violine spielend, halbe Figur, lebensgroß),
Honthorst (allegorische Gruppe von Kindern, die Hauptfigur mit
einer Laterne vorangehend), Masacci (sehr liebliches kleines Engel-
bild, Gabriel mit der Lilie), Fiesole (Christuskopf auf Goldgrund),
Correggio (die büßende Magdalena, wovon wir weiter handeln
werden), Everdingen (Landschaft, einfach, von großer Wirkung),
van de Velde (Felsenpartie), Backhuysen (Seestück), H. Roos
(Landschaft mit Vieh), Berghem (Ruine mit Schaafheerde).
Die „Magdalena" in der Sammlung des Herrn Schmitt ist
ein vorzüglich gut erhaltenes Bild, einst durch Herzog Karl von
Württemberg aus Italien gebracht, von 12'/-" Breite und 8'/-"
Höhe. Die Komposition hat die größte Aehnlichkeit mit dem be-
rühmten Bilde zu Dresden, einer der größten Zierden der dortigen
königlichen Gemäldesammlung. Magdalena, auf felsigem Grunde
liegend, das Haupt auf den rechten Arm gestützt, mit der linken
Hand das aufgeschlagen liegende Buch haltend, neigt sich über dieses,
im Lesen sinnend vertieft. Der Körper hat eine horizontale Lage,
nach der Tiefe zu sich ein wenig verkürzend. Das dunkelblonde Ge-
wand, vom Kopf herabfallend, läßt den durch Zartheit und Fülle
ausgezeichneten Oberkörper und die Füße frei. Ueber das Ganze ist
ein Ausdruck edler, ansprechender Innigkeit, voll Leben und stiller
Ruhe, verbreitet; hohe Grazie ist mit Einfachheit gepaart, und eben
durch diese Einfachheit in der Komposition und durch die Großartig-
keit der Linien erreicht das Bild jene Wirkung der vollen lebendigen
Gestalt, welche die Kleinheit der Dimensionen vor dem Blick des
Beschauers schwinden läßt. Bei einem Gemälve, welches deutlich
den Stempel von Correggio's Hand an sich trägt, wird die Schön-
heit des Helldunkels keinen der geringsten Vorzüge ausmachen. In
der That ist das Helldunkel auf unserem Bilde von meisterhafter
Behandlung, höchst klar und zart, die Uebergänge sind weich und
fein, von ungemein reizender Wirkung. Dieses gilt von der ganzen
Hauptpartie der Komposition, dem Oberkörper der schönen Büßerin.
Was das Kolorit anbetrisft, so ist es durchgehends klar, rein, wahr
und außerordentlich transparent, die Karnation von blühender Frische,
das volle, gescheitelte Haar blond, das Blau des Gewandes wohl-
moderirt, so daß der Stoff des Gewandes in seiner Wahrheit er-
scheint, während bekanntlich am Gewand der Magdalena zu Dresden
das rein Stoffliche der Farbe auffällig ist. Sehr einfach und der
Sache entsprechend ist die Umgebung der Figur, insbesondere der
Hintergrund, und es ist zu bemerken, daß dadurch unser Bild von
dem zu Dresden sich unterscheidet, auf welchem der ganze Grund
übermalt ist, indem man ihn durch Baum- und Buschwerk u. dgl.
mannigfaltiger zu machen gesucht hat. Auf dem dresdener Bilde
halten wir auch das Salbengefäß zur Linken für eine Zuthat des
Restaurators; es ist an einer Stelle angebracht, wo es das Auge
stört; auch die Härte in der ganzen Zeichnung desselben, die dem
markigen Pinsel des alten Meisters widerspricht, deutet auf eine
spätere Hand. Dieses Gefäß findet sich nicht auf unserem Bilde.
Ueberhaupt ist auf dem dresdener Bilde, im Vergleich mit dem hie-
sigen, eine Masse kleiner Formen hinzugethan, besonders in dem
wallenden Haar der Magdalena, dann auf dem Boden allerlei Pflan-
zen, Gräser, Steine, so daß dasselbe gegen die edle Schlichtheit des
uusrigen überladen erscheint und mit der Einfachheit auch an seiner
Großheit verliert.
Wir müssen aber näher auf die Unterschiede zwischen der Mag-
dalena zu Dresden und der zu Heidelberg eingehen, und zwar hin-
sichtlich der dargestellten Figur selbst. Auf dem heivelberger Bilde
geht das Gewand mit einem Streifen von etwa 1'/- Linien Breite
zwischen dem Busen und dem davorliegenden Buche hindurch, so daß
der Busen nicht unmittelbar auf dem Buche aufliegt, was offenbar-
edler ist als die Vorstellung zu Dresden, wo das Buch an die nackte
Brust gerückt ist. Die Lage des ganzen Unterkörpers der Magdalena
ist mehr horizontal, als auf der dresdener Komposition. Die einzel-
nen Theile der Figur, Kopf, Gesicht, zeigen auf dem Heidelberger-
Bilde eine andere Individualität als auf dem zu Dresden; in den
Zügen, die jenes darstellt, ist etwas ganz Eigenthümliches, was daraus
hindeutet, daß der Maler nach einem lebenden Vorbilde gearbeitet
hat. Das Gesicht der dresdener Magdalena ist länglicher und mehr
von vorn dargestellt, bei der zu Heidelberg ist der Kopf runder, das
Gesicht zeigt sich etwas mehr von der Seite, wodurch in die Formen
des Antlitzes mehr Abwechselung kommt. Vorzüglich wichtig aber,
um beide Bilder zu vergleichen, ist die Schattenpartie, welche von
der linken Schulter der Magdalena auf die Brust herabfällt. Wäh-
rend auf dem dresdener Bilde der Schatten schmaler ist und ziemlich
grade hinabgeht, ist auf dem hiesigen diese ganze Partie nicht nur
breiter, sondern viel reicher und mit wunderbarer Zartheit entwickelte-
ste erscheint außerdem kräftiger, weil sie in der Mitte durch die Ver-
tiefung an dieser Stelle des Körpers verstärkt wird; auch ist sie
wahrer, weil in den Grenzlinien der von dem Gesicht hergeworfenen
Schatten das Profil desselben gleichsam wieder zu finden ist. Wir
können nicht annehmen, daß in diesem Stück die dresdener Magda-
lena so, wie sie gegenwärtig sich darstellt, aus Correggio's Hand ge-
kommen ist. Es ist wohl kaum zu bezweifeln, daß die bezeichnete
Schattenpartie ursprünglich mehr entwickelt gewesen ist, als man es
dort jetzt sieht; es konnte dem Meister nicht entgehen, daß Breite
und Umrisse des Schattens dem schattenwersenden Profil entsprechen
„Die düssenöe Ma-görrlena" von Correggio.
n manche im Privatbesitz befindliche Kunstschätze durch
die Abgelegenheit ihres Aufbewahrungsortes dem Auge
der Kunstfreunde sich entziehen, so bedarf es für
solche, die an einem von nah und fern besuchtem
Orte, wie Heidelberg, sich befinden, nur der Hinwei-
sung durch ein vielgelesenes Blatt, um sie aus dem
Dunkel hervorzuziehen. Im Besitz des Hrn. G. Ph. Schmitt,
Malers zu Heidelberg, sind verschiedene sehr werthvolle Gemälve,
unter denen wir folgende hervorheben: van Dyck (Christuskopf
mit der Dornenkrone), Marcus Basaiti (1496, Portrait des
Malers, natürliche Größe), Murillo (Madonna, Brustbild, natür-
liche Größe), Annibale Carracci (Grablegung Christi), Domeni-
chino (hl. Cäcilie, die Violine spielend, halbe Figur, lebensgroß),
Honthorst (allegorische Gruppe von Kindern, die Hauptfigur mit
einer Laterne vorangehend), Masacci (sehr liebliches kleines Engel-
bild, Gabriel mit der Lilie), Fiesole (Christuskopf auf Goldgrund),
Correggio (die büßende Magdalena, wovon wir weiter handeln
werden), Everdingen (Landschaft, einfach, von großer Wirkung),
van de Velde (Felsenpartie), Backhuysen (Seestück), H. Roos
(Landschaft mit Vieh), Berghem (Ruine mit Schaafheerde).
Die „Magdalena" in der Sammlung des Herrn Schmitt ist
ein vorzüglich gut erhaltenes Bild, einst durch Herzog Karl von
Württemberg aus Italien gebracht, von 12'/-" Breite und 8'/-"
Höhe. Die Komposition hat die größte Aehnlichkeit mit dem be-
rühmten Bilde zu Dresden, einer der größten Zierden der dortigen
königlichen Gemäldesammlung. Magdalena, auf felsigem Grunde
liegend, das Haupt auf den rechten Arm gestützt, mit der linken
Hand das aufgeschlagen liegende Buch haltend, neigt sich über dieses,
im Lesen sinnend vertieft. Der Körper hat eine horizontale Lage,
nach der Tiefe zu sich ein wenig verkürzend. Das dunkelblonde Ge-
wand, vom Kopf herabfallend, läßt den durch Zartheit und Fülle
ausgezeichneten Oberkörper und die Füße frei. Ueber das Ganze ist
ein Ausdruck edler, ansprechender Innigkeit, voll Leben und stiller
Ruhe, verbreitet; hohe Grazie ist mit Einfachheit gepaart, und eben
durch diese Einfachheit in der Komposition und durch die Großartig-
keit der Linien erreicht das Bild jene Wirkung der vollen lebendigen
Gestalt, welche die Kleinheit der Dimensionen vor dem Blick des
Beschauers schwinden läßt. Bei einem Gemälve, welches deutlich
den Stempel von Correggio's Hand an sich trägt, wird die Schön-
heit des Helldunkels keinen der geringsten Vorzüge ausmachen. In
der That ist das Helldunkel auf unserem Bilde von meisterhafter
Behandlung, höchst klar und zart, die Uebergänge sind weich und
fein, von ungemein reizender Wirkung. Dieses gilt von der ganzen
Hauptpartie der Komposition, dem Oberkörper der schönen Büßerin.
Was das Kolorit anbetrisft, so ist es durchgehends klar, rein, wahr
und außerordentlich transparent, die Karnation von blühender Frische,
das volle, gescheitelte Haar blond, das Blau des Gewandes wohl-
moderirt, so daß der Stoff des Gewandes in seiner Wahrheit er-
scheint, während bekanntlich am Gewand der Magdalena zu Dresden
das rein Stoffliche der Farbe auffällig ist. Sehr einfach und der
Sache entsprechend ist die Umgebung der Figur, insbesondere der
Hintergrund, und es ist zu bemerken, daß dadurch unser Bild von
dem zu Dresden sich unterscheidet, auf welchem der ganze Grund
übermalt ist, indem man ihn durch Baum- und Buschwerk u. dgl.
mannigfaltiger zu machen gesucht hat. Auf dem dresdener Bilde
halten wir auch das Salbengefäß zur Linken für eine Zuthat des
Restaurators; es ist an einer Stelle angebracht, wo es das Auge
stört; auch die Härte in der ganzen Zeichnung desselben, die dem
markigen Pinsel des alten Meisters widerspricht, deutet auf eine
spätere Hand. Dieses Gefäß findet sich nicht auf unserem Bilde.
Ueberhaupt ist auf dem dresdener Bilde, im Vergleich mit dem hie-
sigen, eine Masse kleiner Formen hinzugethan, besonders in dem
wallenden Haar der Magdalena, dann auf dem Boden allerlei Pflan-
zen, Gräser, Steine, so daß dasselbe gegen die edle Schlichtheit des
uusrigen überladen erscheint und mit der Einfachheit auch an seiner
Großheit verliert.
Wir müssen aber näher auf die Unterschiede zwischen der Mag-
dalena zu Dresden und der zu Heidelberg eingehen, und zwar hin-
sichtlich der dargestellten Figur selbst. Auf dem heivelberger Bilde
geht das Gewand mit einem Streifen von etwa 1'/- Linien Breite
zwischen dem Busen und dem davorliegenden Buche hindurch, so daß
der Busen nicht unmittelbar auf dem Buche aufliegt, was offenbar-
edler ist als die Vorstellung zu Dresden, wo das Buch an die nackte
Brust gerückt ist. Die Lage des ganzen Unterkörpers der Magdalena
ist mehr horizontal, als auf der dresdener Komposition. Die einzel-
nen Theile der Figur, Kopf, Gesicht, zeigen auf dem Heidelberger-
Bilde eine andere Individualität als auf dem zu Dresden; in den
Zügen, die jenes darstellt, ist etwas ganz Eigenthümliches, was daraus
hindeutet, daß der Maler nach einem lebenden Vorbilde gearbeitet
hat. Das Gesicht der dresdener Magdalena ist länglicher und mehr
von vorn dargestellt, bei der zu Heidelberg ist der Kopf runder, das
Gesicht zeigt sich etwas mehr von der Seite, wodurch in die Formen
des Antlitzes mehr Abwechselung kommt. Vorzüglich wichtig aber,
um beide Bilder zu vergleichen, ist die Schattenpartie, welche von
der linken Schulter der Magdalena auf die Brust herabfällt. Wäh-
rend auf dem dresdener Bilde der Schatten schmaler ist und ziemlich
grade hinabgeht, ist auf dem hiesigen diese ganze Partie nicht nur
breiter, sondern viel reicher und mit wunderbarer Zartheit entwickelte-
ste erscheint außerdem kräftiger, weil sie in der Mitte durch die Ver-
tiefung an dieser Stelle des Körpers verstärkt wird; auch ist sie
wahrer, weil in den Grenzlinien der von dem Gesicht hergeworfenen
Schatten das Profil desselben gleichsam wieder zu finden ist. Wir
können nicht annehmen, daß in diesem Stück die dresdener Magda-
lena so, wie sie gegenwärtig sich darstellt, aus Correggio's Hand ge-
kommen ist. Es ist wohl kaum zu bezweifeln, daß die bezeichnete
Schattenpartie ursprünglich mehr entwickelt gewesen ist, als man es
dort jetzt sieht; es konnte dem Meister nicht entgehen, daß Breite
und Umrisse des Schattens dem schattenwersenden Profil entsprechen