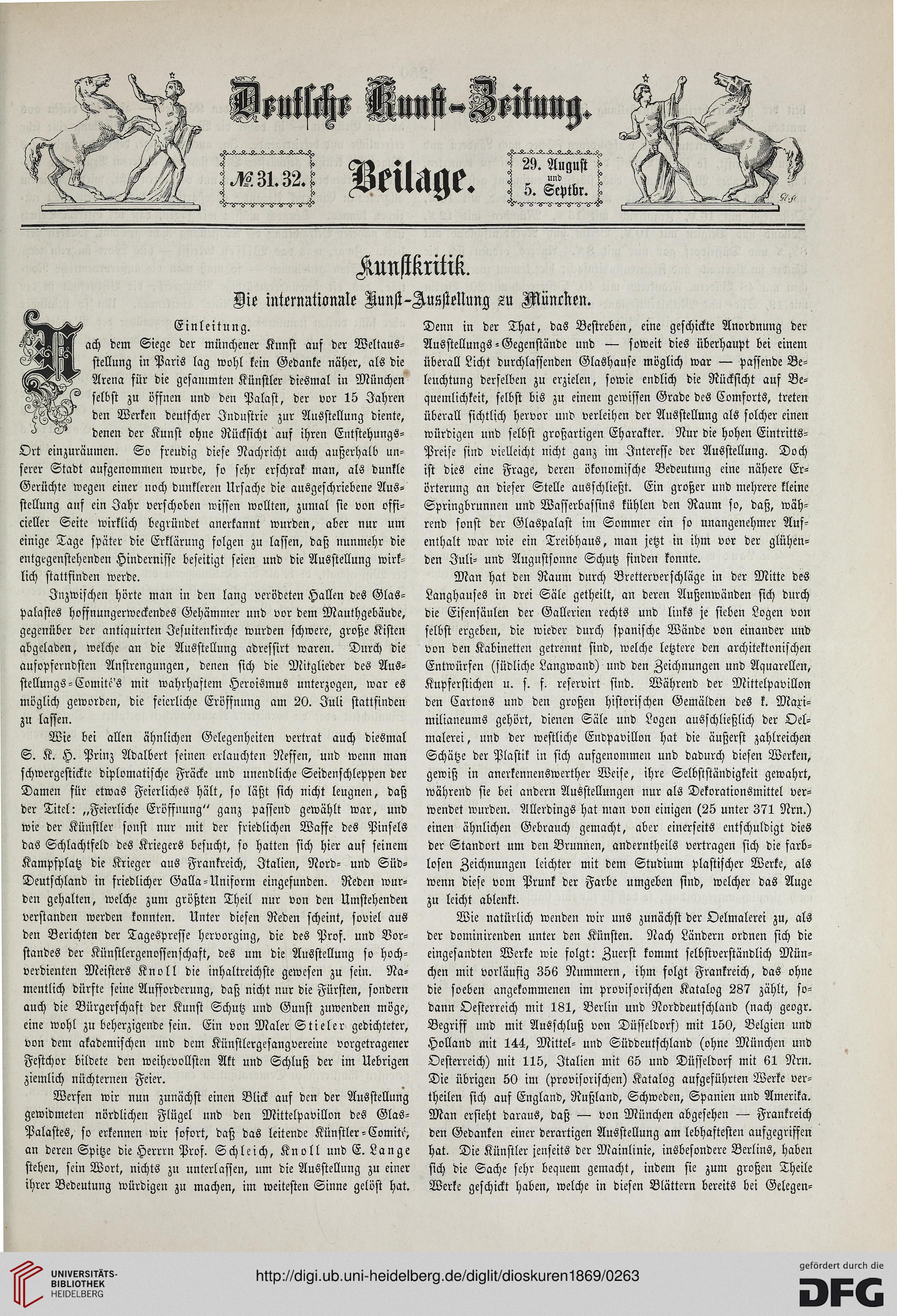Kunstkritik.
Die internationale Jurist-Ausstellung Zu Münclmi.
Einleitung.
jj^ ach dem Siege der Münchener Kunst auf der Weitaus-
st^ung in Paris lag wohl kein Gedanke näher, als die
Arena für die gesammten Künstler diesmal in München
selbst zu öffnen und den Palast, der vor 15 Jahren
^^|||) den Werken deutscher Industrie zur Ausstellung diente,
^ denen der Kunst ohne Rücksicht auf ihren Entstehungs-
Ort einzuräumen. So freudig diese Nachricht auch außerhalb un-
serer Stadt ausgenommen wurde, so sehr erschrak man, als dunkle
Gerüchte wegen einer noch dunkleren Ursache die ausgeschriebene Aus-
stellung ans ein Jahr verschoben wissen wollten, zumal sie von offi-
cieller Seite wirklich begründet anerkannt wurden, aber nur um
einige Tage später die Erklärung folgen zu lassen, daß nunmehr die
entgegenstehenden Hindernisse beseitigt seien und die Ausstellung wirk-
lich stattfinden werde.
Inzwischen hörte man in den lang verödeten Hallen des Glas-
palastes hofsnungerweckendes Gehämmer und vor dem Mauthgebäude,
gegenüber der antiquirten Jesuitenkirche wurden schwere, große Kisten
abgeladen, welche an die Ausstellung adressirt waren. Durch die
aufopferndsten Anstrengungen, denen sich die Mitglieder des Aus-
stellungs-Comite's mit wahrhaftem Heroismus unterzogen, war es
möglich geworden, die feierliche Eröffnung am 20. Juli stattfinden
zu lassen.
Wie bei allen ähnlichen Gelegenheiten vertrat auch diesmal
S. K. H. Prinz Adalbert seinen erlauchten Neffen, und wenn man
schwergestickte diplomatische Fräcke und unendliche Seidenschleppen der
Damen für etwas Feierliches hält, so läßt sich nicht leugnen, daß
der Titel: „Feierliche Eröffnung" ganz passend gewählt war, und
wie der Künstler sonst nur mit der friedlichen Waffe des Pinsels
das Schlachtfeld des Kriegers besucht, so hatten sich hier auf seinem
Kampfplatz die Krieger aus Frankreich, Italien, Nord- und Süd-
Deutschland in friedlicher Galla-Uniform eingefunden. Reden wur-
den gehalten, welche zum größten Theil nur von den Umstehenden
verstanden werden konnten. Unter diesen Reden scheint, soviel aus
den Berichten der Tagespresse hervorging, die des Prof, und Vor-
standes der Künstlergenoffenschaft, des um die Ausstellung so hoch-
verdienten Meisters Knoll die inhaltreichste gewesen zu sein. Na-
mentlich dürfte seine Aufforderung, daß nicht nur die Fürsten, sondern
auch die Bürgerschaft der Kunst Schutz und Gunst zuwenden möge,
eine wohl zu beherzigende sein. Ein von Maler Stieler gedichteter,
von dem akademischen und dem Künstlergesangvereine vorgetragener
Festchor bildete den weihevollsten Akt und Schluß der im Uebrigen
ziemlich nüchternen Feier.
Werfen wir nun zunächst einen Blick aus den der Ausstellung
gewidmeten nördlichen Flügel und den Mittelpavillon des Glas-
Palastes, so erkennen wir sofort, daß das leitende Künstler-Comite,
an deren Spitze die Herrrn Prof. Schleich, Knoll und E. Lange
stehen, sein Wort, nichts zu unterlassen, um die Ausstellung zu einer
ihrer Bedeutung würdigen zu machen, im weitesten Sinne gelöst hat.
Denn in der That, das Bestreben, eine geschickte Anordnung der
Ausstellungs-Gegenstände und — soweit dies überhaupt bei einem
überall Licht durchlassenden Glashause möglich war — passende Be-
leuchtung derselben zu erzielen, sowie endlich die Rücksicht auf Be-
quemlichkeit, selbst bis zu einem gewissen Grade des Comforts, treten
überall sichtlich hervor und verleihen der Ausstellung als solcher einen
würdigen und selbst großartigen Charakter. Nur die hohen Eintritts-
Preise sind vielleicht nicht ganz im Interesse der Ausstellung. Doch
ist dies eine Frage, deren ökonomische Bedeutung eine nähere Er-
örterung an dieser Stelle ausschließt. Ein großer und mehrere kleine
Springbrunnen und Wasserbassins kühlen den Raum so, daß, wäh-
rend sonst der Glaspalast im Sommer ein so unangenehmer Auf-
enthalt war wie ein Treibhaus, man jetzt in ihm vor der glühen-
den Juli- und Augustsonne Schutz finden konnte.
Man hat den Raum durch Bretterverschläge in der Mitte des
Langhauses in drei Säle getheilt, an deren Außenwänden sich durch
die Eisensäulen der Gallerten rechts und links je sieben Logen von
selbst ergeben, die wieder durch spanische Wände von einander und
von den Kabinetten getrennt sind, welche letztere den architektonischen
Entwürfen (südliche Langwand) und den Zeichnungen und Aquarellen,
Kupferstichen u. s. f. reservirt sind. Während der Mittelpavillon
den Cartons und den großen historischen Gemälden des k. Mapi-
milianeums gehört, dienen Säle und Logen ausschließlich der Oel-
malerei, und der westliche Endpavillon hat die äußerst zahlreichen
Schätze der Plastik in sich ausgenommen und dadurch diesen Werken,
gewiß in anerkennenswerther Weise, ihre Selbstständigkeit gewahrt,
während sie bei andern Ausstellungen nur als Dekorationsmittel ver-
wendet wurden. Allerdings hat man von einigen (25 unter 371 Nrn.)
einen ähnlichen Gebrauch gemacht, aber einerseits entschuldigt dies
der Standort um den Brunnen, anderntheils vertragen sich die farb-
losen Zeichnungen leichter mit dem Studium plastischer Werke, als
wenn diese vom Prunk der Farbe umgeben sind, welcher das Auge
zu leicht ablenkt.
Wie natürlich wenden wir uns zunächst der Oelmalerei zu, als
der dominirenden unter den Künsten. Nach Ländern ordnen sich die
eingesandten Werke wie folgt: Zuerst kommt selbstverständlich Mün-
chen mit vorläufig 356 Nummern, ihm folgt Frankreich, das ohne
die soeben angekommenen im provisorischen Katalog 287 zählt, so-
dann Oesterreich mit 181, Berlin und Norddeutschland (nach geogr.
Begriff und mit Ausschluß von Düsseldorf) mit 150, Belgien und
Holland mit 144, Mittel- und Süddeutschland (ohne München und
Oesterreich) mit 115, Italien mit 65 und Düsseldorf mit 61 Nrn.
Die übrigen 50 im (provisorischen) Katalog ausgesührten Werke ver-
theilen sich auf England, Rußland, Schweden, Spanien und Amerika.
Man ersieht daraus, daß — von München abgesehen — Frankreich
den Gedanken einer derartigen Ausstellung am lebhaftesten aufgegriffen
hat. Die Künstler jenseits der Mainlinie, insbesondere Berlins, haben
sich die Sache sehr bequem gemacht, indem sie zum großen Theile
Werke geschickt haben, welche in diesen Blättern bereits bei Gelegen-
Die internationale Jurist-Ausstellung Zu Münclmi.
Einleitung.
jj^ ach dem Siege der Münchener Kunst auf der Weitaus-
st^ung in Paris lag wohl kein Gedanke näher, als die
Arena für die gesammten Künstler diesmal in München
selbst zu öffnen und den Palast, der vor 15 Jahren
^^|||) den Werken deutscher Industrie zur Ausstellung diente,
^ denen der Kunst ohne Rücksicht auf ihren Entstehungs-
Ort einzuräumen. So freudig diese Nachricht auch außerhalb un-
serer Stadt ausgenommen wurde, so sehr erschrak man, als dunkle
Gerüchte wegen einer noch dunkleren Ursache die ausgeschriebene Aus-
stellung ans ein Jahr verschoben wissen wollten, zumal sie von offi-
cieller Seite wirklich begründet anerkannt wurden, aber nur um
einige Tage später die Erklärung folgen zu lassen, daß nunmehr die
entgegenstehenden Hindernisse beseitigt seien und die Ausstellung wirk-
lich stattfinden werde.
Inzwischen hörte man in den lang verödeten Hallen des Glas-
palastes hofsnungerweckendes Gehämmer und vor dem Mauthgebäude,
gegenüber der antiquirten Jesuitenkirche wurden schwere, große Kisten
abgeladen, welche an die Ausstellung adressirt waren. Durch die
aufopferndsten Anstrengungen, denen sich die Mitglieder des Aus-
stellungs-Comite's mit wahrhaftem Heroismus unterzogen, war es
möglich geworden, die feierliche Eröffnung am 20. Juli stattfinden
zu lassen.
Wie bei allen ähnlichen Gelegenheiten vertrat auch diesmal
S. K. H. Prinz Adalbert seinen erlauchten Neffen, und wenn man
schwergestickte diplomatische Fräcke und unendliche Seidenschleppen der
Damen für etwas Feierliches hält, so läßt sich nicht leugnen, daß
der Titel: „Feierliche Eröffnung" ganz passend gewählt war, und
wie der Künstler sonst nur mit der friedlichen Waffe des Pinsels
das Schlachtfeld des Kriegers besucht, so hatten sich hier auf seinem
Kampfplatz die Krieger aus Frankreich, Italien, Nord- und Süd-
Deutschland in friedlicher Galla-Uniform eingefunden. Reden wur-
den gehalten, welche zum größten Theil nur von den Umstehenden
verstanden werden konnten. Unter diesen Reden scheint, soviel aus
den Berichten der Tagespresse hervorging, die des Prof, und Vor-
standes der Künstlergenoffenschaft, des um die Ausstellung so hoch-
verdienten Meisters Knoll die inhaltreichste gewesen zu sein. Na-
mentlich dürfte seine Aufforderung, daß nicht nur die Fürsten, sondern
auch die Bürgerschaft der Kunst Schutz und Gunst zuwenden möge,
eine wohl zu beherzigende sein. Ein von Maler Stieler gedichteter,
von dem akademischen und dem Künstlergesangvereine vorgetragener
Festchor bildete den weihevollsten Akt und Schluß der im Uebrigen
ziemlich nüchternen Feier.
Werfen wir nun zunächst einen Blick aus den der Ausstellung
gewidmeten nördlichen Flügel und den Mittelpavillon des Glas-
Palastes, so erkennen wir sofort, daß das leitende Künstler-Comite,
an deren Spitze die Herrrn Prof. Schleich, Knoll und E. Lange
stehen, sein Wort, nichts zu unterlassen, um die Ausstellung zu einer
ihrer Bedeutung würdigen zu machen, im weitesten Sinne gelöst hat.
Denn in der That, das Bestreben, eine geschickte Anordnung der
Ausstellungs-Gegenstände und — soweit dies überhaupt bei einem
überall Licht durchlassenden Glashause möglich war — passende Be-
leuchtung derselben zu erzielen, sowie endlich die Rücksicht auf Be-
quemlichkeit, selbst bis zu einem gewissen Grade des Comforts, treten
überall sichtlich hervor und verleihen der Ausstellung als solcher einen
würdigen und selbst großartigen Charakter. Nur die hohen Eintritts-
Preise sind vielleicht nicht ganz im Interesse der Ausstellung. Doch
ist dies eine Frage, deren ökonomische Bedeutung eine nähere Er-
örterung an dieser Stelle ausschließt. Ein großer und mehrere kleine
Springbrunnen und Wasserbassins kühlen den Raum so, daß, wäh-
rend sonst der Glaspalast im Sommer ein so unangenehmer Auf-
enthalt war wie ein Treibhaus, man jetzt in ihm vor der glühen-
den Juli- und Augustsonne Schutz finden konnte.
Man hat den Raum durch Bretterverschläge in der Mitte des
Langhauses in drei Säle getheilt, an deren Außenwänden sich durch
die Eisensäulen der Gallerten rechts und links je sieben Logen von
selbst ergeben, die wieder durch spanische Wände von einander und
von den Kabinetten getrennt sind, welche letztere den architektonischen
Entwürfen (südliche Langwand) und den Zeichnungen und Aquarellen,
Kupferstichen u. s. f. reservirt sind. Während der Mittelpavillon
den Cartons und den großen historischen Gemälden des k. Mapi-
milianeums gehört, dienen Säle und Logen ausschließlich der Oel-
malerei, und der westliche Endpavillon hat die äußerst zahlreichen
Schätze der Plastik in sich ausgenommen und dadurch diesen Werken,
gewiß in anerkennenswerther Weise, ihre Selbstständigkeit gewahrt,
während sie bei andern Ausstellungen nur als Dekorationsmittel ver-
wendet wurden. Allerdings hat man von einigen (25 unter 371 Nrn.)
einen ähnlichen Gebrauch gemacht, aber einerseits entschuldigt dies
der Standort um den Brunnen, anderntheils vertragen sich die farb-
losen Zeichnungen leichter mit dem Studium plastischer Werke, als
wenn diese vom Prunk der Farbe umgeben sind, welcher das Auge
zu leicht ablenkt.
Wie natürlich wenden wir uns zunächst der Oelmalerei zu, als
der dominirenden unter den Künsten. Nach Ländern ordnen sich die
eingesandten Werke wie folgt: Zuerst kommt selbstverständlich Mün-
chen mit vorläufig 356 Nummern, ihm folgt Frankreich, das ohne
die soeben angekommenen im provisorischen Katalog 287 zählt, so-
dann Oesterreich mit 181, Berlin und Norddeutschland (nach geogr.
Begriff und mit Ausschluß von Düsseldorf) mit 150, Belgien und
Holland mit 144, Mittel- und Süddeutschland (ohne München und
Oesterreich) mit 115, Italien mit 65 und Düsseldorf mit 61 Nrn.
Die übrigen 50 im (provisorischen) Katalog ausgesührten Werke ver-
theilen sich auf England, Rußland, Schweden, Spanien und Amerika.
Man ersieht daraus, daß — von München abgesehen — Frankreich
den Gedanken einer derartigen Ausstellung am lebhaftesten aufgegriffen
hat. Die Künstler jenseits der Mainlinie, insbesondere Berlins, haben
sich die Sache sehr bequem gemacht, indem sie zum großen Theile
Werke geschickt haben, welche in diesen Blättern bereits bei Gelegen-