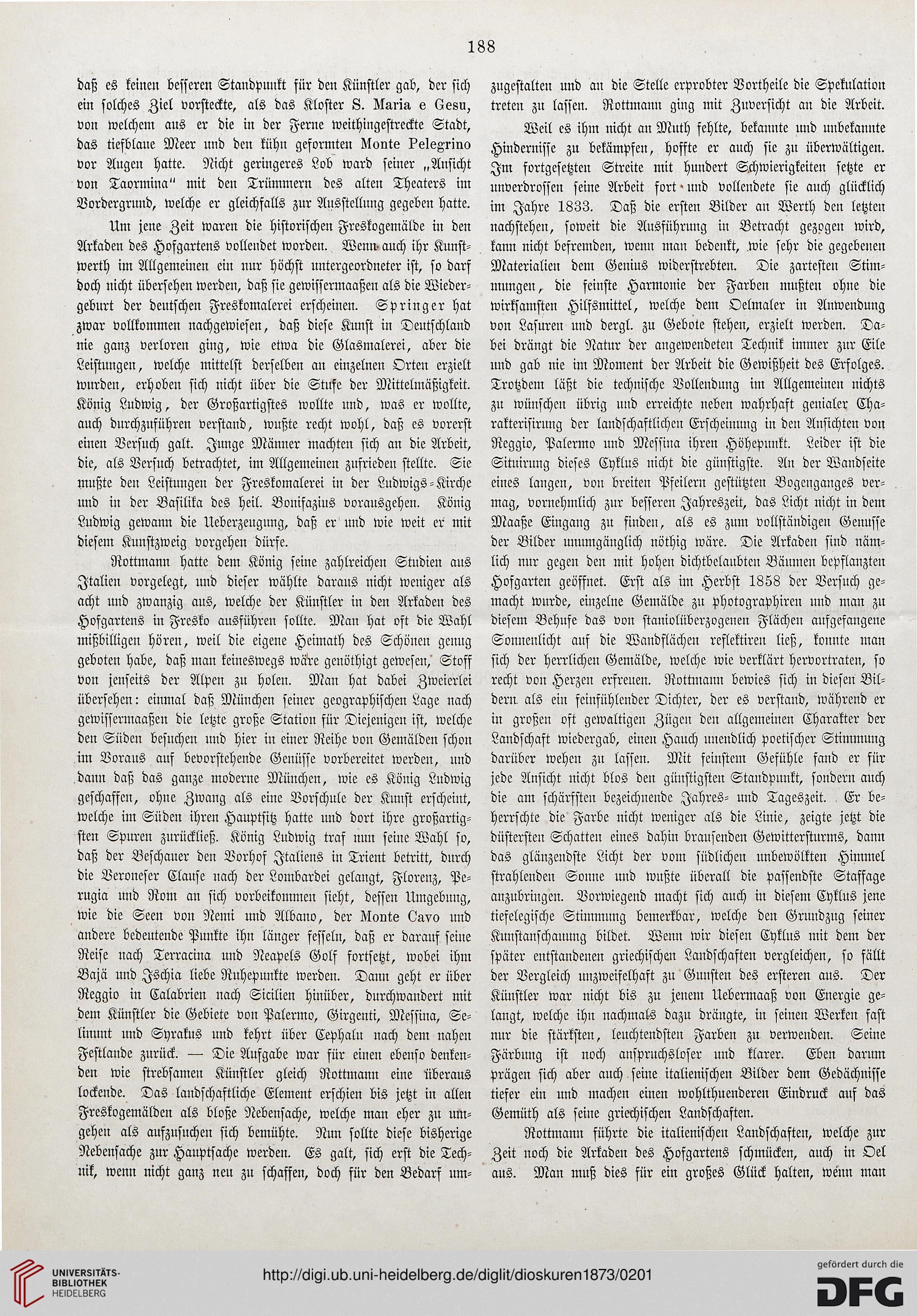188
daß es keinen besseren Standpunkt für den Künstler gab, der sich
ein solches Ziel versteckte, als das Kloster 8. Maria, e Gesu,
von welchem aus er die in der Ferne weithingestreckte Stadt,
das tiefblaue Meer und den kühn geformten Monte Pelegrino
vor Augen hatte. Nicht geringeres Lob ward seiner „Ansicht
von Taormina" mit den Trümmern des alten Theaters im
Vordergrund, welche er gleichfalls zur Ausstellung gegeben hatte.
Um jene Zeit waren die historischen Freskogemälde in den
Arkaden des Hofgartens vollendet worden. Wenn- auch ihr Kunst-
werth im Allgemeinen ein nur höchst untergeordneter ist, so darf
doch nicht übersehen werden, daß sie gewissermaaßen als die Wieder-
geburt der deutschen Freskomalerei erscheinen. Springer hat
zwar vollkommen nachgewiesen, daß diese Kunst in Deutschland
nie ganz verloren ging, wie etwa die Glasmalerei, aber die
Leistungen, welche mittelst derselben an einzelnen Orten erzielt
wurden, erhoben sich nicht über die Stufe der Mittelmäßigkeit.
König Ludwig, der Großartigstes wollte und, was er wollte,
auch durchzuführcn verstand, wußte recht wohl, daß es vorerst
einen Versuch galt. Junge Männer machten sich an die Arbeit,
die, als Versuch betrachtet, im Allgemeinen zufrieden stellte. Sie
mußte den Leistungen der Freskomalerei in der Ludwigs-Kirche
und in der Basilika des heil. Bonifazius vorausgehen. König
Ludwig gewann die Ueberzeugung, daß er und wie weit er mit
diesem Kunstzweig Vorgehen dürfe.
Rottmann hatte dem König seine zahlreichen Studien aus
Italien vorgelegt, und dieser wählte daraus nicht weniger als
acht und zwanzig aus, welche der Künstler in den Arkaden des
Hofgartens in Fresko ausführen sollte. Man hat oft die Wahl
mißbilligen hören, weil die eigene Heimath des Schönen genug
geboten habe, daß man keineswegs wäre genöthigt gewesen/ Stoff
von jenseits der Alpen zu holen. Man hat dabei Zweierlei
übersehen: einmal daß München seiner geographischen Lage nach
gewissermaaßen die letzte große Station für Diejenigen ist, welche
den Süden besuchen und hier in einer Reihe von Gemälden schon
im Voraus auf bevorstehende Genüsse vorbereitet werden, und
dann daß das ganze moderne München, wie es König Ludwig
geschaffen, ohne Zwang als eine Vorschule der Kunst erscheint,
welche im Süden ihren Hauptsitz hatte und dort ihre großartig-
sten Spuren zurückließ. König Ludwig traf nun seine Wahl so,
daß der Beschauer den Vorhof Italiens in Trient betritt, durch
die Veroneser Clause nach der Lombardei gelangt, Florenz, Pe-
rugia und Rom an sich vorbeikommen sieht, dessen Umgebung,
wie die Seen von Nenn und Albano, der Monte Cavo und
andere bedeutende Punkte ihn länger fesseln, daß er darauf seine
Reise nach Terracina und Neapels Golf fortsetzt, wobei ihm
Bajä und Jschia liebe Rnhepnnkte werden. Dann geht er über
Reggio in Calabrien nach Sicilien hinüber, durchwandert mit
dem Künstler die Gebiete von Palermo, Girgenti, Messina, Se-
linunt und Syrakus und kehrt über Cephalu nach dem nahen
Festlande zurück. — Die Aufgabe war für einen ebenso denken-
den wie strebsamen Künstler gleich Rottmann eine überaus
lockende. Das landschaftliche Element erschien bis jetzt in allen
Freskogemälden als bloße Nebensache, welche man eher zu um-
gehen als aufzusuchen sich bemühte. Nun sollte diese bisherige
Nebensache zur Hauptsache werden. Es galt, sich erst die Tech-
nik, wenn nicht ganz neu zu schassen, doch für den Bedarf um-
zngestaltcn und an die Stelle erprobter Vortheile die Spekulation
treten zu lassen. Rottmann ging mit Zuversicht an die Arbeit.
Weil es ihm nicht an Mnth fehlte, bekannte und unbekannte
Hindernisse zu bekämpfen, hoffte er auch sic zu überwältigen.
Im fortgesetzten Streite mit hundert Schwierigkeiten setzte er
unverdrossen seine Arbeit fort - und vollendete sie auch glücklich
im Jahre 1833. Daß die ersten Bilder an Werth den letzten
nachstehen, soweit die Ausführung in Betracht gezogen wird,
kann nicht befremden, wenn man bedenkt, wie sehr die gegebenen
Materialien dem Genius widerstrebten. Die zartesten Stim-
mungen,^ die feinste Harmonie der Farben mußten ohne die
wirksamsten Hilfsmittel, welche dem Oelmaler in Anwendung
von Lasuren und dergl. zu Gebote stehen, erzielt werden. Da-
bei drängt die Natur der angewendeten Technik immer zur Eile
und gab nie im Moment der Arbeit die Gewißheit des Erfolges.
Trotzdem läßt die technische Vollendung im Allgemeinen nichts
zu wünschen übrig und erreichte neben wahrhaft genialer Cha-
rakterisirung der landschaftlichen Erscheinung in den Ansichten von
Reggio, Palermo und Messina ihren Höhepunkt. Leider ist die
Situirnng dieses Cyklus nicht die günstigste. An der Wandseite
eines langen, von breiten Pfeilern gestützten Bogenganges ver-
mag, vornehmlich zur besseren Jahreszeit, das Licht nicht in dem
Maaße Eingang zu finden, als es zum vollständigen Genüsse
der Bilder unumgänglich nöthig wäre. Die Arkaden sind näin-
lich nur gegen den mit hohen dichtbelaubten Bäumen bepflanzten
Hofgarten geöffnet. Erst als im Herbst 1858 der Versuch ge-
macht wurde, einzelne Gemälde zu photographiren und man zu
diesem Behuse das von staniolüberzogenen Flächen ausgefangene
Sonnenlicht auf die Wandflächen reflektiren ließ, konnte man
sich der herrlichen Gemälde, welche wie verklärt hervortraten, so
recht von Herzen erfreuen. Rotllnann bewies sich in diesen Bil-
dern als ein feinfühlender Dichter, der es verstand, während er
in großen oft gewaltigen Zügen den allgemeinen Charakter der
Landschaft wiedergab, einen Hauch unendlich poetischer Stimmung
darüber wehen zu lassen. Mit feinstem Gefühle fand er für
jede Ansicht nicht blos den günstigsten Standpunkt, sondern auch
die am schärfsten bezeichnende Jahres- und Tageszeit. . Er be-
herrschte die Farbe nicht weniger als die Linie, zeigte jetzt die
düstersten Schatten eines dahin brausenden Gewittersturms, dann
das glänzendste Licht der vom südlichen unbewölkten Himmel
strahlenden Sonne und wußte überall die passendste Staffage
anzubringen. Vorwiegend macht sich auch in diesem Cyklus jene
tiefelegische Stimmung bemerkbar, welche den Grundzng seiner
Kunstanschauung bildet. Wenn wir diesen Cyklus mit dem der
später entstandenen griechischen Landschaften vergleichen, so fällt
der Vergleich unzweifelhaft zu Gunsten des ersteren aus. Der
Künstler war nicht bis zu jenem Uebermaaß von Energie ge-
langt, welche ihn nachmals dazu drängte, in seinen Werken fast
nur die stärksten, leuchtendsten Farben zu verwenden. Seine
Färbung ist noch anspruchsloser und klarer. Eben darum
prägen sich aber auch seine italienischen Bilder dem Gedächnisse
tiefer ein und machen einen wohlthuenderen Eindruck auf das
Gemüth als seine griechischen Landschaften.
Rottmann führte die italienischen Landschaften, welche zur
Zeit noch die Arkaden des Hofgartens schmücken, auch in Oel
aus. Man muß dies für ein großes Glück halten, wenn man
daß es keinen besseren Standpunkt für den Künstler gab, der sich
ein solches Ziel versteckte, als das Kloster 8. Maria, e Gesu,
von welchem aus er die in der Ferne weithingestreckte Stadt,
das tiefblaue Meer und den kühn geformten Monte Pelegrino
vor Augen hatte. Nicht geringeres Lob ward seiner „Ansicht
von Taormina" mit den Trümmern des alten Theaters im
Vordergrund, welche er gleichfalls zur Ausstellung gegeben hatte.
Um jene Zeit waren die historischen Freskogemälde in den
Arkaden des Hofgartens vollendet worden. Wenn- auch ihr Kunst-
werth im Allgemeinen ein nur höchst untergeordneter ist, so darf
doch nicht übersehen werden, daß sie gewissermaaßen als die Wieder-
geburt der deutschen Freskomalerei erscheinen. Springer hat
zwar vollkommen nachgewiesen, daß diese Kunst in Deutschland
nie ganz verloren ging, wie etwa die Glasmalerei, aber die
Leistungen, welche mittelst derselben an einzelnen Orten erzielt
wurden, erhoben sich nicht über die Stufe der Mittelmäßigkeit.
König Ludwig, der Großartigstes wollte und, was er wollte,
auch durchzuführcn verstand, wußte recht wohl, daß es vorerst
einen Versuch galt. Junge Männer machten sich an die Arbeit,
die, als Versuch betrachtet, im Allgemeinen zufrieden stellte. Sie
mußte den Leistungen der Freskomalerei in der Ludwigs-Kirche
und in der Basilika des heil. Bonifazius vorausgehen. König
Ludwig gewann die Ueberzeugung, daß er und wie weit er mit
diesem Kunstzweig Vorgehen dürfe.
Rottmann hatte dem König seine zahlreichen Studien aus
Italien vorgelegt, und dieser wählte daraus nicht weniger als
acht und zwanzig aus, welche der Künstler in den Arkaden des
Hofgartens in Fresko ausführen sollte. Man hat oft die Wahl
mißbilligen hören, weil die eigene Heimath des Schönen genug
geboten habe, daß man keineswegs wäre genöthigt gewesen/ Stoff
von jenseits der Alpen zu holen. Man hat dabei Zweierlei
übersehen: einmal daß München seiner geographischen Lage nach
gewissermaaßen die letzte große Station für Diejenigen ist, welche
den Süden besuchen und hier in einer Reihe von Gemälden schon
im Voraus auf bevorstehende Genüsse vorbereitet werden, und
dann daß das ganze moderne München, wie es König Ludwig
geschaffen, ohne Zwang als eine Vorschule der Kunst erscheint,
welche im Süden ihren Hauptsitz hatte und dort ihre großartig-
sten Spuren zurückließ. König Ludwig traf nun seine Wahl so,
daß der Beschauer den Vorhof Italiens in Trient betritt, durch
die Veroneser Clause nach der Lombardei gelangt, Florenz, Pe-
rugia und Rom an sich vorbeikommen sieht, dessen Umgebung,
wie die Seen von Nenn und Albano, der Monte Cavo und
andere bedeutende Punkte ihn länger fesseln, daß er darauf seine
Reise nach Terracina und Neapels Golf fortsetzt, wobei ihm
Bajä und Jschia liebe Rnhepnnkte werden. Dann geht er über
Reggio in Calabrien nach Sicilien hinüber, durchwandert mit
dem Künstler die Gebiete von Palermo, Girgenti, Messina, Se-
linunt und Syrakus und kehrt über Cephalu nach dem nahen
Festlande zurück. — Die Aufgabe war für einen ebenso denken-
den wie strebsamen Künstler gleich Rottmann eine überaus
lockende. Das landschaftliche Element erschien bis jetzt in allen
Freskogemälden als bloße Nebensache, welche man eher zu um-
gehen als aufzusuchen sich bemühte. Nun sollte diese bisherige
Nebensache zur Hauptsache werden. Es galt, sich erst die Tech-
nik, wenn nicht ganz neu zu schassen, doch für den Bedarf um-
zngestaltcn und an die Stelle erprobter Vortheile die Spekulation
treten zu lassen. Rottmann ging mit Zuversicht an die Arbeit.
Weil es ihm nicht an Mnth fehlte, bekannte und unbekannte
Hindernisse zu bekämpfen, hoffte er auch sic zu überwältigen.
Im fortgesetzten Streite mit hundert Schwierigkeiten setzte er
unverdrossen seine Arbeit fort - und vollendete sie auch glücklich
im Jahre 1833. Daß die ersten Bilder an Werth den letzten
nachstehen, soweit die Ausführung in Betracht gezogen wird,
kann nicht befremden, wenn man bedenkt, wie sehr die gegebenen
Materialien dem Genius widerstrebten. Die zartesten Stim-
mungen,^ die feinste Harmonie der Farben mußten ohne die
wirksamsten Hilfsmittel, welche dem Oelmaler in Anwendung
von Lasuren und dergl. zu Gebote stehen, erzielt werden. Da-
bei drängt die Natur der angewendeten Technik immer zur Eile
und gab nie im Moment der Arbeit die Gewißheit des Erfolges.
Trotzdem läßt die technische Vollendung im Allgemeinen nichts
zu wünschen übrig und erreichte neben wahrhaft genialer Cha-
rakterisirung der landschaftlichen Erscheinung in den Ansichten von
Reggio, Palermo und Messina ihren Höhepunkt. Leider ist die
Situirnng dieses Cyklus nicht die günstigste. An der Wandseite
eines langen, von breiten Pfeilern gestützten Bogenganges ver-
mag, vornehmlich zur besseren Jahreszeit, das Licht nicht in dem
Maaße Eingang zu finden, als es zum vollständigen Genüsse
der Bilder unumgänglich nöthig wäre. Die Arkaden sind näin-
lich nur gegen den mit hohen dichtbelaubten Bäumen bepflanzten
Hofgarten geöffnet. Erst als im Herbst 1858 der Versuch ge-
macht wurde, einzelne Gemälde zu photographiren und man zu
diesem Behuse das von staniolüberzogenen Flächen ausgefangene
Sonnenlicht auf die Wandflächen reflektiren ließ, konnte man
sich der herrlichen Gemälde, welche wie verklärt hervortraten, so
recht von Herzen erfreuen. Rotllnann bewies sich in diesen Bil-
dern als ein feinfühlender Dichter, der es verstand, während er
in großen oft gewaltigen Zügen den allgemeinen Charakter der
Landschaft wiedergab, einen Hauch unendlich poetischer Stimmung
darüber wehen zu lassen. Mit feinstem Gefühle fand er für
jede Ansicht nicht blos den günstigsten Standpunkt, sondern auch
die am schärfsten bezeichnende Jahres- und Tageszeit. . Er be-
herrschte die Farbe nicht weniger als die Linie, zeigte jetzt die
düstersten Schatten eines dahin brausenden Gewittersturms, dann
das glänzendste Licht der vom südlichen unbewölkten Himmel
strahlenden Sonne und wußte überall die passendste Staffage
anzubringen. Vorwiegend macht sich auch in diesem Cyklus jene
tiefelegische Stimmung bemerkbar, welche den Grundzng seiner
Kunstanschauung bildet. Wenn wir diesen Cyklus mit dem der
später entstandenen griechischen Landschaften vergleichen, so fällt
der Vergleich unzweifelhaft zu Gunsten des ersteren aus. Der
Künstler war nicht bis zu jenem Uebermaaß von Energie ge-
langt, welche ihn nachmals dazu drängte, in seinen Werken fast
nur die stärksten, leuchtendsten Farben zu verwenden. Seine
Färbung ist noch anspruchsloser und klarer. Eben darum
prägen sich aber auch seine italienischen Bilder dem Gedächnisse
tiefer ein und machen einen wohlthuenderen Eindruck auf das
Gemüth als seine griechischen Landschaften.
Rottmann führte die italienischen Landschaften, welche zur
Zeit noch die Arkaden des Hofgartens schmücken, auch in Oel
aus. Man muß dies für ein großes Glück halten, wenn man