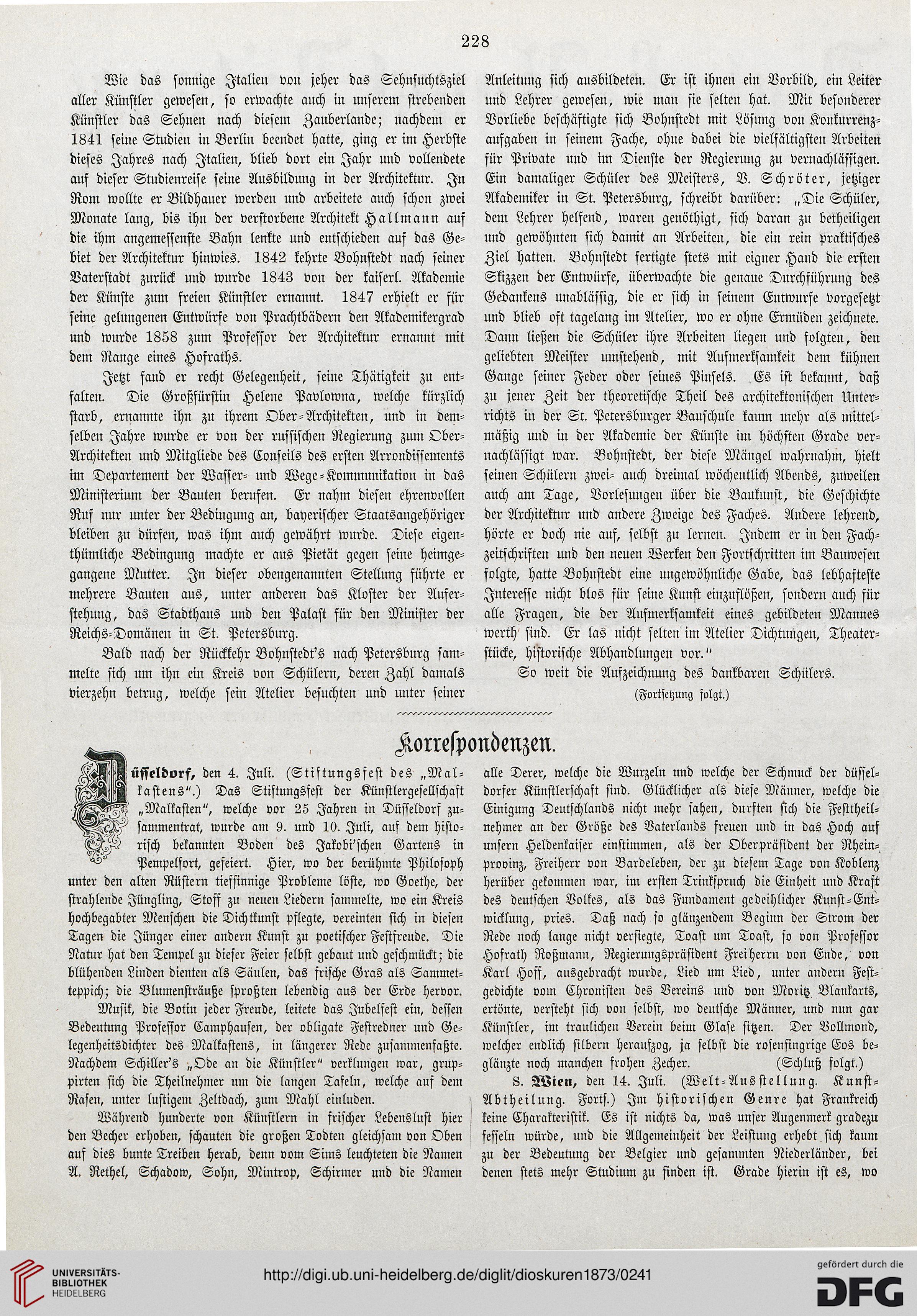228
Wie das sonnige Italien von jeher das Sehnsnchtszicl
aller Künstler gewesen, so erwachte auch in unserem strebenden
Künstler das Sehnen nach diesem Zanberlande; nachdem er
1841 seine Studien in Berlin beendet hatte, ging er im Herbste
dieses Jahres nach Italien, blieb dort ein Jahr und vollendete
auf dieser Studienreise seine Ausbildung in der Architektur. In
Rom wollte er Bildhauer werden und arbeitete auch schon zwei
Monate lang, bis ihn der verstorbene Architekt Hallmann auf
die ihm angemessenste Bahn lenkte und entschieden auf das Ge-
biet der Architektur hinwies. 1842 kehrte Bohnstedt nach seiner
Vaterstadt zuriick und wurde 1843 von der kaiserl. Akademie
der Künste zum freien Künstler ernannt. 1847 erhielt er für
seine gelungenen Entwiirfe von Prachtbädern den Akademikergrad
und wurde 1858 zum Professor der Architektur ernannt mit
dem Range eines Hofraths.
Jetzt fand er recht Gelegenheit, seine Thätigkeit zu ent-
falten. Die Großfürstin Helene Pavlowna, welche kürzlich
starb, ernannte ihn zu ihrem Ober-Architekten, und in dem-
selben Jahre wurde er von der russischen Regierung zum Ober-
Architekten und Mitgliede des Conseils des ersten Arrondissements
im Departement der Wasser- und Wege - Kommunikation in das
Ministerium der Bauten berufen. Er nahm diesen ehrenvollen
Ruf nur unter der Bedingung an, bayerischer Staatsangehöriger
bleiben zu dürfen, was ihm auch gewährt wurde. Diese eigen-
thüinliche Bedingung machte er aus Pietät gegen seine Heimge-
gangene Mutter. In dieser obengenannten Stellung führte er
mehrere Bauten aus, unter anderen das Kloster der Aufer-
stehung, das Stadthaus und den Palast für den Minister der
Reichs-Domänen in St. Petersburg.
Bald nach der Rückkehr Bohnstedt's nach Petersburg sam-
melte sich um ihn ein Kreis von Schülern, deren Zahl damals
vierzehn betrug, welche sein Atelier besuchten und unter seiner
Anleitung sich ausbildeten. Er ist ihnen ein Vorbild, ein Leiter
und Lehrer gewesen, wie man sie selten hat. Mit besonderer
Vorliebe beschäftigte sich Bohnstedt mit Lösung von Konkurrenz-
aufgaben in seinen: Fache, ohne dabei die vielfältigsten Arbeiten
für Private und im Dienste der Regierung zu vernachlässigen.
Ein damaliger Schüler des Meisters, V. Schröter, jetziger
Akademiker in St. Petersburg, schreibt darüber: „Die Schüler,
dem Lehrer helfend, waren genöthigt, sich daran zu betheiligen
und gewöhnten sich damit an Arbeiten, die ein rein praktisches
Ziel hatten. Bohnstedt fertigte stets mit eigner Hand die ersten
Skizzen der Entwürfe, überwachte die genaue Durchführung des
Gedankens unablässig, die er sich in seinem Entwürfe vorgesetzt
und blieb oft tagelang im Atelier, wo er ohne Ermüden zeichnete.
Dann ließen die Schüler ihre Arbeiten liegen und folgten, den
geliebten Meister umstehend, mit Aufmerksamkeit dem kühnen
Gange seiner Feder oder seines Pinsels. Es ist bekannt, daß
zu jener Zeit der theoretische Theil des architektonischen Unter-
richts in der St. Petersburger Bauschule kaum mehr als mittel-
mäßig und in der Akademie der Künste in: höchsten Grade ver-
nachlässigt war. Bohnstedt, der diese Mängel wahrnahm, hielt
seinen Schülern zwei- auch dreimal wöchentlich Abends, zuweilen
auch am Tage, Vorlesungen über die Baukunst, die Geschichte
der Architektur und andere Zweige des Faches. Andere lehrend,
hörte er doch nie auf, selbst zu lernen. Indem er in den Fach-
zeitschriften und den neuen Werken den Fortschritten im Bauwesen
solgte, hatte Bohnstedt eine ungewöhnliche Gabe, das lebhafteste
Interesse nicht blos für seine Kunst einzuflößen, sondern auch für
alle Fragen, die der Aufmerksamkeit eines gebildeten Mannes
wertst sind. Er las nicht selten im Atelier Dichtungen, Theater-
stücke, historische Abhandlungen vor."
So weit die Aufzeichnung des dankbaren Schülers.
(Fortsetzung folgt.)
Korrespondenzen.
üfseldorf, den 4. Juli. (Stiftungsfest des „Mal-
kastens".) Das Stiftungsfest der Künstlergesellschaft
„Malkasten", welche vor 25 Jahren in Düsseldorf zu-
sammentrat, wurde am 9. und 10. Juli, auf dem histo-
risch bekannten Boden des Jakobi'schen Gartens in
Pempelfort, gefeiert. Hier, wo der berühmte Philosoph
unter den alten Rüstern tiefsinnige Probleme löste, wo Goethe, der
strahlende Jüngling, Stoff zu neuen Liedern sammelte, wo ein Kreis
hochbegabter Menschen die Dichtkunst pflegte, vereinten sich in diesen
Tagen die Jünger einer andern Kunst zu poetischer Festfreude. Die
Natur hat den Tempel zu dieser Feier selbst gebaut und geschmückt; die
blühenden Linden dienten als Säulen, das frische Gras als Sammet-
teppich; die Blumensträuße sproßten lebendig aus der Erde hervor.
Musik, die Botin jeder Freude, leitete das Jubelfest ein, dessen
Bedeutung Professor Camphausen, der obligate Festredner und Ge-
legenheitsdichter des Malkastens, in längerer Rede zusammenfaßte.
Nachdem Schiller's „Ode an die Künstler" verklungen war, grup-
pirten sich die Theilnehmer um die langen Tafeln, welche auf dem
Rasen, unter lustigem Zeltdach, zum Mahl einluden.
Während Hunderte von Künstlern in frischer Lebenslust hier
den Becher erhoben, schauten die großen Todten gleichsam von Oben
auf dies bunte Treiben herab, denn vom Siins leuchteten die Namen
A. Rethel, Schadow, Sohn, Mintrop, Schirmer und die Namen
alle Derer, welche die Wurzeln und welche der Schmuck der düssel-
dorfer Küustlerschaft sind. Glücklicher als diese Männer, welche die
Einigung Deutschlands nicht mehr sahen, durften sich die Festtheil-
nehmer an der Größe des Vaterlands freuen und in das Hoch auf
unfern Heldenkaiser einstimmen, als der Oberpräsident der Rhein-
Provinz, Freiherr von Bardeleben, der zu diesem Tage von Koblenz
herüber gekommen war, im ersten Triukfpruch die Einheit und Kraft
des deutschen Volkes, als das Fundament gedeihlicher Kunst-Ent-
wicklung, pries. Daß nach so glänzendem Beginn der Strom der
Rede noch lange nicht versiegte, Toast um Toast, so von Professor
Hofrath Roßmann, Regierungspräsident Freiherrn von Ende, von
Karl Hoff, ausgebracht wurde, Lied um Lied, unter andern Fest-
gedichte vom Chronisten des Vereins und von Moritz Blankarts,
ertönte, versteht sich von selbst, wo deutsche Männer, und nun gar
Künstler, in: traulichen Verein beim Glase sitzen. Der Vollmond,
welcher endlich silbern herauszog, ja selbst die rosenfingrige Eos be-
glänzte noch manchen frohen Zecher. (Schluß folgt.)
8. Wien, den 14. Juli. (Welt-Ausstellung. Kunst-
Abtheilung. Forts.) Im historischen Genre hat Frankreich
keine Charakteristik. Es ist nichts da, was unser Augenmerk gradezu
fesseln würde, und die Allgemeinheit der Leistung erhebt sich kaum
zu der Bedeutung der Belgier und gesammten Niederländer, bei
denen stets mehr Studium zu finden ist. Grade hierin ist es, wo
Wie das sonnige Italien von jeher das Sehnsnchtszicl
aller Künstler gewesen, so erwachte auch in unserem strebenden
Künstler das Sehnen nach diesem Zanberlande; nachdem er
1841 seine Studien in Berlin beendet hatte, ging er im Herbste
dieses Jahres nach Italien, blieb dort ein Jahr und vollendete
auf dieser Studienreise seine Ausbildung in der Architektur. In
Rom wollte er Bildhauer werden und arbeitete auch schon zwei
Monate lang, bis ihn der verstorbene Architekt Hallmann auf
die ihm angemessenste Bahn lenkte und entschieden auf das Ge-
biet der Architektur hinwies. 1842 kehrte Bohnstedt nach seiner
Vaterstadt zuriick und wurde 1843 von der kaiserl. Akademie
der Künste zum freien Künstler ernannt. 1847 erhielt er für
seine gelungenen Entwiirfe von Prachtbädern den Akademikergrad
und wurde 1858 zum Professor der Architektur ernannt mit
dem Range eines Hofraths.
Jetzt fand er recht Gelegenheit, seine Thätigkeit zu ent-
falten. Die Großfürstin Helene Pavlowna, welche kürzlich
starb, ernannte ihn zu ihrem Ober-Architekten, und in dem-
selben Jahre wurde er von der russischen Regierung zum Ober-
Architekten und Mitgliede des Conseils des ersten Arrondissements
im Departement der Wasser- und Wege - Kommunikation in das
Ministerium der Bauten berufen. Er nahm diesen ehrenvollen
Ruf nur unter der Bedingung an, bayerischer Staatsangehöriger
bleiben zu dürfen, was ihm auch gewährt wurde. Diese eigen-
thüinliche Bedingung machte er aus Pietät gegen seine Heimge-
gangene Mutter. In dieser obengenannten Stellung führte er
mehrere Bauten aus, unter anderen das Kloster der Aufer-
stehung, das Stadthaus und den Palast für den Minister der
Reichs-Domänen in St. Petersburg.
Bald nach der Rückkehr Bohnstedt's nach Petersburg sam-
melte sich um ihn ein Kreis von Schülern, deren Zahl damals
vierzehn betrug, welche sein Atelier besuchten und unter seiner
Anleitung sich ausbildeten. Er ist ihnen ein Vorbild, ein Leiter
und Lehrer gewesen, wie man sie selten hat. Mit besonderer
Vorliebe beschäftigte sich Bohnstedt mit Lösung von Konkurrenz-
aufgaben in seinen: Fache, ohne dabei die vielfältigsten Arbeiten
für Private und im Dienste der Regierung zu vernachlässigen.
Ein damaliger Schüler des Meisters, V. Schröter, jetziger
Akademiker in St. Petersburg, schreibt darüber: „Die Schüler,
dem Lehrer helfend, waren genöthigt, sich daran zu betheiligen
und gewöhnten sich damit an Arbeiten, die ein rein praktisches
Ziel hatten. Bohnstedt fertigte stets mit eigner Hand die ersten
Skizzen der Entwürfe, überwachte die genaue Durchführung des
Gedankens unablässig, die er sich in seinem Entwürfe vorgesetzt
und blieb oft tagelang im Atelier, wo er ohne Ermüden zeichnete.
Dann ließen die Schüler ihre Arbeiten liegen und folgten, den
geliebten Meister umstehend, mit Aufmerksamkeit dem kühnen
Gange seiner Feder oder seines Pinsels. Es ist bekannt, daß
zu jener Zeit der theoretische Theil des architektonischen Unter-
richts in der St. Petersburger Bauschule kaum mehr als mittel-
mäßig und in der Akademie der Künste in: höchsten Grade ver-
nachlässigt war. Bohnstedt, der diese Mängel wahrnahm, hielt
seinen Schülern zwei- auch dreimal wöchentlich Abends, zuweilen
auch am Tage, Vorlesungen über die Baukunst, die Geschichte
der Architektur und andere Zweige des Faches. Andere lehrend,
hörte er doch nie auf, selbst zu lernen. Indem er in den Fach-
zeitschriften und den neuen Werken den Fortschritten im Bauwesen
solgte, hatte Bohnstedt eine ungewöhnliche Gabe, das lebhafteste
Interesse nicht blos für seine Kunst einzuflößen, sondern auch für
alle Fragen, die der Aufmerksamkeit eines gebildeten Mannes
wertst sind. Er las nicht selten im Atelier Dichtungen, Theater-
stücke, historische Abhandlungen vor."
So weit die Aufzeichnung des dankbaren Schülers.
(Fortsetzung folgt.)
Korrespondenzen.
üfseldorf, den 4. Juli. (Stiftungsfest des „Mal-
kastens".) Das Stiftungsfest der Künstlergesellschaft
„Malkasten", welche vor 25 Jahren in Düsseldorf zu-
sammentrat, wurde am 9. und 10. Juli, auf dem histo-
risch bekannten Boden des Jakobi'schen Gartens in
Pempelfort, gefeiert. Hier, wo der berühmte Philosoph
unter den alten Rüstern tiefsinnige Probleme löste, wo Goethe, der
strahlende Jüngling, Stoff zu neuen Liedern sammelte, wo ein Kreis
hochbegabter Menschen die Dichtkunst pflegte, vereinten sich in diesen
Tagen die Jünger einer andern Kunst zu poetischer Festfreude. Die
Natur hat den Tempel zu dieser Feier selbst gebaut und geschmückt; die
blühenden Linden dienten als Säulen, das frische Gras als Sammet-
teppich; die Blumensträuße sproßten lebendig aus der Erde hervor.
Musik, die Botin jeder Freude, leitete das Jubelfest ein, dessen
Bedeutung Professor Camphausen, der obligate Festredner und Ge-
legenheitsdichter des Malkastens, in längerer Rede zusammenfaßte.
Nachdem Schiller's „Ode an die Künstler" verklungen war, grup-
pirten sich die Theilnehmer um die langen Tafeln, welche auf dem
Rasen, unter lustigem Zeltdach, zum Mahl einluden.
Während Hunderte von Künstlern in frischer Lebenslust hier
den Becher erhoben, schauten die großen Todten gleichsam von Oben
auf dies bunte Treiben herab, denn vom Siins leuchteten die Namen
A. Rethel, Schadow, Sohn, Mintrop, Schirmer und die Namen
alle Derer, welche die Wurzeln und welche der Schmuck der düssel-
dorfer Küustlerschaft sind. Glücklicher als diese Männer, welche die
Einigung Deutschlands nicht mehr sahen, durften sich die Festtheil-
nehmer an der Größe des Vaterlands freuen und in das Hoch auf
unfern Heldenkaiser einstimmen, als der Oberpräsident der Rhein-
Provinz, Freiherr von Bardeleben, der zu diesem Tage von Koblenz
herüber gekommen war, im ersten Triukfpruch die Einheit und Kraft
des deutschen Volkes, als das Fundament gedeihlicher Kunst-Ent-
wicklung, pries. Daß nach so glänzendem Beginn der Strom der
Rede noch lange nicht versiegte, Toast um Toast, so von Professor
Hofrath Roßmann, Regierungspräsident Freiherrn von Ende, von
Karl Hoff, ausgebracht wurde, Lied um Lied, unter andern Fest-
gedichte vom Chronisten des Vereins und von Moritz Blankarts,
ertönte, versteht sich von selbst, wo deutsche Männer, und nun gar
Künstler, in: traulichen Verein beim Glase sitzen. Der Vollmond,
welcher endlich silbern herauszog, ja selbst die rosenfingrige Eos be-
glänzte noch manchen frohen Zecher. (Schluß folgt.)
8. Wien, den 14. Juli. (Welt-Ausstellung. Kunst-
Abtheilung. Forts.) Im historischen Genre hat Frankreich
keine Charakteristik. Es ist nichts da, was unser Augenmerk gradezu
fesseln würde, und die Allgemeinheit der Leistung erhebt sich kaum
zu der Bedeutung der Belgier und gesammten Niederländer, bei
denen stets mehr Studium zu finden ist. Grade hierin ist es, wo