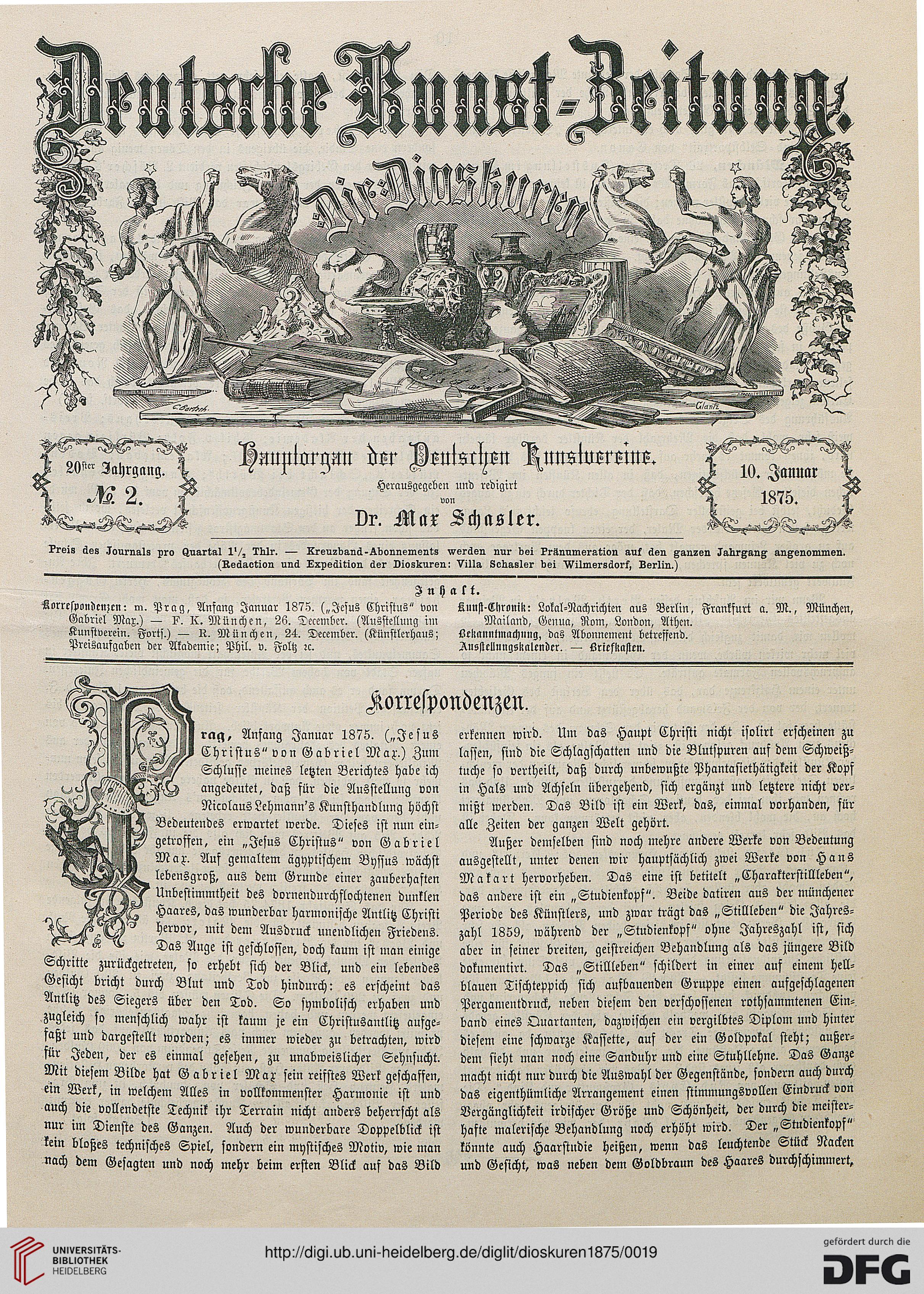Preis des Journals pro Quartal 17, Thlr. — Kreuzband-Abonnements werden nur bei Pränumeration auf den ganzen Jahrgang angenommen.
(Kedaction und Expedition der Dioskuren: Villa Schasler bei Wilmersdorf, Berlin.)
Inhalt.
LorrrsMidciiM: m. Prag, Anfang Januar 1875. („Jesus Christus" von Linist-Llironik: Lokal-Nachrichten aus Berlin, Frankfurt a. M., München,
Gabriel Max.) — F. K. München, 26. December. (Ausstellung tut Mailand, Genua, Rom, London, Athen.
Kunstverein. Forts.) — 11. München, 24. December. (Künstlerhaus; ückamitmachimg, das Abonnement betreffend.
Prcisaufgaben der Akademie; Phil. v. Folh ic. Äusstettnugstiatender. — ßricfltaflcit.
Korrespondenzen.
raq, Anfang Januar 1875. („Jesus
C h r i st n s " d o n Gabriel M ax.) Zum
Schlüsse meines letzten Berichtes habe ich
angedeutel, daß für die Ausstellung von
Nicolaus Lehinann's Kunsthandlung höchst
Bedeutendes erwartet werde. Dieses ist nun ein-
getroffen, ein „Jesus Christus" von Gabriel
Max. Auf gemaltem ägyptischem Byssus wächst
lebensgroß, aus dem Grunde einer zauberhaften
' Unbestimmtheit des dornendurchflochtenen dunklen
Haares, das wunderbar harmonische Antlitz Christi
hervor, mit dem Ausdruck unendlichen Friedens.
Das Auge ist geschlossen, doch kaum ist man einige
Schritte zurückgetreten, so erhebt sich der Blick, und ein lebendes
Gesicht bricht durch Blut und Tod hindurch: es erscheint das
Antlitz des Siegers über den Tod. So symbolisch erhaben und
zugleich so menschlich wahr ist kaum je ein Christusantlitz aufge-
faßt und dargestellt worden; es immer wieder zu betrachten, wird
für Jeden, der es einmal gesehen, zu unabweislicher Sehnsucht.
Mit diesem Bilde hat Gabriel Max sein reifstes Werk geschaffen,
ein Werk, in welchem Alles in vollkommenster Harmonie ist und
auch die vollendetste Technik ihr Terrain nicht anders beherrscht als
nur im Dienste des Ganzen. Auch der wunderbare Doppelblick ist
kein bloßes technisches Spiel, sondern ein mystisches Motiv, wie man
nach dem Gesagten und noch mehr beim ersten Blick auf das Bild
erkennen wird. Um das Haupt Christi nicht isolirt erscheinen zu
lassen, sind die Schlagschatten und die Blutspuren auf dem Schweiß-
tuche so vertheilt, daß durch unbewußte Phantasiethätigkeit der Kopf
in Hals und Achseln übergehend, sich ergänzt und letztere nicht ver-
mißt werden. Das Bild ist ein Werk, das, einmal vorhanden, für
alle Zeiten der ganzen Welt gehört.
Außer demselben sind noch mehre andere Werke von Bedeutung
ausgestellt, unter denen wir hauptsächlich zwei Werke von Hans
Makart hervorheben. Das eine ist betitelt „Charakterstillleben",
das andere ist ein „Studienkopf". Beide datiren aus der Münchener
Periode des Künstlers, und zwar trägt das „Stillleben" die Jahres-
zahl 1859, während der „Studienkopf" ohne Jahreszahl ist, sich
aber in seiner breiten, geistreichen Behandlung als das jüngere Bild
dokumentirt. DaS „Stillleben" schildert in einer ans einem hell-
blauen Tischteppich sich aufbauenden Gruppe einen aufgeschlagenen
Pergamentdruck, neben diesem den verschossenen rothsammtenen Ein-,
band eines Quartanten, dazwischen ein vergilbtes Diplom und hinter
diesem eine schwarze Kassette, auf der ein Goldpokal steht; außer-
dem sieht man noch eine Sanduhr und eine Stuhllehne. Das Ganze
macht nicht nur durch die Auswahl der Gegenstände, sondern auch durch
das eigenthümliche Arrangement einen stimmungsvollen Eindruck von
Vergänglichkeit irdischer Größe und Schönheit, der durch die mcifter-
hafte malerische Behandlung noch erhöht wird. Der „Stndienkopf"
könnte auch Haarstndie heißen, wenn das leuchtende Stück Nacken
und Gesicht, was neben dem Goldbraun des Haares durchschiminert,
(Kedaction und Expedition der Dioskuren: Villa Schasler bei Wilmersdorf, Berlin.)
Inhalt.
LorrrsMidciiM: m. Prag, Anfang Januar 1875. („Jesus Christus" von Linist-Llironik: Lokal-Nachrichten aus Berlin, Frankfurt a. M., München,
Gabriel Max.) — F. K. München, 26. December. (Ausstellung tut Mailand, Genua, Rom, London, Athen.
Kunstverein. Forts.) — 11. München, 24. December. (Künstlerhaus; ückamitmachimg, das Abonnement betreffend.
Prcisaufgaben der Akademie; Phil. v. Folh ic. Äusstettnugstiatender. — ßricfltaflcit.
Korrespondenzen.
raq, Anfang Januar 1875. („Jesus
C h r i st n s " d o n Gabriel M ax.) Zum
Schlüsse meines letzten Berichtes habe ich
angedeutel, daß für die Ausstellung von
Nicolaus Lehinann's Kunsthandlung höchst
Bedeutendes erwartet werde. Dieses ist nun ein-
getroffen, ein „Jesus Christus" von Gabriel
Max. Auf gemaltem ägyptischem Byssus wächst
lebensgroß, aus dem Grunde einer zauberhaften
' Unbestimmtheit des dornendurchflochtenen dunklen
Haares, das wunderbar harmonische Antlitz Christi
hervor, mit dem Ausdruck unendlichen Friedens.
Das Auge ist geschlossen, doch kaum ist man einige
Schritte zurückgetreten, so erhebt sich der Blick, und ein lebendes
Gesicht bricht durch Blut und Tod hindurch: es erscheint das
Antlitz des Siegers über den Tod. So symbolisch erhaben und
zugleich so menschlich wahr ist kaum je ein Christusantlitz aufge-
faßt und dargestellt worden; es immer wieder zu betrachten, wird
für Jeden, der es einmal gesehen, zu unabweislicher Sehnsucht.
Mit diesem Bilde hat Gabriel Max sein reifstes Werk geschaffen,
ein Werk, in welchem Alles in vollkommenster Harmonie ist und
auch die vollendetste Technik ihr Terrain nicht anders beherrscht als
nur im Dienste des Ganzen. Auch der wunderbare Doppelblick ist
kein bloßes technisches Spiel, sondern ein mystisches Motiv, wie man
nach dem Gesagten und noch mehr beim ersten Blick auf das Bild
erkennen wird. Um das Haupt Christi nicht isolirt erscheinen zu
lassen, sind die Schlagschatten und die Blutspuren auf dem Schweiß-
tuche so vertheilt, daß durch unbewußte Phantasiethätigkeit der Kopf
in Hals und Achseln übergehend, sich ergänzt und letztere nicht ver-
mißt werden. Das Bild ist ein Werk, das, einmal vorhanden, für
alle Zeiten der ganzen Welt gehört.
Außer demselben sind noch mehre andere Werke von Bedeutung
ausgestellt, unter denen wir hauptsächlich zwei Werke von Hans
Makart hervorheben. Das eine ist betitelt „Charakterstillleben",
das andere ist ein „Studienkopf". Beide datiren aus der Münchener
Periode des Künstlers, und zwar trägt das „Stillleben" die Jahres-
zahl 1859, während der „Studienkopf" ohne Jahreszahl ist, sich
aber in seiner breiten, geistreichen Behandlung als das jüngere Bild
dokumentirt. DaS „Stillleben" schildert in einer ans einem hell-
blauen Tischteppich sich aufbauenden Gruppe einen aufgeschlagenen
Pergamentdruck, neben diesem den verschossenen rothsammtenen Ein-,
band eines Quartanten, dazwischen ein vergilbtes Diplom und hinter
diesem eine schwarze Kassette, auf der ein Goldpokal steht; außer-
dem sieht man noch eine Sanduhr und eine Stuhllehne. Das Ganze
macht nicht nur durch die Auswahl der Gegenstände, sondern auch durch
das eigenthümliche Arrangement einen stimmungsvollen Eindruck von
Vergänglichkeit irdischer Größe und Schönheit, der durch die mcifter-
hafte malerische Behandlung noch erhöht wird. Der „Stndienkopf"
könnte auch Haarstndie heißen, wenn das leuchtende Stück Nacken
und Gesicht, was neben dem Goldbraun des Haares durchschiminert,