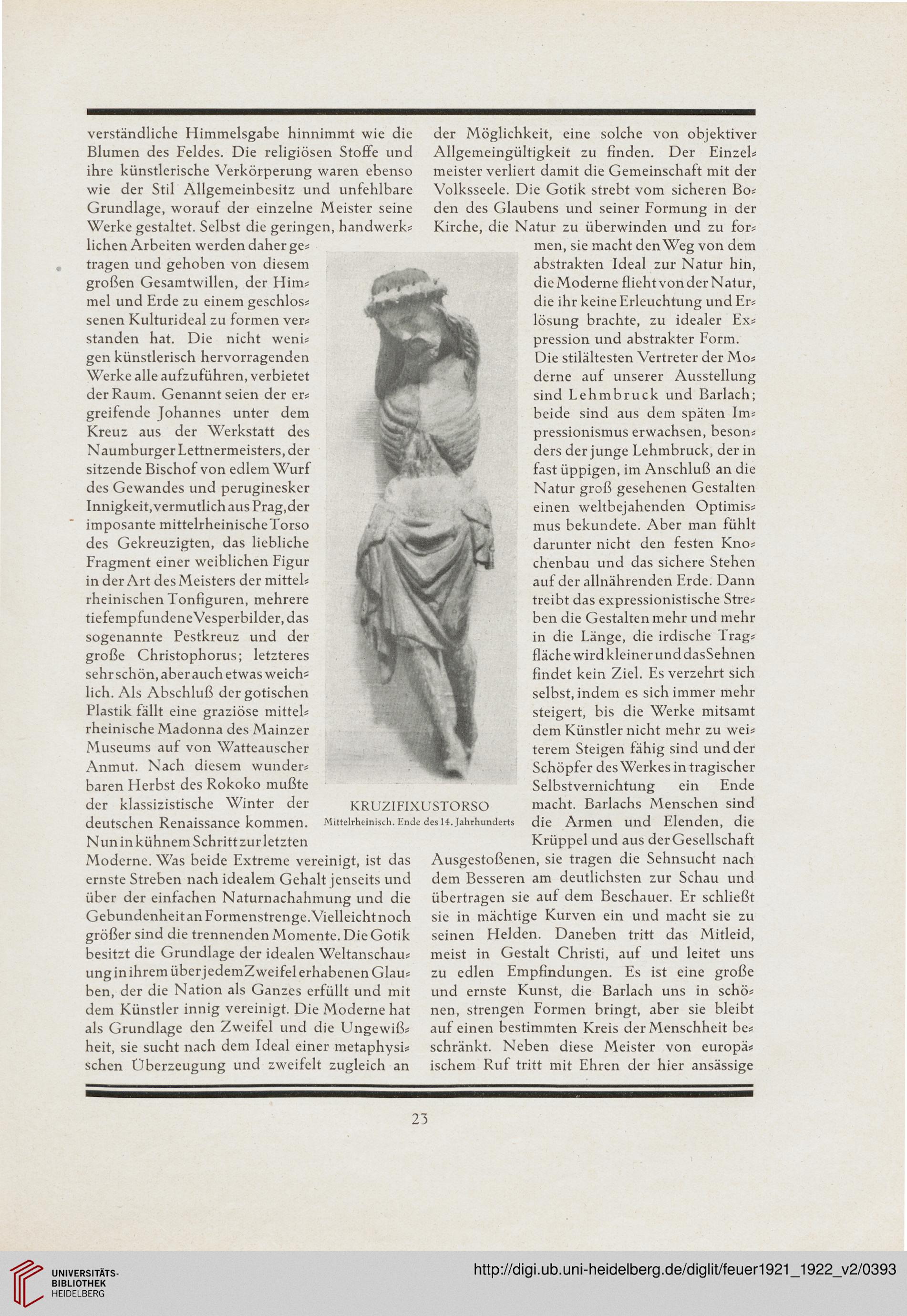verständliche Himmelsgabe hinnimmt wie die
Blumen des Feldes. Die religiösen Stoffe und
ihre künstlerische Verkörperung waren ebenso
wie der Stil Allgemeinbesitz und unfehlbare
Grundlage, worauf der einzelne Meister seine
Werke gestaltet. Selbst die geringen, handwerk?
liehen Arbeiten werden daher ge?
tragen und gehoben von diesem
großen Gesamtwillen, der Hirns
mel und Erde zu einem geschlos«
senen Kulturideal zu formen ver«
standen hat. Die nicht wenis
gen künstlerisch hervorragenden
Werke alle aufzuführen, verbietet
der Raum. Genannt seien der ers
greifende Johannes unter dem
Kreuz aus der Werkstatt des
N aumburger Lettnermeisters, der
sitzende Bischof von edlem Wurf
des Gewandes und peruginesker
Innigkeit, vermutlich aus Prag,der
imposante mittelrheinischeTorso
des Gekreuzigten, das liebliche
Fragment einer weiblichen Figur
in der Art des Meisters der mittels
rheinischen Tonfiguren, mehrere
tiefempfundeneVesperbilder, das
sogenannte Pestkreuz und der
große Christophorus; letzteres
sehr schön, aber auch etwas weich«
lieh. Als Abschluß der gotischen
Plastik fällt eine graziöse mittels
rheinische Madonna des Mainzer
Museums auf von Watteauscher
Anmut. Nach diesem Wunders
baren Herbst des Rokoko mußte
der klassizistische Winter der
deutschen Renaissance kommen.
Nun in kühnem Schrittzurletzten
Moderne. Was beide Extreme vereinigt, ist das
ernste Streben nach idealem Gehalt jenseits und
über der einfachen Naturnachahmung und die
Gebundenheit an Formenstrenge. Vielleicht noch
größer sind die trennenden Momente. Die Gotik
besitzt die Grundlage der idealen Weltanschaus
ung in ihrem überjedemZweifel erhabenen Glaus
ben, der die Nation als Ganzes erfüllt und mit
dem Künstler innig vereinigt. Die Moderne hat
als Grundlage den Zweifel und die Ungewiß?
heit, sie sucht nach dem Ideal einer metaphysis
sehen Überzeugung und zweifelt zugleich an
der Möglichkeit, eine solche von objektiver
Allgemeingültigkeit zu finden. Der Einzels
meister verliert damit die Gemeinschaft mit der
Volksseele. Die Gotik strebt vom sicheren Bos
den des Glaubens und seiner Formung in der
Kirche, die Natur zu überwinden und zu fors
men, sie macht den Weg von dem
abstrakten Ideal zur Natur hin,
dieModerne fliehtvonderNatur,
die ihr keine Erleuchtung und Er?
lösung brachte, zu idealer Ex?
pression und abstrakter Form.
Die stilältesten Vertreter der Mos
derne auf unserer Ausstellung
sind Lehmbruck und Barlach;
beide sind aus dem späten Ims
pressionismus erwachsen, besons
ders der junge Lehmbruck, der in
fast üppigen, im Anschluß an die
Natur groß gesehenen Gestalten
einen weltbejahenden Optimis?
mus bekundete. Aber man fühlt
darunter nicht den festen Knos
chenbau und das sichere Stehen
auf der allnährenden Erde. Dann
treibt das expressionistische Stre?
ben die Gestalten mehr und mehr
in die Länge, die irdische Trägs
fläche wird kleiner und dasSehnen
findet kein Ziel. Es verzehrt sich
selbst, indem es sich immer mehr
steigert, bis die Werke mitsamt
dem Künstler nicht mehr zu weis
terem Steigen fähig sind und der
Schöpfer des Werkes in tragischer
Selbstvernichtung ein Ende
macht. Barlachs Menschen sind
die Armen und Elenden, die
Krüppel und aus der Gesellschaft
Ausgestoßenen, sie tragen die Sehnsucht nach
dem Besseren am deutlichsten zur Schau und
übertragen sie auf dem Beschauer. Er schließt
sie in mächtige Kurven ein und macht sie zu
seinen Helden. Daneben tritt das Mitleid,
meist in Gestalt Christi, auf und leitet uns
zu edlen Empfindungen. Es ist eine große
und ernste Kunst, die Barlach uns in schö?
nen, strengen Formen bringt, aber sie bleibt
auf einen bestimmten Kreis der Menschheit be?
schränkt. Neben diese Meister von europä?
ischem Ruf tritt mit Ehren der hier ansässige
KRUZIFIXUSTORSO
Mittelrheinisch. Ende des 14. Jahrhunderts
23
Blumen des Feldes. Die religiösen Stoffe und
ihre künstlerische Verkörperung waren ebenso
wie der Stil Allgemeinbesitz und unfehlbare
Grundlage, worauf der einzelne Meister seine
Werke gestaltet. Selbst die geringen, handwerk?
liehen Arbeiten werden daher ge?
tragen und gehoben von diesem
großen Gesamtwillen, der Hirns
mel und Erde zu einem geschlos«
senen Kulturideal zu formen ver«
standen hat. Die nicht wenis
gen künstlerisch hervorragenden
Werke alle aufzuführen, verbietet
der Raum. Genannt seien der ers
greifende Johannes unter dem
Kreuz aus der Werkstatt des
N aumburger Lettnermeisters, der
sitzende Bischof von edlem Wurf
des Gewandes und peruginesker
Innigkeit, vermutlich aus Prag,der
imposante mittelrheinischeTorso
des Gekreuzigten, das liebliche
Fragment einer weiblichen Figur
in der Art des Meisters der mittels
rheinischen Tonfiguren, mehrere
tiefempfundeneVesperbilder, das
sogenannte Pestkreuz und der
große Christophorus; letzteres
sehr schön, aber auch etwas weich«
lieh. Als Abschluß der gotischen
Plastik fällt eine graziöse mittels
rheinische Madonna des Mainzer
Museums auf von Watteauscher
Anmut. Nach diesem Wunders
baren Herbst des Rokoko mußte
der klassizistische Winter der
deutschen Renaissance kommen.
Nun in kühnem Schrittzurletzten
Moderne. Was beide Extreme vereinigt, ist das
ernste Streben nach idealem Gehalt jenseits und
über der einfachen Naturnachahmung und die
Gebundenheit an Formenstrenge. Vielleicht noch
größer sind die trennenden Momente. Die Gotik
besitzt die Grundlage der idealen Weltanschaus
ung in ihrem überjedemZweifel erhabenen Glaus
ben, der die Nation als Ganzes erfüllt und mit
dem Künstler innig vereinigt. Die Moderne hat
als Grundlage den Zweifel und die Ungewiß?
heit, sie sucht nach dem Ideal einer metaphysis
sehen Überzeugung und zweifelt zugleich an
der Möglichkeit, eine solche von objektiver
Allgemeingültigkeit zu finden. Der Einzels
meister verliert damit die Gemeinschaft mit der
Volksseele. Die Gotik strebt vom sicheren Bos
den des Glaubens und seiner Formung in der
Kirche, die Natur zu überwinden und zu fors
men, sie macht den Weg von dem
abstrakten Ideal zur Natur hin,
dieModerne fliehtvonderNatur,
die ihr keine Erleuchtung und Er?
lösung brachte, zu idealer Ex?
pression und abstrakter Form.
Die stilältesten Vertreter der Mos
derne auf unserer Ausstellung
sind Lehmbruck und Barlach;
beide sind aus dem späten Ims
pressionismus erwachsen, besons
ders der junge Lehmbruck, der in
fast üppigen, im Anschluß an die
Natur groß gesehenen Gestalten
einen weltbejahenden Optimis?
mus bekundete. Aber man fühlt
darunter nicht den festen Knos
chenbau und das sichere Stehen
auf der allnährenden Erde. Dann
treibt das expressionistische Stre?
ben die Gestalten mehr und mehr
in die Länge, die irdische Trägs
fläche wird kleiner und dasSehnen
findet kein Ziel. Es verzehrt sich
selbst, indem es sich immer mehr
steigert, bis die Werke mitsamt
dem Künstler nicht mehr zu weis
terem Steigen fähig sind und der
Schöpfer des Werkes in tragischer
Selbstvernichtung ein Ende
macht. Barlachs Menschen sind
die Armen und Elenden, die
Krüppel und aus der Gesellschaft
Ausgestoßenen, sie tragen die Sehnsucht nach
dem Besseren am deutlichsten zur Schau und
übertragen sie auf dem Beschauer. Er schließt
sie in mächtige Kurven ein und macht sie zu
seinen Helden. Daneben tritt das Mitleid,
meist in Gestalt Christi, auf und leitet uns
zu edlen Empfindungen. Es ist eine große
und ernste Kunst, die Barlach uns in schö?
nen, strengen Formen bringt, aber sie bleibt
auf einen bestimmten Kreis der Menschheit be?
schränkt. Neben diese Meister von europä?
ischem Ruf tritt mit Ehren der hier ansässige
KRUZIFIXUSTORSO
Mittelrheinisch. Ende des 14. Jahrhunderts
23