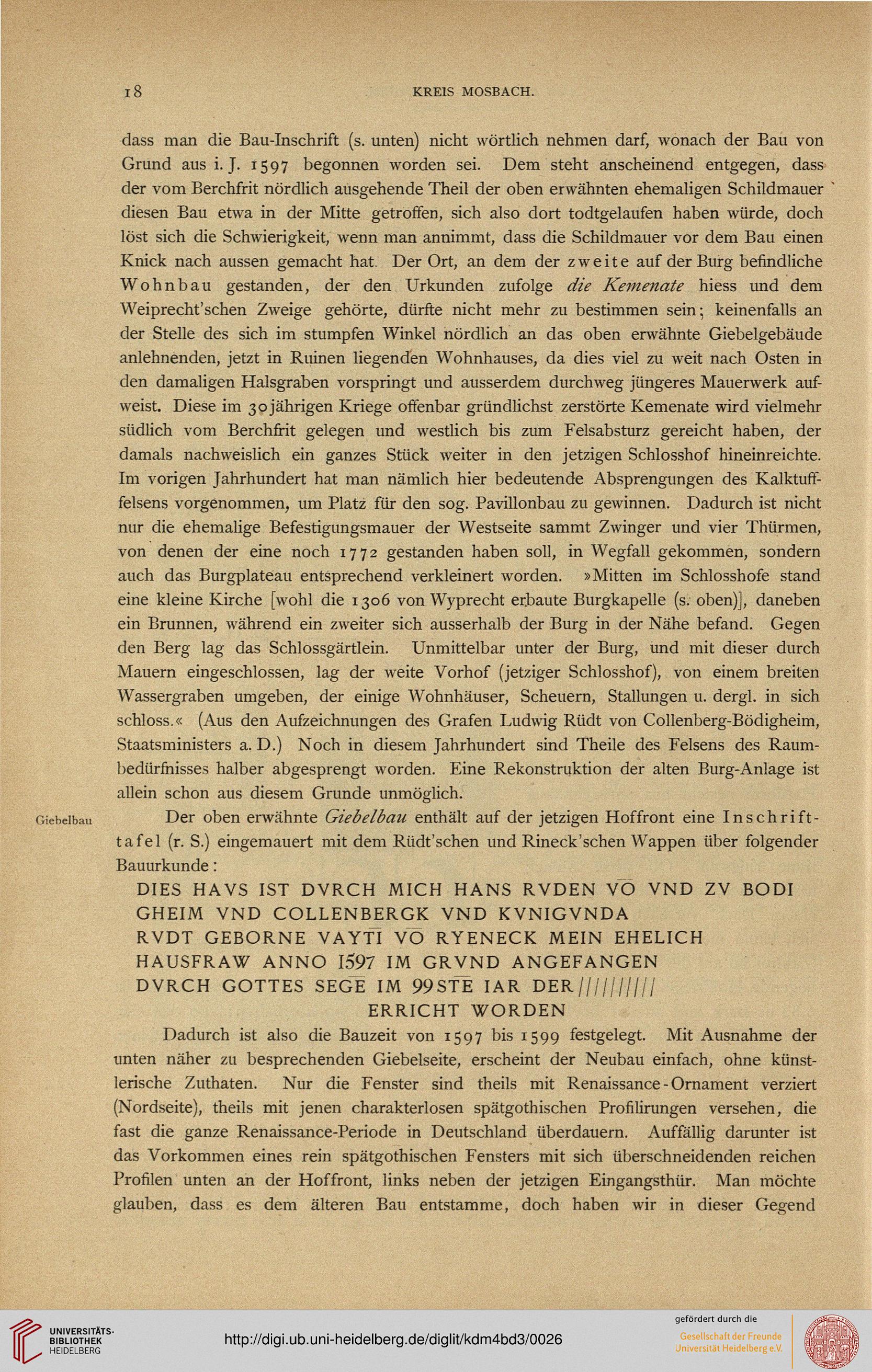i8
KREIS MOSBACH.
dass man die Bau-Inschrift (s. unten) nicht wörtlich nehmen darf, wonach der Bau von
Grund aus i. J. 1597 begonnen worden sei. Dem steht anscheinend entgegen, dass
der vom Berchfrit nördlich ausgehende Theil der oben erwähnten ehemaligen Schildmauer
diesen Bau etwa in der Mitte getroffen, sich also dort todtgelaufen haben würde, doch
löst sich die Schwierigkeit, wenn man annimmt, dass die Schildmauer vor dem Bau einen
Knick nach aussen gemacht hat. Der Ort, an dem der zweite auf der Burg befindliche
Wohnbau gestanden, der den Urkunden zufolge die Kemenate hiess und dem
Weiprecht'schen Zweige gehörte, dürfte nicht mehr zu bestimmen sein; keinenfalls an
der Stelle des sich im stumpfen Winkel nördlich an das oben erwähnte Giebelgebäude
anlehnenden, jetzt in Ruinen liegenden Wohnhauses, da dies viel zu weit nach Osten in
den damaligen Halsgraben vorspringt und ausserdem durchweg jüngeres Mauerwerk auf-
weist. Diese im 30jährigen Kriege offenbar gründlichst zerstörte Kemenate wird vielmehr
südlich vom Berchfrit gelegen und westlich bis zum Felsabsturz gereicht haben, der
damals nachweislich ein ganzes Stück weiter in den jetzigen Schlosshof hineinreichte.
Im vorigen Jahrhundert hat man nämlich hier bedeutende Absprengungen des Kalktuff-
felsens vorgenommen, um Platz für den sog. Pavillonbau zu gewinnen. Dadurch ist nicht
nur die ehemalige Befestigungsmauer der Westseite sammt Zwinger und vier Thürmen,
von denen der eine noch 1772 gestanden haben soll, in Wegfall gekommen, sondern
auch das Burgplateau entsprechend verkleinert worden. »Mitten im Schlosshofe stand
eine kleine Kirche [wohl die 1306 von Wyprecht erbaute Burgkapelle (s. oben)], daneben
ein Brunnen, während ein zweiter sich ausserhalb der Burg in der Nähe befand. Gegen
den Berg lag das Schlossgärtlein. Unmittelbar unter der Burg, und mit dieser durch
Mauern eingeschlossen, lag der weite Vorhof (jetziger Schlosshof), von einem breiten
Wassergraben umgeben, der einige Wohnhäuser, Scheuern, Stallungen u. dergl. in sich
schloss.« (Aus den Aufzeichnungen des Grafen Ludwig Rüdt von Collenberg-Bödigheim,
Staatsministers a. D.) Noch in diesem Jahrhundert sind Theile des Felsens des Raum-
bedürfnisses halber abgesprengt worden. Eine Rekonstruktion der alten Burg-Anlage ist
allein schon aus diesem Grunde unmöglich.
Der oben erwähnte Giebelbau enthält auf der jetzigen Hof front eine Inschrift-
tafel (r. S.) eingemauert mit dem Rüdt'schen und Rineck'schen Wappen über folgender
Bauurkunde:
DIES HAVS IST DVRCH MICH HANS RVDEN VÖ VND ZV BODI
GHEIM VND COLLENBERGK VND KVNIGVNDA
RVDT GEBORNE VAYTI VO RYENECK MEIN EHELICH
HAUSFRAW ANNO 1597 IM GRVND ANGEFANGEN
DVRCH GOTTES SEGE IM 99STE IAR DER//////////
ERRICHT WORDEN
Dadurch ist also die Bauzeit von 1597 bis 1599 festgelegt. Mit Ausnahme der
unten näher zu besprechenden Giebelseite, erscheint der Neubau einfach, ohne künst-
lerische Zuthaten. Nur die Fenster sind theils mit Renaissance - Ornament verziert
(Nordseite), theils mit jenen charakterlosen spätgothischen Profilirungen versehen, die
fast die ganze Renaissance-Periode in Deutschland überdauern. Auffällig darunter ist
das Vorkommen eines rein spätgothischen Fensters mit sich überschneidenden reichen
Profilen unten an der Hoffront, links neben der jetzigen Eingangsthür. Man möchte
glauben, dass es dem älteren Bau entstamme, doch haben wir in dieser Gegend
KREIS MOSBACH.
dass man die Bau-Inschrift (s. unten) nicht wörtlich nehmen darf, wonach der Bau von
Grund aus i. J. 1597 begonnen worden sei. Dem steht anscheinend entgegen, dass
der vom Berchfrit nördlich ausgehende Theil der oben erwähnten ehemaligen Schildmauer
diesen Bau etwa in der Mitte getroffen, sich also dort todtgelaufen haben würde, doch
löst sich die Schwierigkeit, wenn man annimmt, dass die Schildmauer vor dem Bau einen
Knick nach aussen gemacht hat. Der Ort, an dem der zweite auf der Burg befindliche
Wohnbau gestanden, der den Urkunden zufolge die Kemenate hiess und dem
Weiprecht'schen Zweige gehörte, dürfte nicht mehr zu bestimmen sein; keinenfalls an
der Stelle des sich im stumpfen Winkel nördlich an das oben erwähnte Giebelgebäude
anlehnenden, jetzt in Ruinen liegenden Wohnhauses, da dies viel zu weit nach Osten in
den damaligen Halsgraben vorspringt und ausserdem durchweg jüngeres Mauerwerk auf-
weist. Diese im 30jährigen Kriege offenbar gründlichst zerstörte Kemenate wird vielmehr
südlich vom Berchfrit gelegen und westlich bis zum Felsabsturz gereicht haben, der
damals nachweislich ein ganzes Stück weiter in den jetzigen Schlosshof hineinreichte.
Im vorigen Jahrhundert hat man nämlich hier bedeutende Absprengungen des Kalktuff-
felsens vorgenommen, um Platz für den sog. Pavillonbau zu gewinnen. Dadurch ist nicht
nur die ehemalige Befestigungsmauer der Westseite sammt Zwinger und vier Thürmen,
von denen der eine noch 1772 gestanden haben soll, in Wegfall gekommen, sondern
auch das Burgplateau entsprechend verkleinert worden. »Mitten im Schlosshofe stand
eine kleine Kirche [wohl die 1306 von Wyprecht erbaute Burgkapelle (s. oben)], daneben
ein Brunnen, während ein zweiter sich ausserhalb der Burg in der Nähe befand. Gegen
den Berg lag das Schlossgärtlein. Unmittelbar unter der Burg, und mit dieser durch
Mauern eingeschlossen, lag der weite Vorhof (jetziger Schlosshof), von einem breiten
Wassergraben umgeben, der einige Wohnhäuser, Scheuern, Stallungen u. dergl. in sich
schloss.« (Aus den Aufzeichnungen des Grafen Ludwig Rüdt von Collenberg-Bödigheim,
Staatsministers a. D.) Noch in diesem Jahrhundert sind Theile des Felsens des Raum-
bedürfnisses halber abgesprengt worden. Eine Rekonstruktion der alten Burg-Anlage ist
allein schon aus diesem Grunde unmöglich.
Der oben erwähnte Giebelbau enthält auf der jetzigen Hof front eine Inschrift-
tafel (r. S.) eingemauert mit dem Rüdt'schen und Rineck'schen Wappen über folgender
Bauurkunde:
DIES HAVS IST DVRCH MICH HANS RVDEN VÖ VND ZV BODI
GHEIM VND COLLENBERGK VND KVNIGVNDA
RVDT GEBORNE VAYTI VO RYENECK MEIN EHELICH
HAUSFRAW ANNO 1597 IM GRVND ANGEFANGEN
DVRCH GOTTES SEGE IM 99STE IAR DER//////////
ERRICHT WORDEN
Dadurch ist also die Bauzeit von 1597 bis 1599 festgelegt. Mit Ausnahme der
unten näher zu besprechenden Giebelseite, erscheint der Neubau einfach, ohne künst-
lerische Zuthaten. Nur die Fenster sind theils mit Renaissance - Ornament verziert
(Nordseite), theils mit jenen charakterlosen spätgothischen Profilirungen versehen, die
fast die ganze Renaissance-Periode in Deutschland überdauern. Auffällig darunter ist
das Vorkommen eines rein spätgothischen Fensters mit sich überschneidenden reichen
Profilen unten an der Hoffront, links neben der jetzigen Eingangsthür. Man möchte
glauben, dass es dem älteren Bau entstamme, doch haben wir in dieser Gegend