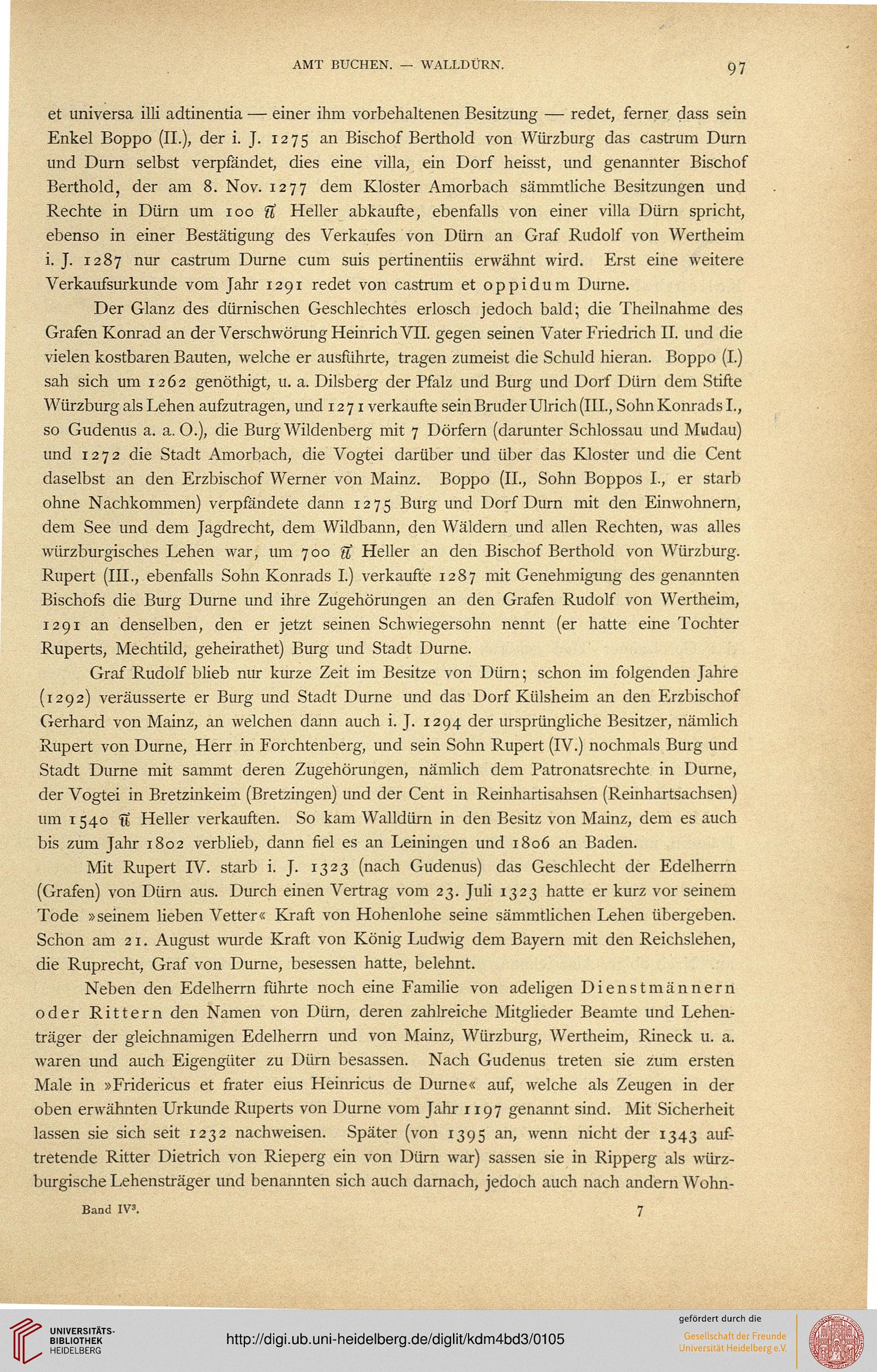AMT BUCHEN. — WALLDÜRN. 97
et universa illi adtinentia — einer ihm vorbehaltenen Besitzung — redet, ferner dass sein
Enkel Boppo (LT.), der i. J. 1275 an Bischof Berthold von Würzburg das castrum Dum
und Dum selbst verpfändet, dies eine villa, ein Dorf heisst, und genannter Bischof
Berthold, der am 8. Nov. 1277 dem Kloster Amorbach sämmtliche Besitzungen und
Rechte in Dürn um 100 Ti Heller abkaufte, ebenfalls von einer villa Dürn spricht,
ebenso in einer Bestätigung des Verkaufes von Dum an Graf Rudolf von Wertheim
i. J. 1287 nur castrum Durne cum suis pertinentiis erwähnt wird. Erst eine weitere
Verkaufsurkunde vom Jahr 1291 redet von castrum et oppidum Durne.
Der Glanz des dürnischen Geschlechtes erlosch jedoch bald; die Theilnahme des
Grafen Konrad an der Verschwörung Heinrich VII. gegen seinen Vater Friedrich II. und die
vielen kostbaren Bauten, welche er ausführte, tragen zumeist die Schuld hieran. Boppo (I.)
sah sich um 1262 genöthigt, u. a. Dilsberg der Pfalz und Burg und Dorf Dürn dem Stifte
Würzburg als Lehen aufzutragen, und 12 71 verkaufte sein Bruder Ulrich (III., Sohn Konrads I.,
so Gudenus a. a. O.), die Burg Wildenberg mit 7 Dörfern (darunter Schlossau und Mudau)
und 1272 die Stadt Amorbach, die Vogtei darüber und über das Kloster und die Cent
daselbst an den Erzbischof Werner von Mainz. Boppo (IL, Sohn Boppos L, er starb
ohne Nachkommen) verpfändete dann 1275 Burg und Dorf Dum mit den Einwohnern,
dem See und dem Jagdrecht, dem Wildbann, den Wäldern und allen Rechten, was alles
würzburgisches Lehen war, um 700 ß Heller an den Bischof Berthold von Würzburg.
Rupert (III., ebenfalls Sohn Konrads I.) verkaufte 1287 mit Genehmigung des genannten
Bischofs die Burg Durne und ihre Zugehörungen an den Grafen Rudolf von Wertheim,
1291 an denselben, den er jetzt seinen Schwiegersohn nennt (er hatte eine Tochter
Ruperts, Mechtild, geheirathet) Burg und Stadt Durne.
Graf Rudolf blieb nur kurze Zeit im Besitze von Dürn; schon im folgenden Jahre
(1292) veräusserte er Burg und Stadt Durne und das Dorf Külsheim an den Erzbischof
Gerhard von Mainz, an welchen dann auch i. J. 1294 der ursprüngliche Besitzer, nämlich
Rupert von Durne, Herr in Forchtenberg, und sein Sohn Rupert (IV.) nochmals Burg und
Stadt Durne mit sammt deren Zugehörungen, nämlich dem Patronatsrechte in Durne,
der Vogtei in Bretzinkeim (Bretzingen) und der Cent in Reinhartisahsen (Reinhartsachsen)
um 1540 ft Heller verkauften. So kam Walldürn in den Besitz von Mainz, dem es auch
bis zum Jahr 1802 verblieb, dann fiel es an Leiningen und 1806 an Baden.
Mit Rupert IV. starb i. J. 1323 (nach Gudenus) das Geschlecht der Edelherrn
(Grafen) von Dürn aus. Durch einen Vertrag vom 23. Juli 1323 hatte er kurz vor seinem
Tode »seinem lieben Vetter« Kraft von Hohenlohe seine sämmtlichen Lehen übergeben.
Schon am 21. August wurde Kraft von König Ludwig dem Bayern mit den Reichslehen,
die Ruprecht, Graf von Dume, besessen hatte, belehnt.
Neben den Edelherrn führte noch eine Familie von adeligen Dienstmännern
oder Rittern den Namen von Dürn, deren zahlreiche Mitglieder Beamte und Lehen-
träger der gleichnamigen Edelherrn und von Mainz, Würzburg, Wertheim, Rineck u. a.
waren und auch Eigengüter zu Dum besassen. Nach Gudenus treten sie zum ersten
Male in »Fridericus et frater eius Heinricus de Dume« auf, welche als Zeugen in der
oben erwähnten Urkunde Ruperts von Dume vom Jahr 1197 genannt sind. Mit Sicherheit
lassen sie sich seit 1232 nachweisen. Später (von 1395 an, wenn nicht der 1343 auf-
tretende Ritter Dietrich von Rieperg ein von Dum war) sassen sie in Ripperg als würz-
burgische Lehensträger und benannten sich auch darnach, jedoch auch nach andern Wohn-
Band IV. 7
et universa illi adtinentia — einer ihm vorbehaltenen Besitzung — redet, ferner dass sein
Enkel Boppo (LT.), der i. J. 1275 an Bischof Berthold von Würzburg das castrum Dum
und Dum selbst verpfändet, dies eine villa, ein Dorf heisst, und genannter Bischof
Berthold, der am 8. Nov. 1277 dem Kloster Amorbach sämmtliche Besitzungen und
Rechte in Dürn um 100 Ti Heller abkaufte, ebenfalls von einer villa Dürn spricht,
ebenso in einer Bestätigung des Verkaufes von Dum an Graf Rudolf von Wertheim
i. J. 1287 nur castrum Durne cum suis pertinentiis erwähnt wird. Erst eine weitere
Verkaufsurkunde vom Jahr 1291 redet von castrum et oppidum Durne.
Der Glanz des dürnischen Geschlechtes erlosch jedoch bald; die Theilnahme des
Grafen Konrad an der Verschwörung Heinrich VII. gegen seinen Vater Friedrich II. und die
vielen kostbaren Bauten, welche er ausführte, tragen zumeist die Schuld hieran. Boppo (I.)
sah sich um 1262 genöthigt, u. a. Dilsberg der Pfalz und Burg und Dorf Dürn dem Stifte
Würzburg als Lehen aufzutragen, und 12 71 verkaufte sein Bruder Ulrich (III., Sohn Konrads I.,
so Gudenus a. a. O.), die Burg Wildenberg mit 7 Dörfern (darunter Schlossau und Mudau)
und 1272 die Stadt Amorbach, die Vogtei darüber und über das Kloster und die Cent
daselbst an den Erzbischof Werner von Mainz. Boppo (IL, Sohn Boppos L, er starb
ohne Nachkommen) verpfändete dann 1275 Burg und Dorf Dum mit den Einwohnern,
dem See und dem Jagdrecht, dem Wildbann, den Wäldern und allen Rechten, was alles
würzburgisches Lehen war, um 700 ß Heller an den Bischof Berthold von Würzburg.
Rupert (III., ebenfalls Sohn Konrads I.) verkaufte 1287 mit Genehmigung des genannten
Bischofs die Burg Durne und ihre Zugehörungen an den Grafen Rudolf von Wertheim,
1291 an denselben, den er jetzt seinen Schwiegersohn nennt (er hatte eine Tochter
Ruperts, Mechtild, geheirathet) Burg und Stadt Durne.
Graf Rudolf blieb nur kurze Zeit im Besitze von Dürn; schon im folgenden Jahre
(1292) veräusserte er Burg und Stadt Durne und das Dorf Külsheim an den Erzbischof
Gerhard von Mainz, an welchen dann auch i. J. 1294 der ursprüngliche Besitzer, nämlich
Rupert von Durne, Herr in Forchtenberg, und sein Sohn Rupert (IV.) nochmals Burg und
Stadt Durne mit sammt deren Zugehörungen, nämlich dem Patronatsrechte in Durne,
der Vogtei in Bretzinkeim (Bretzingen) und der Cent in Reinhartisahsen (Reinhartsachsen)
um 1540 ft Heller verkauften. So kam Walldürn in den Besitz von Mainz, dem es auch
bis zum Jahr 1802 verblieb, dann fiel es an Leiningen und 1806 an Baden.
Mit Rupert IV. starb i. J. 1323 (nach Gudenus) das Geschlecht der Edelherrn
(Grafen) von Dürn aus. Durch einen Vertrag vom 23. Juli 1323 hatte er kurz vor seinem
Tode »seinem lieben Vetter« Kraft von Hohenlohe seine sämmtlichen Lehen übergeben.
Schon am 21. August wurde Kraft von König Ludwig dem Bayern mit den Reichslehen,
die Ruprecht, Graf von Dume, besessen hatte, belehnt.
Neben den Edelherrn führte noch eine Familie von adeligen Dienstmännern
oder Rittern den Namen von Dürn, deren zahlreiche Mitglieder Beamte und Lehen-
träger der gleichnamigen Edelherrn und von Mainz, Würzburg, Wertheim, Rineck u. a.
waren und auch Eigengüter zu Dum besassen. Nach Gudenus treten sie zum ersten
Male in »Fridericus et frater eius Heinricus de Dume« auf, welche als Zeugen in der
oben erwähnten Urkunde Ruperts von Dume vom Jahr 1197 genannt sind. Mit Sicherheit
lassen sie sich seit 1232 nachweisen. Später (von 1395 an, wenn nicht der 1343 auf-
tretende Ritter Dietrich von Rieperg ein von Dum war) sassen sie in Ripperg als würz-
burgische Lehensträger und benannten sich auch darnach, jedoch auch nach andern Wohn-
Band IV. 7