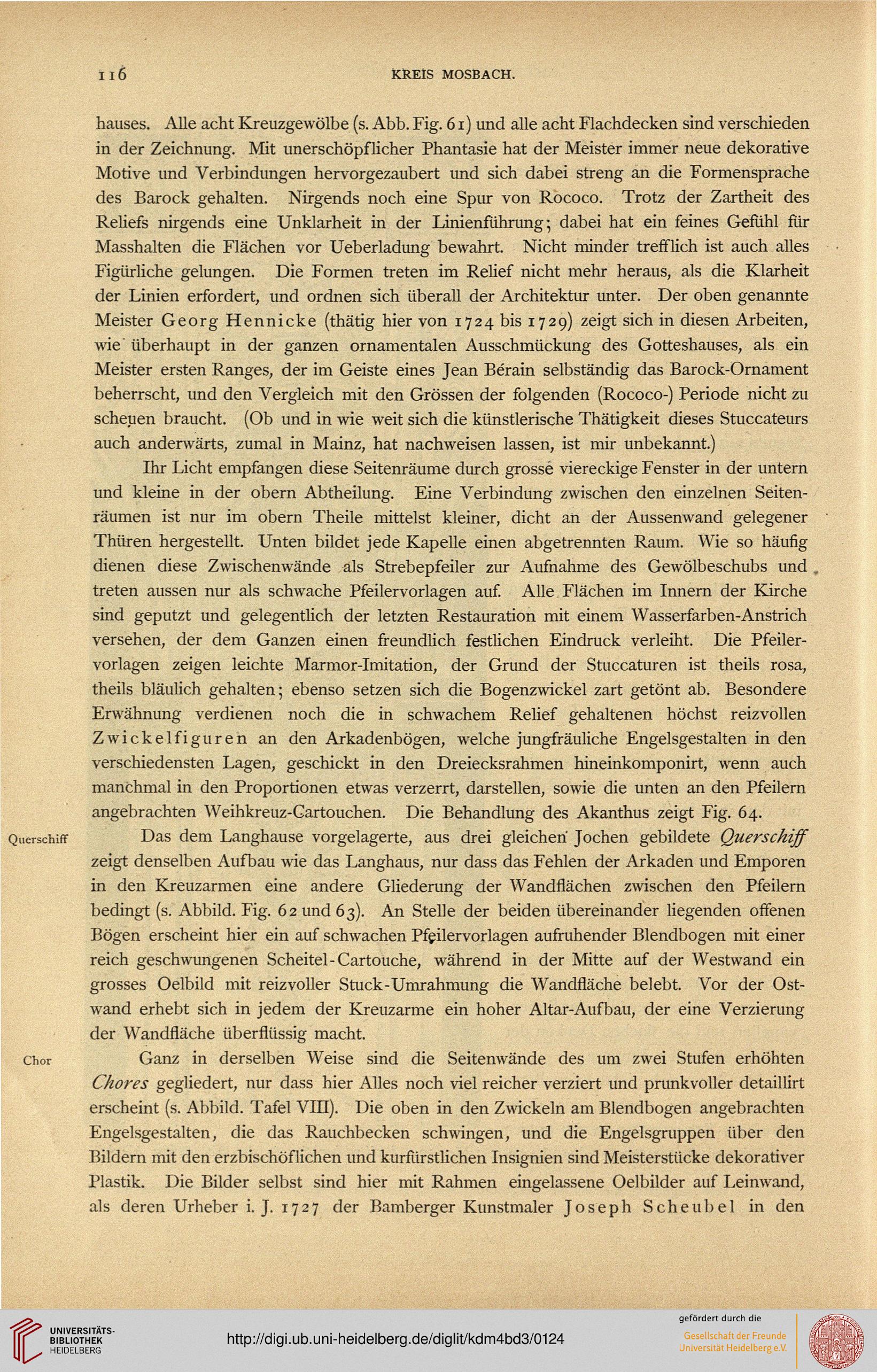I I 6 KREIS MOSBACH.
hauses. Alle acht Kreuzgewölbe (s. Abb. Fig. 61) und alle acht Flachdecken sind verschieden
in der Zeichnung. Mit unerschöpflicher Phantasie hat der Meister immer neue dekorative
Motive und Verbindungen hervorgezaubert und sich dabei streng an die Formensprache
des Barock gehalten. Nirgends noch eine Spur von Rococo. Trotz der Zartheit des
Reliefs nirgends eine Unklarheit in der Linienführung; dabei hat ein feines Gefühl für
Masshalten die Flächen vor Ueberladung bewahrt. Nicht minder trefflich ist auch alles
Figürliche gelungen. Die Formen treten im Relief nicht mehr heraus, als die Klarheit
der Linien erfordert, und ordnen sich überall der Architektur unter. Der oben genannte
Meister Georg Hennicke (thätig hier von 1724 bis 1729) zeigt sich in diesen Arbeiten,
wie' überhaupt in der ganzen ornamentalen Ausschmückung des Gotteshauses, als ein
Meister ersten Ranges, der im Geiste eines Jean Berain selbständig das Barock-Ornament
beherrscht, und den Vergleich mit den Grössen der folgenden (Rococo-) Periode nicht zu
scheuen braucht. (Ob und in wie weit sich die künstlerische Thätigkeit dieses Stuccateurs
auch anderwärts, zumal in Mainz, hat nachweisen lassen, ist mir unbekannt.)
Ihr Licht empfangen diese Seitenräume durch grosse viereckige Fenster in der untern
und kleine in der obern Abtheilung. Eine Verbindung zwischen den einzelnen Seiten-
räumen ist nur im obern Theile mittelst kleiner, dicht an der Aussenwand gelegener
Thüren hergestellt. Unten bildet jede Kapelle einen abgetrennten Raum. Wie so häufig
dienen diese Zwischenwände als Strebepfeiler zur Aufnahme des Gewölbeschubs und .
treten aussen nur als schwache Pfeilervorlagen auf. Alle Flächen im Innern der Kirche
sind geputzt und gelegentlich der letzten Restauration mit einem Wasserfarben-Anstrich
versehen, der dem Ganzen einen freundlich festlichen Eindruck verleiht. Die Pfeiler-
vorlagen zeigen leichte Marmor-Imitation, der Grund der Stuccaturen ist theils rosa,
theils bläulich gehalten; ebenso setzen sich die Bogenzwickel zart getönt ab. Besondere
Erwähnung verdienen noch die in schwachem Relief gehaltenen höchst reizvollen
Zwickelfiguren an den Arkadenbögen, welche jungfräuliche Engelsgestalten in den
verschiedensten Lagen, geschickt in den Dreiecksrahmen hineinkomponirt, wenn auch
manchmal in den Proportionen etwas verzerrt, darstellen, sowie die unten an den Pfeilern
angebrachten Weihkreuz-Cartouchen. Die Behandlung des Akanthus zeigt Fig. 64.
inerschiff Das dem Langhause vorgelagerte, aus drei gleichen Jochen gebildete Querschiff
zeigt denselben Aufbau wie das Langhaus, nur dass das Fehlen der Arkaden und Emporen
in den Kreuzarmen eine andere Gliederung der Wandflächen zwischen den Pfeilern
bedingt (s. Abbild. Fig. 62 und 63). An Stelle der beiden übereinander liegenden offenen
Bögen erscheint hier ein auf schwachen Pfeilervorlagen aufruhender Blendbogen mit einer
reich geschwungenen Scheitel-Cartouche, während in der Mitte auf der Westwand ein
grosses Oelbild mit reizvoller Stuck-Umrahmung die Wandfläche belebt. Vor der Ost-
wand erhebt sich in jedem der Kreuzarme ein hoher Altar-Aufbau, der eine Verzierung
der Wandfläche überflüssig macht.
Chor Ganz in derselben Weise sind die Seitenwände des um zwei Stufen erhöhten
Chores gegliedert, nur dass hier Alles noch viel reicher verziert und prunkvoller detaillirt
erscheint (s. Abbild. Tafel VIII). Die oben in den Zwickeln am Blendbogen angebrachten
Engelsgestalten, die das Rauchbecken schwingen, und die Engelsgruppen über den
Bildern mit den erzbischöflichen und kurfürstlichen Insignien sind Meisterstücke dekorativer
Plastik. Die Bilder selbst sind hier mit Rahmen eingelassene Oelbilder auf Leinwand,
als deren Urheber i. J. 1727 der Bamberger Kunstmaler Joseph Scheubel in den
hauses. Alle acht Kreuzgewölbe (s. Abb. Fig. 61) und alle acht Flachdecken sind verschieden
in der Zeichnung. Mit unerschöpflicher Phantasie hat der Meister immer neue dekorative
Motive und Verbindungen hervorgezaubert und sich dabei streng an die Formensprache
des Barock gehalten. Nirgends noch eine Spur von Rococo. Trotz der Zartheit des
Reliefs nirgends eine Unklarheit in der Linienführung; dabei hat ein feines Gefühl für
Masshalten die Flächen vor Ueberladung bewahrt. Nicht minder trefflich ist auch alles
Figürliche gelungen. Die Formen treten im Relief nicht mehr heraus, als die Klarheit
der Linien erfordert, und ordnen sich überall der Architektur unter. Der oben genannte
Meister Georg Hennicke (thätig hier von 1724 bis 1729) zeigt sich in diesen Arbeiten,
wie' überhaupt in der ganzen ornamentalen Ausschmückung des Gotteshauses, als ein
Meister ersten Ranges, der im Geiste eines Jean Berain selbständig das Barock-Ornament
beherrscht, und den Vergleich mit den Grössen der folgenden (Rococo-) Periode nicht zu
scheuen braucht. (Ob und in wie weit sich die künstlerische Thätigkeit dieses Stuccateurs
auch anderwärts, zumal in Mainz, hat nachweisen lassen, ist mir unbekannt.)
Ihr Licht empfangen diese Seitenräume durch grosse viereckige Fenster in der untern
und kleine in der obern Abtheilung. Eine Verbindung zwischen den einzelnen Seiten-
räumen ist nur im obern Theile mittelst kleiner, dicht an der Aussenwand gelegener
Thüren hergestellt. Unten bildet jede Kapelle einen abgetrennten Raum. Wie so häufig
dienen diese Zwischenwände als Strebepfeiler zur Aufnahme des Gewölbeschubs und .
treten aussen nur als schwache Pfeilervorlagen auf. Alle Flächen im Innern der Kirche
sind geputzt und gelegentlich der letzten Restauration mit einem Wasserfarben-Anstrich
versehen, der dem Ganzen einen freundlich festlichen Eindruck verleiht. Die Pfeiler-
vorlagen zeigen leichte Marmor-Imitation, der Grund der Stuccaturen ist theils rosa,
theils bläulich gehalten; ebenso setzen sich die Bogenzwickel zart getönt ab. Besondere
Erwähnung verdienen noch die in schwachem Relief gehaltenen höchst reizvollen
Zwickelfiguren an den Arkadenbögen, welche jungfräuliche Engelsgestalten in den
verschiedensten Lagen, geschickt in den Dreiecksrahmen hineinkomponirt, wenn auch
manchmal in den Proportionen etwas verzerrt, darstellen, sowie die unten an den Pfeilern
angebrachten Weihkreuz-Cartouchen. Die Behandlung des Akanthus zeigt Fig. 64.
inerschiff Das dem Langhause vorgelagerte, aus drei gleichen Jochen gebildete Querschiff
zeigt denselben Aufbau wie das Langhaus, nur dass das Fehlen der Arkaden und Emporen
in den Kreuzarmen eine andere Gliederung der Wandflächen zwischen den Pfeilern
bedingt (s. Abbild. Fig. 62 und 63). An Stelle der beiden übereinander liegenden offenen
Bögen erscheint hier ein auf schwachen Pfeilervorlagen aufruhender Blendbogen mit einer
reich geschwungenen Scheitel-Cartouche, während in der Mitte auf der Westwand ein
grosses Oelbild mit reizvoller Stuck-Umrahmung die Wandfläche belebt. Vor der Ost-
wand erhebt sich in jedem der Kreuzarme ein hoher Altar-Aufbau, der eine Verzierung
der Wandfläche überflüssig macht.
Chor Ganz in derselben Weise sind die Seitenwände des um zwei Stufen erhöhten
Chores gegliedert, nur dass hier Alles noch viel reicher verziert und prunkvoller detaillirt
erscheint (s. Abbild. Tafel VIII). Die oben in den Zwickeln am Blendbogen angebrachten
Engelsgestalten, die das Rauchbecken schwingen, und die Engelsgruppen über den
Bildern mit den erzbischöflichen und kurfürstlichen Insignien sind Meisterstücke dekorativer
Plastik. Die Bilder selbst sind hier mit Rahmen eingelassene Oelbilder auf Leinwand,
als deren Urheber i. J. 1727 der Bamberger Kunstmaler Joseph Scheubel in den