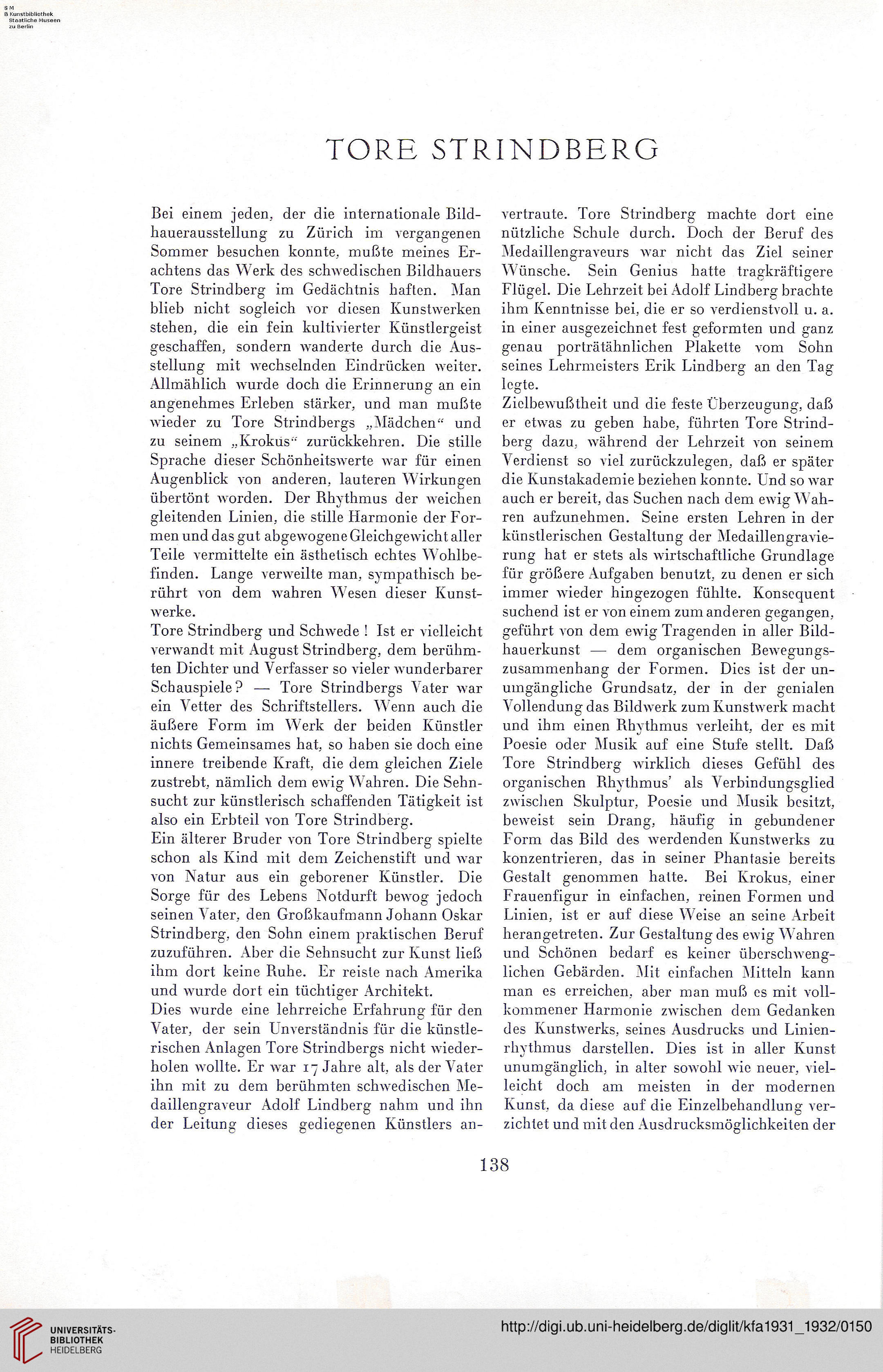TORE STRINDBERG
Bei einem jeden, der die internationale Bild-
hauerausstellung zu Zürich im vergangenen
Sommer besuchen konnte, mußte meines Er-
achtens das Werk des schwedischen Bildhauers
Tore Strindberg im Gedächtnis haften. Man
blieb nicht sogleich vor diesen Kunstwerken
stehen, die ein fein kultivierter Künstlergeist
geschaffen, sondern wanderte durch die Aus-
stellung mit wechselnden Eindrücken weiter.
Allmählich wurde doch die Erinnerung an ein
angenehmes Erleben stärker, und man mußte
wieder zu Tore Strindbergs „Mädchen" und
zu seinem „Krokus-- zurückkehren. Die stille
Sprache dieser Schönheitswerte war für einen
Augenblick von anderen, lauteren Wirkungen
übertönt worden. Der Rhythmus der weichen
gleitenden Linien, die stille Harmonie der For-
men und das gut abgewogene Gleichgewicht aller
Teile vermittelte ein ästhetisch echtes Wohlbe-
finden. Lange verweilte man, sympathisch be-
rührt von dem wahren W esen dieser Kunst-
werke.
Tore Strindberg und Schwede ! Ist er vielleicht
verwandt mit August Strindberg, dem berühm-
ten Dichter und Verfasser so vieler wunderbarer
Schauspiele? — Tore Strindbergs Vater war
ein ^ etter des Schriftstellers. W enn auch die
äußere Form im Werk der beiden Künstler
nichts Gemeinsames hat, so haben sie doch eine
innere treibende Kraft, die dem gleichen Ziele
zustrebt, nämlich dem ewig Wahren. Die Sehn-
sucht zur künstlerisch schaffenden Tätigkeit ist
also ein Erbteil von Tore Strindberg.
Ein älterer Bruder von Tore Strindberg spielte
schon als Kind mit dem Zeichenstift und war
von Natur aus ein geborener Künstler. Die
Sorge für des Lebens Notdurft bewog jedoch
seinen Vater, den Großkaufmann Johann Oskar
Strindberg, den Sohn einem praktischen Beruf
zuzuführen. Aber die Sehnsucht zur Kunst ließ
ihm dort keine Ruhe. Er reiste nach Amerika
und wurde dort ein tüchtiger Architekt.
Dies wurde eine lehrreiche Erfahrung für den
Vater, der sein Lnverständnis für die künstle-
rischen Anlagen Tore Strindbergs nicht wieder-
holen wollte. Er war 17 Jahre alt, als der Vater
ihn mit zu dem berühmten schwedischen Me-
daillengraveur Adolf Lindberg nahm und ihn
der Leitung dieses gediegenen Künstlers an-
vertraute. Tore Strindberg machte dort eine
nützliche Schule durch. Doch der Beruf des
Medaillengraveurs war nicht das Ziel seiner
W ünsche. Sein Genius hatte tragkräftigere
Flügel. Die Lehrzeit bei Adolf Lindberg brachte
ihm Kenntnisse bei, die er so verdienstvoll u. a.
in einer ausgezeichnet fest geformten und aranz
o o c
genau porträtähnlichen Plakette vom Sohn
seines Lehrmeisters Erik Lindberg an den Tag
legte.
Zielbewußtheit und die feste Überzeugung, daß
er etwas zu geben habe, führten Tore Strind-
berg dazu, während der Lehrzeit von seinem
Verdienst so viel zurückzulegen, daß er später
die Kunstakademie beziehen konnte. Und so war
auch er bereit, das Suchen nach dem ewig Wah-
ren aufzunehmen. Seine ersten Lehren in der
künstlerischen Gestaltung der Medaillengravie-
rung hat er stets als wirtschaftliche Grundlage
für größere Aufgaben benutzt, zu denen er sich
immer wieder hingezogen fühlte. Konsequent
suchend ist er von einem zum anderen cesangen.
geführt von dem ewig Tragenden in aller Bild-
hauerkunst — dem organischen Bewegungs-
zusammenhang der Formen. Dies ist der un-
umgängliche Grundsatz, der in der genialen
Vollendung das Bildwerk zum Kunstwerk macht
und ihm einen Rhythmus verleiht, der es mit
Poesie oder Musik auf eine Stufe stellt. Daß
Tore Strindberg wirklich dieses Gefühl des
organischen Rhythmus' als Verbindungsglied
zwischen Skulptur, Poesie und Musik besitzt,
beweist sein Drang, häufig in gebundener
Form das Bild des werdenden Kunstwerks zu
konzentrieren, das in seiner Phantasie bereits
Gestalt genommen hatte. Bei Krokus, einer
Frauenfigur in einfachen, reinen Formen und
Linien, ist er auf diese Weise an seine Arbeit
herangetreten. Zur Gestaltung des ewig Wahren
und Schönen bedarf es keiner überschweng-
lichen Gebärden. Mit einfachen Mitteln kann
man es erreichen, aber man muß es mit voll-
kommener Harmonie zwischen dem Gedanken
des Kunstwerks, seines Ausdrucks und Linien-
rhythmus darstellen. Dies ist in aller Kunst
unumgänglich, in alter sowohl wie neuer, viel-
leicht doch am meisten in der modernen
Kunst, da diese auf die Einzelbehandlung ver-
zichtet und mit den Ausdrucksmöglichkeiten der
138
Bei einem jeden, der die internationale Bild-
hauerausstellung zu Zürich im vergangenen
Sommer besuchen konnte, mußte meines Er-
achtens das Werk des schwedischen Bildhauers
Tore Strindberg im Gedächtnis haften. Man
blieb nicht sogleich vor diesen Kunstwerken
stehen, die ein fein kultivierter Künstlergeist
geschaffen, sondern wanderte durch die Aus-
stellung mit wechselnden Eindrücken weiter.
Allmählich wurde doch die Erinnerung an ein
angenehmes Erleben stärker, und man mußte
wieder zu Tore Strindbergs „Mädchen" und
zu seinem „Krokus-- zurückkehren. Die stille
Sprache dieser Schönheitswerte war für einen
Augenblick von anderen, lauteren Wirkungen
übertönt worden. Der Rhythmus der weichen
gleitenden Linien, die stille Harmonie der For-
men und das gut abgewogene Gleichgewicht aller
Teile vermittelte ein ästhetisch echtes Wohlbe-
finden. Lange verweilte man, sympathisch be-
rührt von dem wahren W esen dieser Kunst-
werke.
Tore Strindberg und Schwede ! Ist er vielleicht
verwandt mit August Strindberg, dem berühm-
ten Dichter und Verfasser so vieler wunderbarer
Schauspiele? — Tore Strindbergs Vater war
ein ^ etter des Schriftstellers. W enn auch die
äußere Form im Werk der beiden Künstler
nichts Gemeinsames hat, so haben sie doch eine
innere treibende Kraft, die dem gleichen Ziele
zustrebt, nämlich dem ewig Wahren. Die Sehn-
sucht zur künstlerisch schaffenden Tätigkeit ist
also ein Erbteil von Tore Strindberg.
Ein älterer Bruder von Tore Strindberg spielte
schon als Kind mit dem Zeichenstift und war
von Natur aus ein geborener Künstler. Die
Sorge für des Lebens Notdurft bewog jedoch
seinen Vater, den Großkaufmann Johann Oskar
Strindberg, den Sohn einem praktischen Beruf
zuzuführen. Aber die Sehnsucht zur Kunst ließ
ihm dort keine Ruhe. Er reiste nach Amerika
und wurde dort ein tüchtiger Architekt.
Dies wurde eine lehrreiche Erfahrung für den
Vater, der sein Lnverständnis für die künstle-
rischen Anlagen Tore Strindbergs nicht wieder-
holen wollte. Er war 17 Jahre alt, als der Vater
ihn mit zu dem berühmten schwedischen Me-
daillengraveur Adolf Lindberg nahm und ihn
der Leitung dieses gediegenen Künstlers an-
vertraute. Tore Strindberg machte dort eine
nützliche Schule durch. Doch der Beruf des
Medaillengraveurs war nicht das Ziel seiner
W ünsche. Sein Genius hatte tragkräftigere
Flügel. Die Lehrzeit bei Adolf Lindberg brachte
ihm Kenntnisse bei, die er so verdienstvoll u. a.
in einer ausgezeichnet fest geformten und aranz
o o c
genau porträtähnlichen Plakette vom Sohn
seines Lehrmeisters Erik Lindberg an den Tag
legte.
Zielbewußtheit und die feste Überzeugung, daß
er etwas zu geben habe, führten Tore Strind-
berg dazu, während der Lehrzeit von seinem
Verdienst so viel zurückzulegen, daß er später
die Kunstakademie beziehen konnte. Und so war
auch er bereit, das Suchen nach dem ewig Wah-
ren aufzunehmen. Seine ersten Lehren in der
künstlerischen Gestaltung der Medaillengravie-
rung hat er stets als wirtschaftliche Grundlage
für größere Aufgaben benutzt, zu denen er sich
immer wieder hingezogen fühlte. Konsequent
suchend ist er von einem zum anderen cesangen.
geführt von dem ewig Tragenden in aller Bild-
hauerkunst — dem organischen Bewegungs-
zusammenhang der Formen. Dies ist der un-
umgängliche Grundsatz, der in der genialen
Vollendung das Bildwerk zum Kunstwerk macht
und ihm einen Rhythmus verleiht, der es mit
Poesie oder Musik auf eine Stufe stellt. Daß
Tore Strindberg wirklich dieses Gefühl des
organischen Rhythmus' als Verbindungsglied
zwischen Skulptur, Poesie und Musik besitzt,
beweist sein Drang, häufig in gebundener
Form das Bild des werdenden Kunstwerks zu
konzentrieren, das in seiner Phantasie bereits
Gestalt genommen hatte. Bei Krokus, einer
Frauenfigur in einfachen, reinen Formen und
Linien, ist er auf diese Weise an seine Arbeit
herangetreten. Zur Gestaltung des ewig Wahren
und Schönen bedarf es keiner überschweng-
lichen Gebärden. Mit einfachen Mitteln kann
man es erreichen, aber man muß es mit voll-
kommener Harmonie zwischen dem Gedanken
des Kunstwerks, seines Ausdrucks und Linien-
rhythmus darstellen. Dies ist in aller Kunst
unumgänglich, in alter sowohl wie neuer, viel-
leicht doch am meisten in der modernen
Kunst, da diese auf die Einzelbehandlung ver-
zichtet und mit den Ausdrucksmöglichkeiten der
138