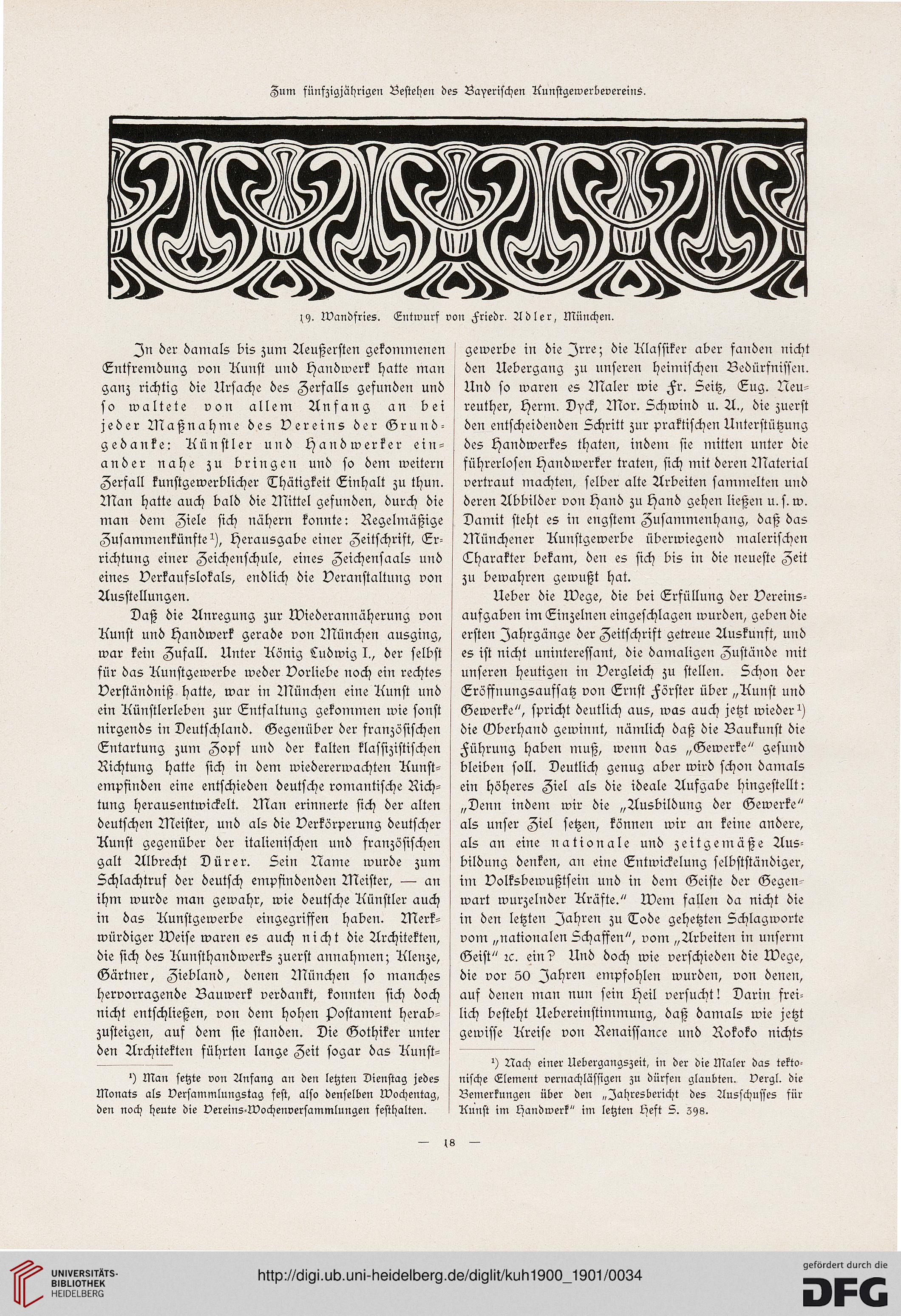Juni fünfzigjährigen Bestehen des Bayerischen AunstgewerbevereinS.
\o>. Wandfries. Entwurf non Friedr. Adler, München.
In der daiirals bis zum Aeußersten gekommenen
Entfremdung von Aunst und Handwerk hatte man
ganz richtig die Ursache des Zerfalls gefunden und
so waltete von alle in Anfang an bei
jeder Maßnahme des Vereins der Grund-
gedanke: Künstler und Handwerker ein-
ander nahe zu bringen und fo dem weitern
Zerfall kunstgewerblicher Thätigkeit Einhalt zu thun.
Alan hatte auch bald die Mittel gefunden, durch die
man den: Ziele sich nähern konnte: Regelmäßige
Zusammenkünfte^), Herausgabe einer Zeitschrift, Er-
richtung einer Zeichenschule, eines Zeichensaals und
eines Verkaufslokals, eitdlich die Veranstaltung von
Ausstellungen.
Daß die Anregung zur Wiederannäherung von
Aunst uitd Handwerk gerade von München ausgiilg,
war keilt Zufall. Unter Aönig Ludwig I., der selbst
für das Auustgewerbe weder Vorliebe noch ein rechtes
verständniß hatte, war in München eine Aunst und
ein Aünstlerleben zur Eittfaltuitg gekommen wie sollst
nirgends in Deutschland. Gegenüber der französischen
Entartung zum Zopf und der kalten klassizistischen
Richtung hatte sich ili dem wiedererwachten Aunst-
empfinden eine entschieden deutsche romantische Rich-
tung herausentwickelt. Man erinnerte sich der alten
deutschen Meister, und als die Verkörperung deutscher
Auilst gegenüber der italienischeil uild französischen
galt Albrecht Dürer. Sein Name wurde zum
Schlachtruf der deutsch empfindenden Meister, — an
ihm wurde man gewahr, wie deutsche Aünstler auch
in das Aunstgewerbe eingegriffen haben. Merk-
würdiger Weife waren es auch nicht die Architekten,
die sich des Aunsthandwerks zuerst aunahmen; Alenze,
Gärtner, Ziebland, denen München so manches
hervorragende Bauwerk verdankt, konnten sich doch
nicht entschließen, von dem hohen Postament herab-
zusteigen, auf dem sie standen. Die Gothiker unter
den Architekten führten lange Zeit sogar das Aunst-
') Man setzte von Anfang an den letzten Dienstag jedes
Monats als versammlungstag fest, also denselben Wochentag,
den noch heute die Vereins-Wochenversammlungen festhalten.
gewerbe in die Zrre; die Alassiker aber fanden nicht
den Aebergailg zu unseren heimischen Bedürfnissen.
And so waren es Maler wie Fr. Seitz, Eug. Neu-
reuther, Perm. Dyck, Mor. Schwind u. A., die zuerst
den entscheidenden Schritt zur praktischen Anterstützung
des pandwerkes thaten, indem sie mitten unter die
führerlosen pandwerker traten, sich mit deren Material
vertraut machten, selber alte Arbeiten sammelten und
deren Abbilder von pand zu pand gehen ließen u.s. w.
Damit steht es in engstem Zusammenhang, daß das
Münchener Aunstgewerbe überwiegend iilalerischen
Charakter bekam, deli es sich bis in die neueste Zeit
zu bewahren gewußt hat.
Aeber die Wege, die bei Erfüllung der Vereins-
aufgaben im Einzelnen eingeschlagen wurden, geben die
ersten Jahrgänge der Zeitschrift getreue Auskunft, und
es ist ilicht uninteressant, die damaligen Zustände mit
unseren heutigen in Vergleich zu stellen. Schon der
Eröffnungsaufsatz von Ernst Förster über „Aunst und
Gewerke", spricht deutlich aus, was auch jetzt wieder^)
die Oberhand gewinnt, nänrlich daß die Baukunst die
Führung haben muß, wenn das „Gewerke" gesund
bleiben soll. Deutlich genug aber wird schon damals
ein höheres Ziel als die ideale Ausgabe hingestellt:
„Denn indem wir die „Ausbildung der Gewerke"
als unser Ziel setzen, können wir an keine andere,
als an eine nationale und zeitgemäße Aus-
bildung denken, an eine Entwickelung selbstständiger,
im Volksbewußtsein und in dem Geiste der Gegen
wart wurzelnder Kräfte." Wem fallen da nicht die
in den letzten Jahren zu Tode gehetzten Schlagworte
vom „nationalen Schaffen", vom „Arbeiten in unfern:
Geist" rc. ein? And doch wie verschieden die Wege,
die vor 50 Zähren empfohlen wurden, von denen,
auf deneu man nun sein peil versucht! Darin frei-
lich besteht Aebereinftimmung, daß damals wie jetzt
gewisse Areise von Renaissance und Rokoko nichts
i) Nach einer Aebergangszeit, in der die Maler das tekto-
nische Element vernachlässigen zu dürfen glaubten, vergl. die
Bemerkungen über den „Jahresbericht des Ausschusses für
Aunst im thandwerk" im letzten ffeft S. 398.
»8
\o>. Wandfries. Entwurf non Friedr. Adler, München.
In der daiirals bis zum Aeußersten gekommenen
Entfremdung von Aunst und Handwerk hatte man
ganz richtig die Ursache des Zerfalls gefunden und
so waltete von alle in Anfang an bei
jeder Maßnahme des Vereins der Grund-
gedanke: Künstler und Handwerker ein-
ander nahe zu bringen und fo dem weitern
Zerfall kunstgewerblicher Thätigkeit Einhalt zu thun.
Alan hatte auch bald die Mittel gefunden, durch die
man den: Ziele sich nähern konnte: Regelmäßige
Zusammenkünfte^), Herausgabe einer Zeitschrift, Er-
richtung einer Zeichenschule, eines Zeichensaals und
eines Verkaufslokals, eitdlich die Veranstaltung von
Ausstellungen.
Daß die Anregung zur Wiederannäherung von
Aunst uitd Handwerk gerade von München ausgiilg,
war keilt Zufall. Unter Aönig Ludwig I., der selbst
für das Auustgewerbe weder Vorliebe noch ein rechtes
verständniß hatte, war in München eine Aunst und
ein Aünstlerleben zur Eittfaltuitg gekommen wie sollst
nirgends in Deutschland. Gegenüber der französischen
Entartung zum Zopf und der kalten klassizistischen
Richtung hatte sich ili dem wiedererwachten Aunst-
empfinden eine entschieden deutsche romantische Rich-
tung herausentwickelt. Man erinnerte sich der alten
deutschen Meister, und als die Verkörperung deutscher
Auilst gegenüber der italienischeil uild französischen
galt Albrecht Dürer. Sein Name wurde zum
Schlachtruf der deutsch empfindenden Meister, — an
ihm wurde man gewahr, wie deutsche Aünstler auch
in das Aunstgewerbe eingegriffen haben. Merk-
würdiger Weife waren es auch nicht die Architekten,
die sich des Aunsthandwerks zuerst aunahmen; Alenze,
Gärtner, Ziebland, denen München so manches
hervorragende Bauwerk verdankt, konnten sich doch
nicht entschließen, von dem hohen Postament herab-
zusteigen, auf dem sie standen. Die Gothiker unter
den Architekten führten lange Zeit sogar das Aunst-
') Man setzte von Anfang an den letzten Dienstag jedes
Monats als versammlungstag fest, also denselben Wochentag,
den noch heute die Vereins-Wochenversammlungen festhalten.
gewerbe in die Zrre; die Alassiker aber fanden nicht
den Aebergailg zu unseren heimischen Bedürfnissen.
And so waren es Maler wie Fr. Seitz, Eug. Neu-
reuther, Perm. Dyck, Mor. Schwind u. A., die zuerst
den entscheidenden Schritt zur praktischen Anterstützung
des pandwerkes thaten, indem sie mitten unter die
führerlosen pandwerker traten, sich mit deren Material
vertraut machten, selber alte Arbeiten sammelten und
deren Abbilder von pand zu pand gehen ließen u.s. w.
Damit steht es in engstem Zusammenhang, daß das
Münchener Aunstgewerbe überwiegend iilalerischen
Charakter bekam, deli es sich bis in die neueste Zeit
zu bewahren gewußt hat.
Aeber die Wege, die bei Erfüllung der Vereins-
aufgaben im Einzelnen eingeschlagen wurden, geben die
ersten Jahrgänge der Zeitschrift getreue Auskunft, und
es ist ilicht uninteressant, die damaligen Zustände mit
unseren heutigen in Vergleich zu stellen. Schon der
Eröffnungsaufsatz von Ernst Förster über „Aunst und
Gewerke", spricht deutlich aus, was auch jetzt wieder^)
die Oberhand gewinnt, nänrlich daß die Baukunst die
Führung haben muß, wenn das „Gewerke" gesund
bleiben soll. Deutlich genug aber wird schon damals
ein höheres Ziel als die ideale Ausgabe hingestellt:
„Denn indem wir die „Ausbildung der Gewerke"
als unser Ziel setzen, können wir an keine andere,
als an eine nationale und zeitgemäße Aus-
bildung denken, an eine Entwickelung selbstständiger,
im Volksbewußtsein und in dem Geiste der Gegen
wart wurzelnder Kräfte." Wem fallen da nicht die
in den letzten Jahren zu Tode gehetzten Schlagworte
vom „nationalen Schaffen", vom „Arbeiten in unfern:
Geist" rc. ein? And doch wie verschieden die Wege,
die vor 50 Zähren empfohlen wurden, von denen,
auf deneu man nun sein peil versucht! Darin frei-
lich besteht Aebereinftimmung, daß damals wie jetzt
gewisse Areise von Renaissance und Rokoko nichts
i) Nach einer Aebergangszeit, in der die Maler das tekto-
nische Element vernachlässigen zu dürfen glaubten, vergl. die
Bemerkungen über den „Jahresbericht des Ausschusses für
Aunst im thandwerk" im letzten ffeft S. 398.
»8