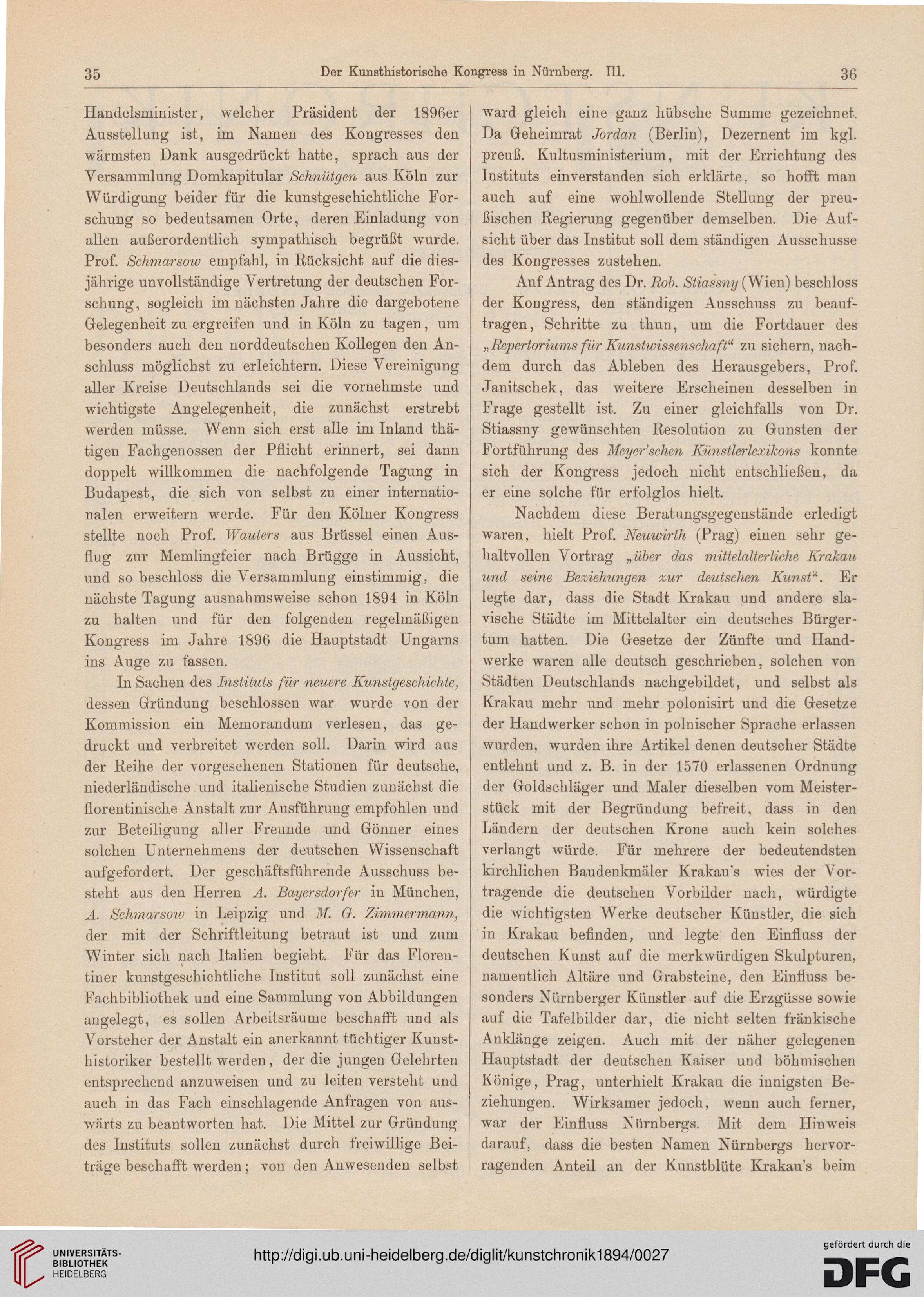35
36
Handelsininister, welcher Präsident der 1896er
Ausstellung ist, im Namen des Kongresses den
wärmsten Dank ausgedrückt hatte, sprach aus der
Versammlung Domkapitular Schnütgen aus Köln zur
Würdigung beider für die kunstgeschichtliche For-
schung so bedeutsamen Orte, deren Einladung von
allen außerordentlich sympathisch begrüßt wurde.
Prof. Schmarsow empfahl, in Rücksicht auf die dies-
jährige unvollständige Vertretung der deutschen For-
schung, sogleich im nächsten Jahre die dargebotene
Gelegenheit zu ergreifen und in Köln zu tagen, um
besonders auch den norddeutschen Kollegen den An-
schluss möglichst zu erleichtern. Diese Vereinigung
aller Kreise Deutschlands sei die vornehmste und
wichtigste Angelegenheit, die zunächst erstrebt
werden müsse. Wenn sich erst alle im Inland thä-
tigen Fachgenossen der Pflicht erinnert, sei dann
doppelt willkommen die nachfolgende Tagung in
Budapest, die sich von selbst zu einer internatio-
nalen erweitern werde. Für den Kölner Kongress
stellte noch Prof. Wauters aus Brüssel einen Aus-
flug zur Memlingfeier nach Brügge in Aussicht,
und so beschloss die Versammlung einstimmig, die
nächste Tagung ausnahmsweise schon 1894 in Köln
zu halten und für den folgenden regelmäßigen
Kongress im Jahre 1896 die Hauptstadt Ungarns
ins Auge zu fassen.
In Sachen des Instituts für neuere Kunstgeschichte,
dessen Gründung beschlossen war wurde von der
Kommission ein Memorandum verlesen, das ge-
druckt und verbreitet werden soll. Darin wird aus
der Reihe der vorgesehenen Stationen für deutsche,
niederländische und italienische Studien zunächst die
florentinische Anstalt zur Ausführung empfohlen und
zur Beteiligung aller Freunde und Gönner eines
solchen Unternehmens der deutschen Wissenschaft
aufgefordert. Der geschäftsführende Ausschuss be-
steht aus den Herren A. Bayersdorfer in München,
A. Schmarsow in Leipzig und M. G. Zimmermann,
der mit der Schriftleitung betraut ist und zum
Winter sich nach Italien begiebt. Für das Floren-
tiner kunstgeschichtliche Institut soll zunächst eine
Fachbibliothek und eine Sammlung von Abbildungen
angelegt, es sollen Arbeitsräume beschafft und als
Vorsteher der Anstalt ein anerkannt tüchtiger Kunst-
historiker bestellt werden, der die jungen Gelehrten
entsprechend anzuweisen und zu leiten versteht und
auch in das Fach einschlagende Anfragen von aus-
wärts zu beantworten hat. Die Mittel zur Gründung
des Instituts sollen zunächst durch freiwillige Bei-
träge beschafft werden; von den Anwesenden selbst
ward gleich eine ganz hübsche Summe gezeichnet.
Da Geheimrat Jordan (Berlin), Dezernent im kgl.
preuß. Kultusministerium, mit der Errichtung des
Instituts einverstanden sich erklärte, so hofft man
auch auf eine wohlwollende Stellung der preu-
ßischen Regierung gegenüber demselben. Die Auf-
sicht über das Institut soll dem ständigen Ausschusse
des Kongresses zustehen.
Auf Antrag des Dr. Bob. Stiassny (Wien) beschloss
der Kongress, den ständigen Ausschuss zu beauf-
tragen, Schritte zu thun, um die Fortdauer des
„ Repertoriums für Kunstwissenschaft1' zu sichern, nach-
dem durch das Ableben des Herausgebers, Prof.
Janitschek, das weitere Erscheinen desselben in
Frage gestellt ist. Zu einer gleichfalls von Dr.
Stiassny gewünschten Resolution zu Gunsten der
Fortführung des Meyer'schen Künstlerlexikons konnte
sich der Kongress jedoch nicht entschließen, da
er eine solche für erfolglos hielt.
Nachdem diese Beratungsgegenstände erledigt
waren, hielt Prof. Neuwirth (Prag) einen sehr ge-
haltvollen Vortrag „über das mittelalterliche Krdliau
und seine Beziehungen zur deutschen Kunst". Er
legte dar, dass die Stadt Krakau und andere sla-
vische Städte im Mittelalter ein deutsches Bürger-
tum hatten. Die Gesetze der Zünfte und Hand-
werke waren alle deutsch geschrieben, solchen von
Städten Deutschlands nachgebildet, und selbst als
Krakau mehr und mehr polonisirt und die Gesetze
der Handwerker schon in polnischer Sprache erlassen
wurden, wurden ihre Artikel denen deutscher Städte
entlehnt und z. B. in der 1570 erlassenen Ordnung
der Goldschläger und Maler dieselben vom Meister-
stück mit der Begründung befreit, dass in den
Ländern der deutschen Krone auch kein solches
verlangt würde. Für mehrere der bedeutendsten
kirchlichen Baudenkmäler Krakau's wies der Vor-
tragende die deutschen Vorbilder nach, würdigte
die wichtigsten Werke deutscher Künstler, die sich
in Krakau befinden, und legte den Einfluss der
deutschen Kunst auf die merkwürdigen Skulpturen,
namentlich Altäre und Grabsteine, den Einfluss be-
sonders Nürnberger Künstler auf die Erzgüsse sowie
auf die Tafelbilder dar, die nicht selten fränkische
Anklänge zeigen. Auch mit der näher gelegenen
Hauptstadt der deutschen Kaiser und böhmischen
Könige, Prag, unterhielt Krakau die innigsten Be-
ziehungen. Wirksamer jedoch, wenn auch ferner,
war der Einfluss Nürnbergs. Mit dem Hinweis
darauf, dass die besten Namen Nürnbergs hervor-
ragenden Anteil an der Kunstblüte Krakau's beim
36
Handelsininister, welcher Präsident der 1896er
Ausstellung ist, im Namen des Kongresses den
wärmsten Dank ausgedrückt hatte, sprach aus der
Versammlung Domkapitular Schnütgen aus Köln zur
Würdigung beider für die kunstgeschichtliche For-
schung so bedeutsamen Orte, deren Einladung von
allen außerordentlich sympathisch begrüßt wurde.
Prof. Schmarsow empfahl, in Rücksicht auf die dies-
jährige unvollständige Vertretung der deutschen For-
schung, sogleich im nächsten Jahre die dargebotene
Gelegenheit zu ergreifen und in Köln zu tagen, um
besonders auch den norddeutschen Kollegen den An-
schluss möglichst zu erleichtern. Diese Vereinigung
aller Kreise Deutschlands sei die vornehmste und
wichtigste Angelegenheit, die zunächst erstrebt
werden müsse. Wenn sich erst alle im Inland thä-
tigen Fachgenossen der Pflicht erinnert, sei dann
doppelt willkommen die nachfolgende Tagung in
Budapest, die sich von selbst zu einer internatio-
nalen erweitern werde. Für den Kölner Kongress
stellte noch Prof. Wauters aus Brüssel einen Aus-
flug zur Memlingfeier nach Brügge in Aussicht,
und so beschloss die Versammlung einstimmig, die
nächste Tagung ausnahmsweise schon 1894 in Köln
zu halten und für den folgenden regelmäßigen
Kongress im Jahre 1896 die Hauptstadt Ungarns
ins Auge zu fassen.
In Sachen des Instituts für neuere Kunstgeschichte,
dessen Gründung beschlossen war wurde von der
Kommission ein Memorandum verlesen, das ge-
druckt und verbreitet werden soll. Darin wird aus
der Reihe der vorgesehenen Stationen für deutsche,
niederländische und italienische Studien zunächst die
florentinische Anstalt zur Ausführung empfohlen und
zur Beteiligung aller Freunde und Gönner eines
solchen Unternehmens der deutschen Wissenschaft
aufgefordert. Der geschäftsführende Ausschuss be-
steht aus den Herren A. Bayersdorfer in München,
A. Schmarsow in Leipzig und M. G. Zimmermann,
der mit der Schriftleitung betraut ist und zum
Winter sich nach Italien begiebt. Für das Floren-
tiner kunstgeschichtliche Institut soll zunächst eine
Fachbibliothek und eine Sammlung von Abbildungen
angelegt, es sollen Arbeitsräume beschafft und als
Vorsteher der Anstalt ein anerkannt tüchtiger Kunst-
historiker bestellt werden, der die jungen Gelehrten
entsprechend anzuweisen und zu leiten versteht und
auch in das Fach einschlagende Anfragen von aus-
wärts zu beantworten hat. Die Mittel zur Gründung
des Instituts sollen zunächst durch freiwillige Bei-
träge beschafft werden; von den Anwesenden selbst
ward gleich eine ganz hübsche Summe gezeichnet.
Da Geheimrat Jordan (Berlin), Dezernent im kgl.
preuß. Kultusministerium, mit der Errichtung des
Instituts einverstanden sich erklärte, so hofft man
auch auf eine wohlwollende Stellung der preu-
ßischen Regierung gegenüber demselben. Die Auf-
sicht über das Institut soll dem ständigen Ausschusse
des Kongresses zustehen.
Auf Antrag des Dr. Bob. Stiassny (Wien) beschloss
der Kongress, den ständigen Ausschuss zu beauf-
tragen, Schritte zu thun, um die Fortdauer des
„ Repertoriums für Kunstwissenschaft1' zu sichern, nach-
dem durch das Ableben des Herausgebers, Prof.
Janitschek, das weitere Erscheinen desselben in
Frage gestellt ist. Zu einer gleichfalls von Dr.
Stiassny gewünschten Resolution zu Gunsten der
Fortführung des Meyer'schen Künstlerlexikons konnte
sich der Kongress jedoch nicht entschließen, da
er eine solche für erfolglos hielt.
Nachdem diese Beratungsgegenstände erledigt
waren, hielt Prof. Neuwirth (Prag) einen sehr ge-
haltvollen Vortrag „über das mittelalterliche Krdliau
und seine Beziehungen zur deutschen Kunst". Er
legte dar, dass die Stadt Krakau und andere sla-
vische Städte im Mittelalter ein deutsches Bürger-
tum hatten. Die Gesetze der Zünfte und Hand-
werke waren alle deutsch geschrieben, solchen von
Städten Deutschlands nachgebildet, und selbst als
Krakau mehr und mehr polonisirt und die Gesetze
der Handwerker schon in polnischer Sprache erlassen
wurden, wurden ihre Artikel denen deutscher Städte
entlehnt und z. B. in der 1570 erlassenen Ordnung
der Goldschläger und Maler dieselben vom Meister-
stück mit der Begründung befreit, dass in den
Ländern der deutschen Krone auch kein solches
verlangt würde. Für mehrere der bedeutendsten
kirchlichen Baudenkmäler Krakau's wies der Vor-
tragende die deutschen Vorbilder nach, würdigte
die wichtigsten Werke deutscher Künstler, die sich
in Krakau befinden, und legte den Einfluss der
deutschen Kunst auf die merkwürdigen Skulpturen,
namentlich Altäre und Grabsteine, den Einfluss be-
sonders Nürnberger Künstler auf die Erzgüsse sowie
auf die Tafelbilder dar, die nicht selten fränkische
Anklänge zeigen. Auch mit der näher gelegenen
Hauptstadt der deutschen Kaiser und böhmischen
Könige, Prag, unterhielt Krakau die innigsten Be-
ziehungen. Wirksamer jedoch, wenn auch ferner,
war der Einfluss Nürnbergs. Mit dem Hinweis
darauf, dass die besten Namen Nürnbergs hervor-
ragenden Anteil an der Kunstblüte Krakau's beim