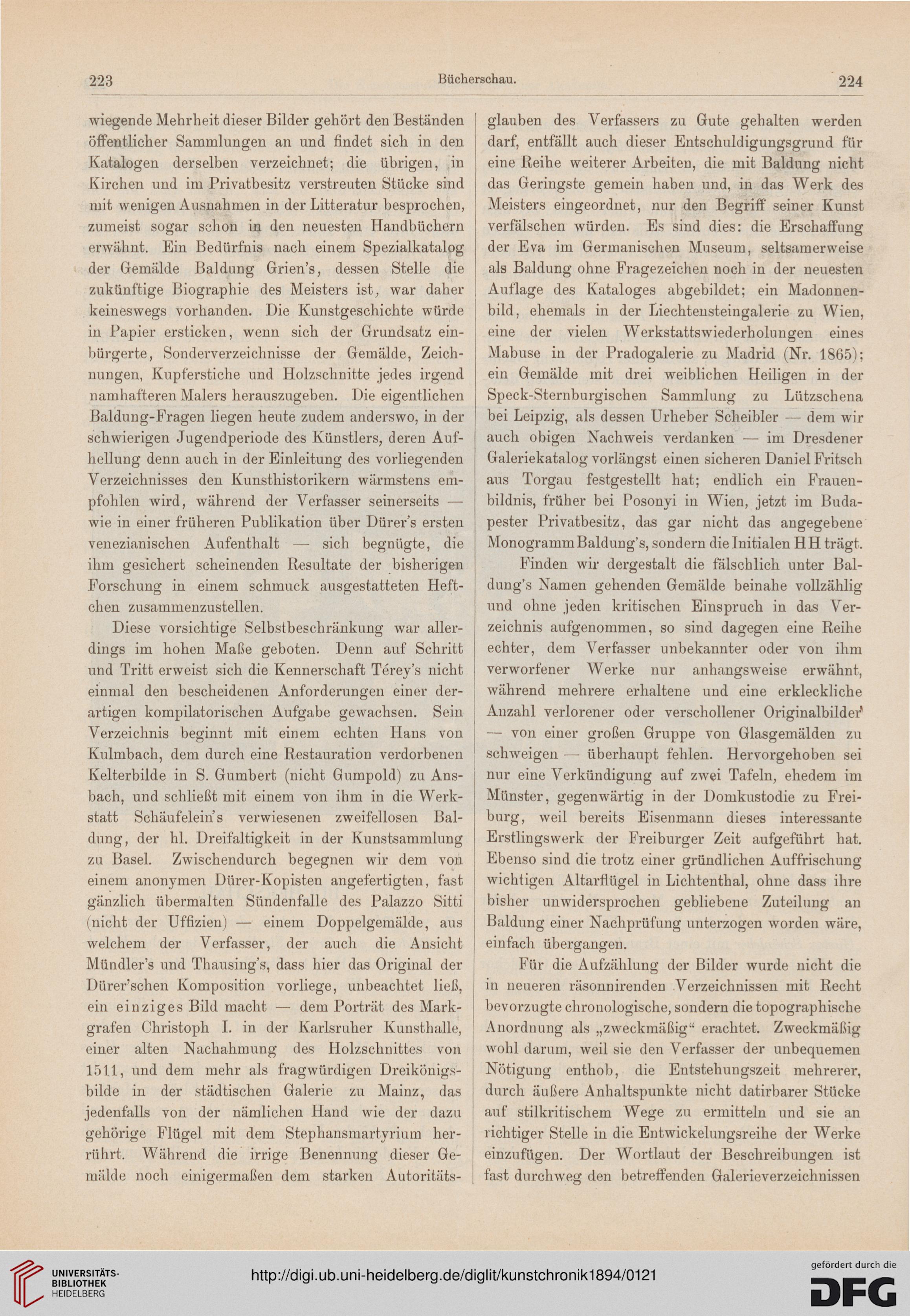223
Bücherschau.
224
wiegende Mehrheit dieser Bilder gehört den Beständen
öffentlicher Sammlungen an und findet sich in den
Katalogen derselben verzeichnet; die übrigen, in
Kirchen und im Privatbesitz verstreuten Stücke sind
mit wenigen Ausnahmen in der Litteratur besprochen,
zumeist sogar schon in den neuesten Handbüchern
erwähnt. Ein Bedürfnis nach einem Spezialkatalog
der Gemälde Baidung Grien's, dessen Stelle die
zukünftige Biographie des Meisters ist, war daher
keineswegs vorhanden. Die Kunstgeschichte würde
in Papier ersticken, wenn sich der Grundsatz ein-
bürgerte, Sonderverzeichnisse der Gemälde, Zeich-
nungen, Kupferstiche und Holzschnitte jedes irgend
namhafteren Malers herauszugeben. Die eigentlichen
Baldung-Fragen liegen heute zudem anderswo, in der
schwierigen Jugendperiode des Künstlers, deren Auf-
hellung denn auch in der Einleitung des vorliegenden
Verzeichnisses den Kunsthistorikern wärmstens em-
pfohlen wird, während der Verfasser seinerseits —
wie in einer früheren Publikation über Dürer's ersten
venezianischen Aufenthalt — sich begnügte, die
ihm gesichert scheinenden Resultate der bisherigen
Forschung in einem schmuck ausgestatteten Heft-
chen zusammenzustellen.
Diese vorsichtige Selbstbeschränkung war aller-
dings im hohen Maße geboten. Denn auf Schritt
und Tritt erweist sich die Kennerschaft Terey's nicht
einmal den bescheidenen Anforderungen einer der-
artigen kompilatorischen Aufgabe gewachsen. Sein
Verzeichnis beginnt mit einem echten Hans von
Kulmbach, dem durch eine Restauration verdorbenen
Kelterbilde in S. Gumbert (nicht Gumpold) zu Ans-
bach, und schließt mit einem von ihm in die Werk-
statt Schäufeleins verwiesenen zweifellosen Bal-
dung, der hl. Dreifaltigkeit in der Kunstsammlung
zu Basel. Zwischendurch begegnen wir dem von
einem anonymen Dürer-Kopisten angefertigten, fast
gänzlich übermalten Sündenfalle des Palazzo Sitti
(nicht der Uffizien) — einem Doppelgemälde, aus
welchem der Verfasser, der auch die Ansicht
Mündler's und Thausing's, dass hier das Original der
Dürer'schen Komposition vorliege, unbeachtet ließ,
ein einziges Bild macht — dem Porträt des Mark-
grafen Christoph I. in der Karlsruher Kunstballe,
einer alten Nachahmung des Holzschnittes von
1511, und dem mehr als fragwürdigen Dreiköni<rs-
bilde in der städtischen Galerie zu Mainz, das
jedenfalls von der nämlichen Hand wie der dazu
gehörige Flügel mit dem Stephansmartyrium her-
rührt. Während die irrige Benennung dieser Ge-
tnälde noch einigermaßen dem starken Autoritäts-
glauben des Verfassers zu Gute gehalten werden
darf, entfällt auch dieser Entschuldigungsgrund für
eine Reihe weiterer Arbeiten, die mit Baidung nicht
das Geringste gemein haben und, in das Werk des
Meisters eingeordnet, nur den Begriff seiner Kunst
verfälschen würden. Es sind dies: die Erschaffung
der Eva im Germanischen Museum, seltsamerweise
als Baidung ohne Fragezeichen noch in der neuesten
Auflage des Kataloges abgebildet; ein Madonnen-
bild, ehemals in der Liechtensteingalerie zu Wien,
eine der vielen Werkstattswiederholungen eines
Mabuse in der Pradogalerie zu Madrid (Nr. 1865);
ein Gemälde mit drei weiblichen Heiligen in der
Speck-Sternburgischen Sammlung zu Lützschena
bei Leipzig, als dessen Urheber Scheibler — dem wir
auch obigen Nachweis verdanken — im Dresdener
Galeriekatalog vorlängst einen sicheren Daniel Fritsch
aus Torgau festgestellt hat; endlich ein Frauen-
bildnis, früher bei Posonyi in Wien, jetzt im Buda-
pester Privatbesitz, das gar nicht das angegebene
MonogrammBaldung's, sondern die Initialen HH trägt.
Finden wir dergestalt die fälschlich unter Bal-
dung's Namen gehenden Gemälde beinahe vollzählig
und ohne jeden kritischen Einspruch in das Ver-
zeichnis aufgenommen, so sind dagegen eine Reihe
echter, dem Verfasser unbekannter oder von ihm
verworfener Werke nur anhangsweise erwähnt,
während mehrere erhaltene und eine erkleckliche
Anzahl verlorener oder verschollener Originalbilder'
— von einer großen Gruppe von Glasgemälden zu
1 schweigen — überhaupt fehlen. Hervorgehoben sei
nur eine Verkündigung auf zwei Tafeln, ehedem im
Münster, gegenwärtig in der Domkustodie zu Frei-
burg, weil bereits Eisenmann dieses interessante
Erstlingswerk der Freiburger Zeit aufgeführt hat.
Ebenso sind die trotz einer gründlichen Auffrischung
wichtigen Altarflügel in Lichtenthai, ohne dass ihre
bisher unwidersprochen gebliebene Zuteilung an
Baidung einer Nachprüfung unterzogen worden wäre,
einfach übergangen.
Für die Aufzählung der Bilder wurde nicht die
in neueren räsonnirenden Verzeichnissen mit Recht
bevorzugte chronologische, sondern die topographische
Anordnung als „zweckmäßig" erachtet. Zweckmäßig
wohl darum, weil sie den Verfasser der unbequemen
Nötigung enthob, die Entstehungszeit mehrerer,
durch äußere Anhaltspunkte nicht datirbarer Stücke
auf stilkritischem Wege zu ermitteln und sie an
richtiger Stelle in die Entwickelungsreihe der Werke
einzufügen. Der Wortlaut der Beschreibungen ist
fast durchweg den betreffenden Galerie Verzeichnissen
Bücherschau.
224
wiegende Mehrheit dieser Bilder gehört den Beständen
öffentlicher Sammlungen an und findet sich in den
Katalogen derselben verzeichnet; die übrigen, in
Kirchen und im Privatbesitz verstreuten Stücke sind
mit wenigen Ausnahmen in der Litteratur besprochen,
zumeist sogar schon in den neuesten Handbüchern
erwähnt. Ein Bedürfnis nach einem Spezialkatalog
der Gemälde Baidung Grien's, dessen Stelle die
zukünftige Biographie des Meisters ist, war daher
keineswegs vorhanden. Die Kunstgeschichte würde
in Papier ersticken, wenn sich der Grundsatz ein-
bürgerte, Sonderverzeichnisse der Gemälde, Zeich-
nungen, Kupferstiche und Holzschnitte jedes irgend
namhafteren Malers herauszugeben. Die eigentlichen
Baldung-Fragen liegen heute zudem anderswo, in der
schwierigen Jugendperiode des Künstlers, deren Auf-
hellung denn auch in der Einleitung des vorliegenden
Verzeichnisses den Kunsthistorikern wärmstens em-
pfohlen wird, während der Verfasser seinerseits —
wie in einer früheren Publikation über Dürer's ersten
venezianischen Aufenthalt — sich begnügte, die
ihm gesichert scheinenden Resultate der bisherigen
Forschung in einem schmuck ausgestatteten Heft-
chen zusammenzustellen.
Diese vorsichtige Selbstbeschränkung war aller-
dings im hohen Maße geboten. Denn auf Schritt
und Tritt erweist sich die Kennerschaft Terey's nicht
einmal den bescheidenen Anforderungen einer der-
artigen kompilatorischen Aufgabe gewachsen. Sein
Verzeichnis beginnt mit einem echten Hans von
Kulmbach, dem durch eine Restauration verdorbenen
Kelterbilde in S. Gumbert (nicht Gumpold) zu Ans-
bach, und schließt mit einem von ihm in die Werk-
statt Schäufeleins verwiesenen zweifellosen Bal-
dung, der hl. Dreifaltigkeit in der Kunstsammlung
zu Basel. Zwischendurch begegnen wir dem von
einem anonymen Dürer-Kopisten angefertigten, fast
gänzlich übermalten Sündenfalle des Palazzo Sitti
(nicht der Uffizien) — einem Doppelgemälde, aus
welchem der Verfasser, der auch die Ansicht
Mündler's und Thausing's, dass hier das Original der
Dürer'schen Komposition vorliege, unbeachtet ließ,
ein einziges Bild macht — dem Porträt des Mark-
grafen Christoph I. in der Karlsruher Kunstballe,
einer alten Nachahmung des Holzschnittes von
1511, und dem mehr als fragwürdigen Dreiköni<rs-
bilde in der städtischen Galerie zu Mainz, das
jedenfalls von der nämlichen Hand wie der dazu
gehörige Flügel mit dem Stephansmartyrium her-
rührt. Während die irrige Benennung dieser Ge-
tnälde noch einigermaßen dem starken Autoritäts-
glauben des Verfassers zu Gute gehalten werden
darf, entfällt auch dieser Entschuldigungsgrund für
eine Reihe weiterer Arbeiten, die mit Baidung nicht
das Geringste gemein haben und, in das Werk des
Meisters eingeordnet, nur den Begriff seiner Kunst
verfälschen würden. Es sind dies: die Erschaffung
der Eva im Germanischen Museum, seltsamerweise
als Baidung ohne Fragezeichen noch in der neuesten
Auflage des Kataloges abgebildet; ein Madonnen-
bild, ehemals in der Liechtensteingalerie zu Wien,
eine der vielen Werkstattswiederholungen eines
Mabuse in der Pradogalerie zu Madrid (Nr. 1865);
ein Gemälde mit drei weiblichen Heiligen in der
Speck-Sternburgischen Sammlung zu Lützschena
bei Leipzig, als dessen Urheber Scheibler — dem wir
auch obigen Nachweis verdanken — im Dresdener
Galeriekatalog vorlängst einen sicheren Daniel Fritsch
aus Torgau festgestellt hat; endlich ein Frauen-
bildnis, früher bei Posonyi in Wien, jetzt im Buda-
pester Privatbesitz, das gar nicht das angegebene
MonogrammBaldung's, sondern die Initialen HH trägt.
Finden wir dergestalt die fälschlich unter Bal-
dung's Namen gehenden Gemälde beinahe vollzählig
und ohne jeden kritischen Einspruch in das Ver-
zeichnis aufgenommen, so sind dagegen eine Reihe
echter, dem Verfasser unbekannter oder von ihm
verworfener Werke nur anhangsweise erwähnt,
während mehrere erhaltene und eine erkleckliche
Anzahl verlorener oder verschollener Originalbilder'
— von einer großen Gruppe von Glasgemälden zu
1 schweigen — überhaupt fehlen. Hervorgehoben sei
nur eine Verkündigung auf zwei Tafeln, ehedem im
Münster, gegenwärtig in der Domkustodie zu Frei-
burg, weil bereits Eisenmann dieses interessante
Erstlingswerk der Freiburger Zeit aufgeführt hat.
Ebenso sind die trotz einer gründlichen Auffrischung
wichtigen Altarflügel in Lichtenthai, ohne dass ihre
bisher unwidersprochen gebliebene Zuteilung an
Baidung einer Nachprüfung unterzogen worden wäre,
einfach übergangen.
Für die Aufzählung der Bilder wurde nicht die
in neueren räsonnirenden Verzeichnissen mit Recht
bevorzugte chronologische, sondern die topographische
Anordnung als „zweckmäßig" erachtet. Zweckmäßig
wohl darum, weil sie den Verfasser der unbequemen
Nötigung enthob, die Entstehungszeit mehrerer,
durch äußere Anhaltspunkte nicht datirbarer Stücke
auf stilkritischem Wege zu ermitteln und sie an
richtiger Stelle in die Entwickelungsreihe der Werke
einzufügen. Der Wortlaut der Beschreibungen ist
fast durchweg den betreffenden Galerie Verzeichnissen