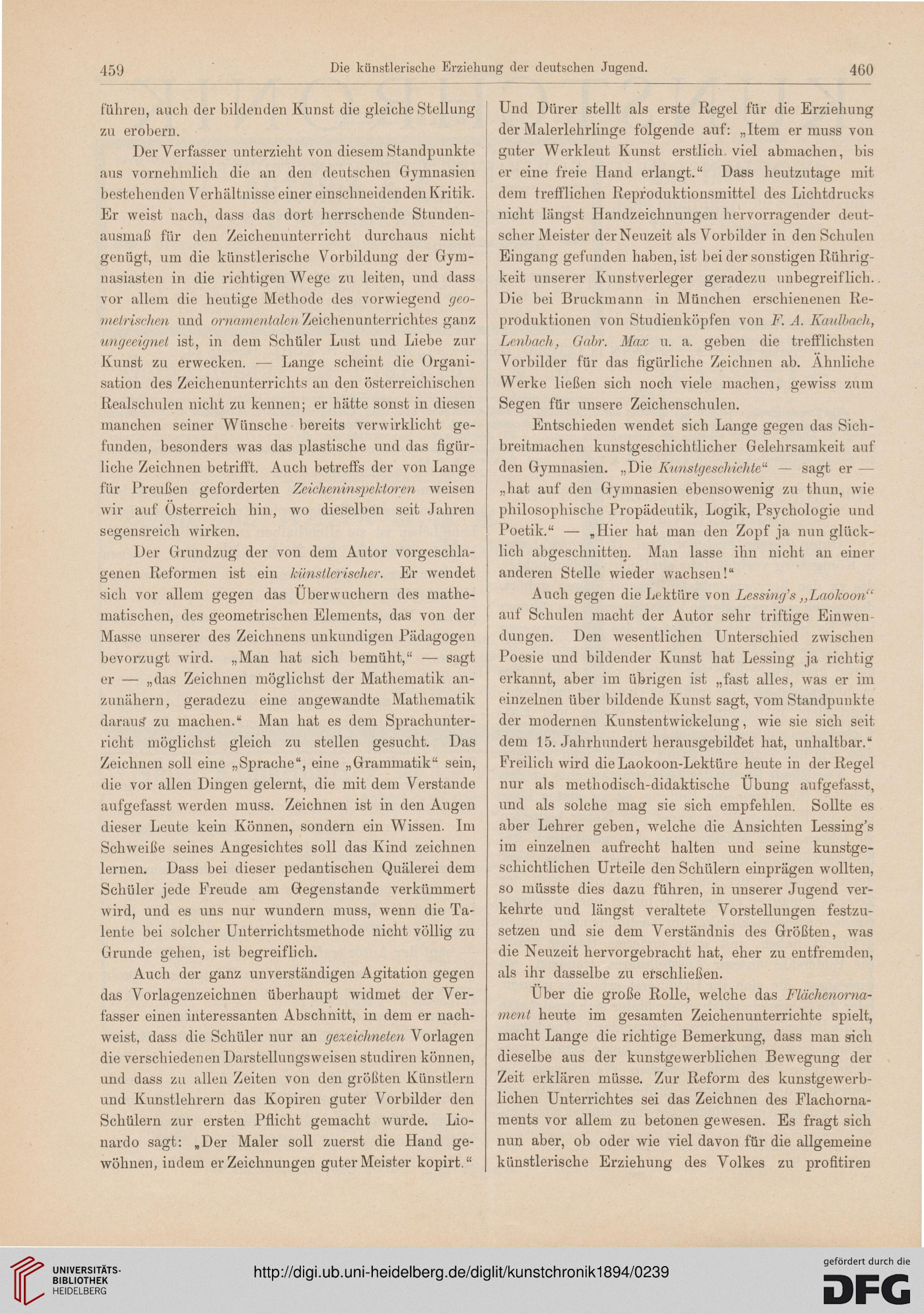459
Die künstlerische Erziehung der deutsehen Jugend.
460
führen, auch der bildenden Kunst die gleiche Stellung
zu erobern.
Der Verfasser unterzieht von diesem Standpunkte
aus vornehmlich die an den deutschen Gymnasien
bestehenden Verhältnisse einer einschneidenden Kritik.
Er weist nach, dass das dort herrschende Stunden-
ausmaß für den Zeichenunterricht durchaus nicht
genügt, um die künstlerische Vorbildung der Gym-
nasiasten in die richtigen Wege zu leiten, und dass
vor allem die heutige Methode des vorwiegend geo-
metrischen und ornamentalen Zeichenunterrichtes ganz
ungeeignet ist, in dem Schüler Lust und Liebe zur
Kunst zu erwecken. — Lange scheint die Organi-
sation des Zeichenunterrichts an den österreichischen
Realschulen nicht zu kennen; er hätte sonst in diesen
manchen seiner Wünsche bereits verwirklicht ge-
funden, besonders was das plastische und das figür-
liche Zeichnen betrifft. Auch betreffs der von Lange
für Preußen geforderten Zeicheninspektoren weisen
wir auf Österreich hin, wo dieselben seit Jahren
segensreich wirken.
Der Grundzug der von dem Autor vorgeschla-
genen Reformen ist ein künstlerischer. Er wendet
sieh vor allem gegen das Überwuchern des mathe-
matischen, des geometrischen Elements, das von der
Masse unserer des Zeichnens unkundigen Pädagogen
bevorzugt wird. „Man hat sich bemüht," — sagt
er — „das Zeichnen möglichst der Mathematik an-
zunähern, geradezu eine angewandte Mathematik
daraus" zu machen." Man hat es dem Sprachunter-
richt möglichst gleich zu stellen gesucht. Das
Zeichnen soll eine „Sprache", eine „Grammatik" sein,
die vor allen Dingen gelernt, die mit dem Verstände
aufgefasst werden muss. Zeichnen ist in den Augen
dieser Leute kein Können, sondern ein Wissen. Im
Schweiße seines Angesichtes soll das Kind zeichnen
lernen. Dass bei dieser pedantischen Quälerei dem
Schüler jede Freude am Gegenstande verkümmert
wird, und es uns nur wundern muss, wenn die Ta-
lente bei solcher Unterrichtsmethode nicht völlig zu
Grunde gehen, ist begreiflich.
Auch der ganz unverständigen Agitation gegen
das Vorlagenzeichnen überhaupt widmet der Ver-
fasser einen interessanten Abschnitt, in dem er nach-
weist, dass die Schüler nur an gezeichneten Vorlagen
die verschiedenen Darstellungsweisen studiren können,
und dass zu allen Zeiten von den größten Künstlern
und Kunstlehrern das Kopiren guter Vorbilder den
Schülern zur ersten Pflicht gemacht wurde. Lio-
nardo sagt: „Der Maler soll zuerst die Hand ge-
wöhnen, indem er Zeichnungen guter Meister kopirt."
Und Dürer stellt als erste Regel für die Erziehung
der Malerlehrlinge folgende auf: „Item er muss von
guter Werkleut Kunst erstlich viel abmachen, bis
er eine freie Hand erlangt." Dass heutzutage mit
dem trefflichen Reproduktionsmittel des Lichtdrucks
nicht längst Handzeichnungen hervorragender deut-
scher Meister der Neuzeit als Vorbilder in den Schulen
Eingang gefunden haben, ist bei der sonstigen Rührig-
keit unserer Kunstverleger geradezu unbegreiflich.
Die bei Bruckmann in München erschienenen Re-
produktionen von Studienköpfen von F. A. Kaulbach,
Lenbach, Oabr. Max u. a. geben die trefflichsten
Vorbilder für das figürliche Zeichnen ab. Ähnliche
Werke ließen sich noch viele machen, gewiss zum
Segen für unsere Zeichenschulen.
Entschieden wendet sich Lange gegen das Sich-
breitmachen kunstgeschichtlicher Gelehrsamkeit auf
den Gymnasien. „Die Kunstgeschichte11 — sagt er —
„hat auf den Gymnasien ebensowenig zu thun, wie
philosophische Propädeutik, Logik, Psychologie und
Poetik." — „Hier hat man den Zopf ja nun glück-
lich abgeschnitten. Man lasse ihn nicht an einer
anderen Stelle wieder wachsen!"
Auch gegen die Lektüre von Lessing's „Laokoon"
auf Schulen macht der Autor sehr triftige Einwen-
dungen. Den wesentlichen Unterschied zwischen
Poesie und bildender Kunst hat Lessing ja richtig
erkannt, aber im übrigen ist „fast alles, was er im
einzelnen über bildende Kunst sagt, vom Standpunkte
der modernen Kunstentwickelung, wie sie sich seit
dem 15. Jahrhundert herausgebildet hat, unhaltbar."
Freilich wird die Laokoon-Lektüre heute in der Regel
nur als methodisch-didaktische Übung aufgefasst,
OD I
und als solche mag sie sich empfehlen. Sollte es
aber Lehrer geben, welche die Ansichten Lessing's
im einzelnen aufrecht halten und seine kunstge-
schichtlichen Urteile den Schülern einprägen wollten,
so müsste dies dazu führen, in unserer Jugend ver-
kehrte und längst veraltete Vorstellungen festzu-
setzen und sie dem Verständnis des Größten, was
die Neuzeit hervorgebracht hat, eher zu entfremden,
als ihr dasselbe zu erschließen.
Über die große Rolle, welche das Flächenorna-
ment heute im gesamten Zeichenunterrichte spielt,
macht Lange die richtige Bemerkung, dass man sich
dieselbe aus der kunstgewerblichen Bewegung der
Zeit erklären müsse. Zur Reform des kunstgewerb-
lichen Unterrichtes sei das Zeichnen des Flachorna-
ments vor allem zu betonen gewesen. Es fragt sich
nun aber, ob oder wie viel davon für die allgemeine
künstlerische Erziehung des Volkes zu profitiren
Die künstlerische Erziehung der deutsehen Jugend.
460
führen, auch der bildenden Kunst die gleiche Stellung
zu erobern.
Der Verfasser unterzieht von diesem Standpunkte
aus vornehmlich die an den deutschen Gymnasien
bestehenden Verhältnisse einer einschneidenden Kritik.
Er weist nach, dass das dort herrschende Stunden-
ausmaß für den Zeichenunterricht durchaus nicht
genügt, um die künstlerische Vorbildung der Gym-
nasiasten in die richtigen Wege zu leiten, und dass
vor allem die heutige Methode des vorwiegend geo-
metrischen und ornamentalen Zeichenunterrichtes ganz
ungeeignet ist, in dem Schüler Lust und Liebe zur
Kunst zu erwecken. — Lange scheint die Organi-
sation des Zeichenunterrichts an den österreichischen
Realschulen nicht zu kennen; er hätte sonst in diesen
manchen seiner Wünsche bereits verwirklicht ge-
funden, besonders was das plastische und das figür-
liche Zeichnen betrifft. Auch betreffs der von Lange
für Preußen geforderten Zeicheninspektoren weisen
wir auf Österreich hin, wo dieselben seit Jahren
segensreich wirken.
Der Grundzug der von dem Autor vorgeschla-
genen Reformen ist ein künstlerischer. Er wendet
sieh vor allem gegen das Überwuchern des mathe-
matischen, des geometrischen Elements, das von der
Masse unserer des Zeichnens unkundigen Pädagogen
bevorzugt wird. „Man hat sich bemüht," — sagt
er — „das Zeichnen möglichst der Mathematik an-
zunähern, geradezu eine angewandte Mathematik
daraus" zu machen." Man hat es dem Sprachunter-
richt möglichst gleich zu stellen gesucht. Das
Zeichnen soll eine „Sprache", eine „Grammatik" sein,
die vor allen Dingen gelernt, die mit dem Verstände
aufgefasst werden muss. Zeichnen ist in den Augen
dieser Leute kein Können, sondern ein Wissen. Im
Schweiße seines Angesichtes soll das Kind zeichnen
lernen. Dass bei dieser pedantischen Quälerei dem
Schüler jede Freude am Gegenstande verkümmert
wird, und es uns nur wundern muss, wenn die Ta-
lente bei solcher Unterrichtsmethode nicht völlig zu
Grunde gehen, ist begreiflich.
Auch der ganz unverständigen Agitation gegen
das Vorlagenzeichnen überhaupt widmet der Ver-
fasser einen interessanten Abschnitt, in dem er nach-
weist, dass die Schüler nur an gezeichneten Vorlagen
die verschiedenen Darstellungsweisen studiren können,
und dass zu allen Zeiten von den größten Künstlern
und Kunstlehrern das Kopiren guter Vorbilder den
Schülern zur ersten Pflicht gemacht wurde. Lio-
nardo sagt: „Der Maler soll zuerst die Hand ge-
wöhnen, indem er Zeichnungen guter Meister kopirt."
Und Dürer stellt als erste Regel für die Erziehung
der Malerlehrlinge folgende auf: „Item er muss von
guter Werkleut Kunst erstlich viel abmachen, bis
er eine freie Hand erlangt." Dass heutzutage mit
dem trefflichen Reproduktionsmittel des Lichtdrucks
nicht längst Handzeichnungen hervorragender deut-
scher Meister der Neuzeit als Vorbilder in den Schulen
Eingang gefunden haben, ist bei der sonstigen Rührig-
keit unserer Kunstverleger geradezu unbegreiflich.
Die bei Bruckmann in München erschienenen Re-
produktionen von Studienköpfen von F. A. Kaulbach,
Lenbach, Oabr. Max u. a. geben die trefflichsten
Vorbilder für das figürliche Zeichnen ab. Ähnliche
Werke ließen sich noch viele machen, gewiss zum
Segen für unsere Zeichenschulen.
Entschieden wendet sich Lange gegen das Sich-
breitmachen kunstgeschichtlicher Gelehrsamkeit auf
den Gymnasien. „Die Kunstgeschichte11 — sagt er —
„hat auf den Gymnasien ebensowenig zu thun, wie
philosophische Propädeutik, Logik, Psychologie und
Poetik." — „Hier hat man den Zopf ja nun glück-
lich abgeschnitten. Man lasse ihn nicht an einer
anderen Stelle wieder wachsen!"
Auch gegen die Lektüre von Lessing's „Laokoon"
auf Schulen macht der Autor sehr triftige Einwen-
dungen. Den wesentlichen Unterschied zwischen
Poesie und bildender Kunst hat Lessing ja richtig
erkannt, aber im übrigen ist „fast alles, was er im
einzelnen über bildende Kunst sagt, vom Standpunkte
der modernen Kunstentwickelung, wie sie sich seit
dem 15. Jahrhundert herausgebildet hat, unhaltbar."
Freilich wird die Laokoon-Lektüre heute in der Regel
nur als methodisch-didaktische Übung aufgefasst,
OD I
und als solche mag sie sich empfehlen. Sollte es
aber Lehrer geben, welche die Ansichten Lessing's
im einzelnen aufrecht halten und seine kunstge-
schichtlichen Urteile den Schülern einprägen wollten,
so müsste dies dazu führen, in unserer Jugend ver-
kehrte und längst veraltete Vorstellungen festzu-
setzen und sie dem Verständnis des Größten, was
die Neuzeit hervorgebracht hat, eher zu entfremden,
als ihr dasselbe zu erschließen.
Über die große Rolle, welche das Flächenorna-
ment heute im gesamten Zeichenunterrichte spielt,
macht Lange die richtige Bemerkung, dass man sich
dieselbe aus der kunstgewerblichen Bewegung der
Zeit erklären müsse. Zur Reform des kunstgewerb-
lichen Unterrichtes sei das Zeichnen des Flachorna-
ments vor allem zu betonen gewesen. Es fragt sich
nun aber, ob oder wie viel davon für die allgemeine
künstlerische Erziehung des Volkes zu profitiren