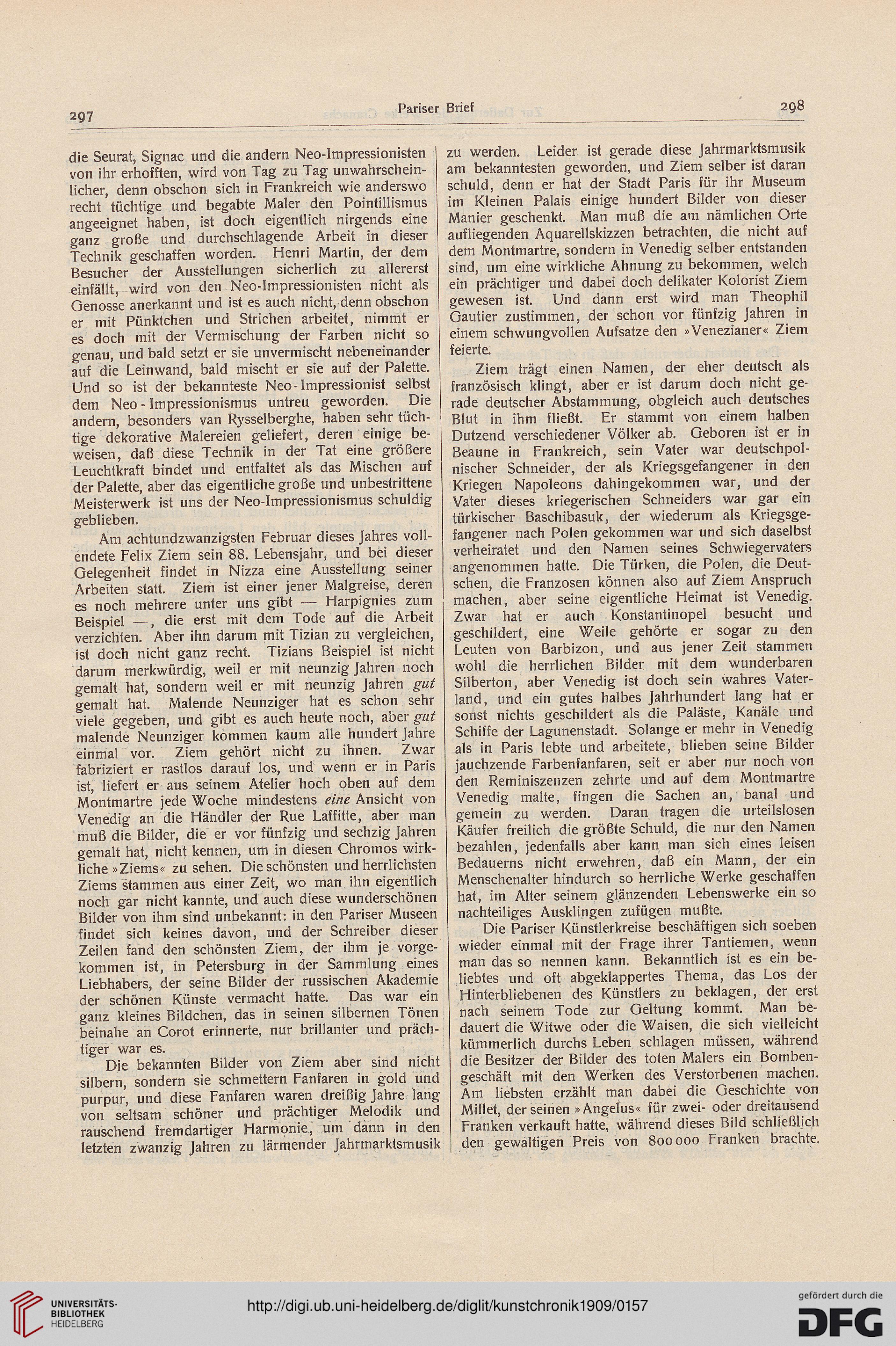297
Pariser Brief
298
die Seurat, Signac und die andern Neo-Impressionisten
von ihr erhofften, wird von Tag zu Tag unwahrschein-
licher, denn obschon sich in Frankreich wie anderswo
recht tüchtige und begabte Maler den Pointiiiismus
angeeignet haben, ist doch eigentlich nirgends eine
ganz große und durchschlagende Arbeit in dieser
Technik geschaffen worden. Henri Martin, der dem
Besucher der Ausstellungen sicherlich zu allererst
einfällt, wird von den Neo-Impressionisten nicht als
Genosse anerkannt und ist es auch nicht, denn obschon
er mit Pünktchen und Strichen arbeitet, nimmt er
es doch mit der Vermischung der Farben nicht so
genau, und bald setzt er sie unvermischt nebeneinander
auf die Leinwand, bald mischt er sie auf der Palette.
Und so ist der bekannteste Neo-Impressionist selbst
dem Neo - Impressionismus untreu geworden. Die
andern, besonders van Rysselberghe, haben sehr tüch-
tige dekorative Malereien geliefert, deren einige be-
weisen, daß diese Technik in der Tat eine größere
Leuchtkraft bindet und entfaltet als das Mischen auf
der Palette, aber das eigentliche große und unbestrittene
Meisterwerk ist uns der Neo-Impressionismus schuldig
geblieben.
Am achtundzwanzigsten Februar dieses Jahres voll-
endete Felix Ziem sein 88. Lebensjahr, und bei dieser
Gelegenheit findet in Nizza eine Ausstellung seiner
Arbeiten statt. Ziem ist einer jener Malgreise, deren
es noch mehrere unter uns gibt — Harpignies zum
Beispiel —, die erst mit dem Tode auf die Arbeit
verzichten. Aber ihn darum mit Tizian zu vergleichen,
ist doch nicht ganz recht. Tizians Beispiel ist nicht
darum merkwürdig, weil er mit neunzig Jahren noch
gemalt hat, sondern weil er mit neunzig Jahren gut
gemalt hat. Malende Neunziger hat es schon sehr
viele gegeben, und gibt es auch heute noch, aber gut
malende Neunziger kommen kaum alle hundert Jahre
einmal vor. Ziem gehört nicht zu ihnen. Zwar
fabriziert er rastlos darauf los, und wenn er in Paris
ist, liefert er aus seinem Atelier hoch oben auf dem
Montmartre jede Woche mindestens eine Ansicht von
Venedig an die Händler der Rue Laffitte, aber man
muß die Bilder, die er vor fünfzig und sechzig Jahren
gemalt hat, nicht kennen, um in diesen Chromos wirk-
liche »Ziems« zu sehen. Die schönsten und herrlichsten
Ziems stammen aus einer Zeit, wo man ihn eigentlich
noch gar nicht kannte, und auch diese wunderschönen
Bilder von ihm sind unbekannt: in den Pariser Museen
findet sich keines davon, und der Schreiber dieser
Zeilen fand den schönsten Ziem, der ihm je vorge-
kommen ist, in Petersburg in der Sammlung eines
Liebhabers, der seine Bilder der russischen Akademie
der schönen Künste vermacht hatte. Das war ein
ganz kleines Bildchen, das in seinen silbernen Tönen
beinahe an Corot erinnerte, nur brillanter und präch-
tiger war es.
Die bekannten Bilder von Ziem aber sind nicht
silbern, sondern sie schmettern Fanfaren in gold und
purpur, und diese Fanfaren waren dreißig Jahre lang
von seltsam schöner und prächtiger Melodik und
rauschend fremdartiger Harmonie, um dann in den
letzten zwanzig Jahren zu lärmender Jahrmarktsmusik
zu werden. Leider ist gerade diese Jahrmarktsmusik
am bekanntesten geworden, und Ziem selber ist daran
schuld, denn er hat der Stadt Paris für ihr Museum
im Kleinen Palais einige hundert Bilder von dieser
Manier geschenkt. Man muß die am nämlichen Orte
aufliegenden Aquarellskizzen betrachten, die nicht auf
dem Montmartre, sondern in Venedig selber entstanden
sind, um eine wirkliche Ahnung zu bekommen, welch
ein prächtiger und dabei doch delikater Kolorist Ziem
gewesen ist. Und dann erst wird man Theophil
Gautier zustimmen, der schon vor fünfzig Jahren in
einem schwungvollen Aufsatze den »Venezianer« Ziem
feierte.
Ziem trägt einen Namen, der eher deutsch als
französisch klingt, aber er ist darum doch nicht ge-
rade deutscher Abstammung, obgleich auch deutsches
Blut in ihm fließt. Er stammt von einem halben
Dutzend verschiedener Völker ab. Geboren ist er in
Beaune in Frankreich, sein Vater war deutschpol-
nischer Schneider, der als Kriegsgefangener in den
Kriegen Napoleons dahingekommen war, und der
Vater dieses kriegerischen Schneiders war gar ein
türkischer Bäsch ibasuk, der wiederum als Kriegsge-
fangener nach Polen gekommen war und sich daselbst
verheiratet und den Namen seines Schwiegervaters
angenommen hatte. Die Türken, die Polen, die Deut-
schen, die Franzosen können also auf Ziem Anspruch
machen, aber seine eigentliche Heimat ist Venedig.
Zwar hat er auch Konstantinopel besucht und
geschildert, eine Weile gehörte er sogar zu den
Leuten von Barbizon, und aus jener Zeit stammen
wohl die herrlichen Bilder mit dem wunderbaren
Silberton, aber Venedig ist doch sein wahres Vater-
land, und ein gutes halbes Jahrhundert lang hat er
sonst nichts geschildert als die Paläste, Kanäle und
Schiffe der Lagunenstadt. Solange er mehr in Venedig
als in Paris lebte und arbeitete, blieben seine Bilder
jauchzende Farbenfanfaren, seit er aber nur noch von
den Reminiszenzen zehrte und auf dem Montmartre
Venedig malte, fingen die Sachen an, banal und
gemein zu werden. Daran tragen die urteilslosen
Käufer freilich die größte Schuld, die nur den Namen
bezahlen, jedenfalls aber kann man sich eines leisen
Bedauerns nicht erwehren, daß ein Mann, der ein
Menschenalter hindurch so herrliche Werke geschaffen
hat, im Alter seinem glänzenden Lebenswerke ein so
nachteiliges Ausklingen zufügen mußte.
Die Pariser Künstlerkreise beschäftigen sich soeben
wieder einmal mit der Frage ihrer Tantiemen, wenn
man das so nennen kann. Bekanntlich ist es ein be-
liebtes und oft abgeklappertes Thema, das Los der
Hinterbliebenen des Künstlers zu beklagen, der erst
nach seinem Tode zur Geltung kommt. Man be-
dauert die Witwe oder die Waisen, die sich vielleicht
kümmerlich durchs Leben schlagen müssen, während
die Besitzer der Bilder des toten Malers ein Bomben-
geschäft mit den Werken des Verstorbenen machen.
Am liebsten erzählt man dabei die Geschichte von
Millet, der seinen »Angelus« für zwei- oder dreitausend
Franken verkauft hatte, während dieses Bild schließlich
den gewaltigen Preis von 800000 Franken brachte.
Pariser Brief
298
die Seurat, Signac und die andern Neo-Impressionisten
von ihr erhofften, wird von Tag zu Tag unwahrschein-
licher, denn obschon sich in Frankreich wie anderswo
recht tüchtige und begabte Maler den Pointiiiismus
angeeignet haben, ist doch eigentlich nirgends eine
ganz große und durchschlagende Arbeit in dieser
Technik geschaffen worden. Henri Martin, der dem
Besucher der Ausstellungen sicherlich zu allererst
einfällt, wird von den Neo-Impressionisten nicht als
Genosse anerkannt und ist es auch nicht, denn obschon
er mit Pünktchen und Strichen arbeitet, nimmt er
es doch mit der Vermischung der Farben nicht so
genau, und bald setzt er sie unvermischt nebeneinander
auf die Leinwand, bald mischt er sie auf der Palette.
Und so ist der bekannteste Neo-Impressionist selbst
dem Neo - Impressionismus untreu geworden. Die
andern, besonders van Rysselberghe, haben sehr tüch-
tige dekorative Malereien geliefert, deren einige be-
weisen, daß diese Technik in der Tat eine größere
Leuchtkraft bindet und entfaltet als das Mischen auf
der Palette, aber das eigentliche große und unbestrittene
Meisterwerk ist uns der Neo-Impressionismus schuldig
geblieben.
Am achtundzwanzigsten Februar dieses Jahres voll-
endete Felix Ziem sein 88. Lebensjahr, und bei dieser
Gelegenheit findet in Nizza eine Ausstellung seiner
Arbeiten statt. Ziem ist einer jener Malgreise, deren
es noch mehrere unter uns gibt — Harpignies zum
Beispiel —, die erst mit dem Tode auf die Arbeit
verzichten. Aber ihn darum mit Tizian zu vergleichen,
ist doch nicht ganz recht. Tizians Beispiel ist nicht
darum merkwürdig, weil er mit neunzig Jahren noch
gemalt hat, sondern weil er mit neunzig Jahren gut
gemalt hat. Malende Neunziger hat es schon sehr
viele gegeben, und gibt es auch heute noch, aber gut
malende Neunziger kommen kaum alle hundert Jahre
einmal vor. Ziem gehört nicht zu ihnen. Zwar
fabriziert er rastlos darauf los, und wenn er in Paris
ist, liefert er aus seinem Atelier hoch oben auf dem
Montmartre jede Woche mindestens eine Ansicht von
Venedig an die Händler der Rue Laffitte, aber man
muß die Bilder, die er vor fünfzig und sechzig Jahren
gemalt hat, nicht kennen, um in diesen Chromos wirk-
liche »Ziems« zu sehen. Die schönsten und herrlichsten
Ziems stammen aus einer Zeit, wo man ihn eigentlich
noch gar nicht kannte, und auch diese wunderschönen
Bilder von ihm sind unbekannt: in den Pariser Museen
findet sich keines davon, und der Schreiber dieser
Zeilen fand den schönsten Ziem, der ihm je vorge-
kommen ist, in Petersburg in der Sammlung eines
Liebhabers, der seine Bilder der russischen Akademie
der schönen Künste vermacht hatte. Das war ein
ganz kleines Bildchen, das in seinen silbernen Tönen
beinahe an Corot erinnerte, nur brillanter und präch-
tiger war es.
Die bekannten Bilder von Ziem aber sind nicht
silbern, sondern sie schmettern Fanfaren in gold und
purpur, und diese Fanfaren waren dreißig Jahre lang
von seltsam schöner und prächtiger Melodik und
rauschend fremdartiger Harmonie, um dann in den
letzten zwanzig Jahren zu lärmender Jahrmarktsmusik
zu werden. Leider ist gerade diese Jahrmarktsmusik
am bekanntesten geworden, und Ziem selber ist daran
schuld, denn er hat der Stadt Paris für ihr Museum
im Kleinen Palais einige hundert Bilder von dieser
Manier geschenkt. Man muß die am nämlichen Orte
aufliegenden Aquarellskizzen betrachten, die nicht auf
dem Montmartre, sondern in Venedig selber entstanden
sind, um eine wirkliche Ahnung zu bekommen, welch
ein prächtiger und dabei doch delikater Kolorist Ziem
gewesen ist. Und dann erst wird man Theophil
Gautier zustimmen, der schon vor fünfzig Jahren in
einem schwungvollen Aufsatze den »Venezianer« Ziem
feierte.
Ziem trägt einen Namen, der eher deutsch als
französisch klingt, aber er ist darum doch nicht ge-
rade deutscher Abstammung, obgleich auch deutsches
Blut in ihm fließt. Er stammt von einem halben
Dutzend verschiedener Völker ab. Geboren ist er in
Beaune in Frankreich, sein Vater war deutschpol-
nischer Schneider, der als Kriegsgefangener in den
Kriegen Napoleons dahingekommen war, und der
Vater dieses kriegerischen Schneiders war gar ein
türkischer Bäsch ibasuk, der wiederum als Kriegsge-
fangener nach Polen gekommen war und sich daselbst
verheiratet und den Namen seines Schwiegervaters
angenommen hatte. Die Türken, die Polen, die Deut-
schen, die Franzosen können also auf Ziem Anspruch
machen, aber seine eigentliche Heimat ist Venedig.
Zwar hat er auch Konstantinopel besucht und
geschildert, eine Weile gehörte er sogar zu den
Leuten von Barbizon, und aus jener Zeit stammen
wohl die herrlichen Bilder mit dem wunderbaren
Silberton, aber Venedig ist doch sein wahres Vater-
land, und ein gutes halbes Jahrhundert lang hat er
sonst nichts geschildert als die Paläste, Kanäle und
Schiffe der Lagunenstadt. Solange er mehr in Venedig
als in Paris lebte und arbeitete, blieben seine Bilder
jauchzende Farbenfanfaren, seit er aber nur noch von
den Reminiszenzen zehrte und auf dem Montmartre
Venedig malte, fingen die Sachen an, banal und
gemein zu werden. Daran tragen die urteilslosen
Käufer freilich die größte Schuld, die nur den Namen
bezahlen, jedenfalls aber kann man sich eines leisen
Bedauerns nicht erwehren, daß ein Mann, der ein
Menschenalter hindurch so herrliche Werke geschaffen
hat, im Alter seinem glänzenden Lebenswerke ein so
nachteiliges Ausklingen zufügen mußte.
Die Pariser Künstlerkreise beschäftigen sich soeben
wieder einmal mit der Frage ihrer Tantiemen, wenn
man das so nennen kann. Bekanntlich ist es ein be-
liebtes und oft abgeklappertes Thema, das Los der
Hinterbliebenen des Künstlers zu beklagen, der erst
nach seinem Tode zur Geltung kommt. Man be-
dauert die Witwe oder die Waisen, die sich vielleicht
kümmerlich durchs Leben schlagen müssen, während
die Besitzer der Bilder des toten Malers ein Bomben-
geschäft mit den Werken des Verstorbenen machen.
Am liebsten erzählt man dabei die Geschichte von
Millet, der seinen »Angelus« für zwei- oder dreitausend
Franken verkauft hatte, während dieses Bild schließlich
den gewaltigen Preis von 800000 Franken brachte.