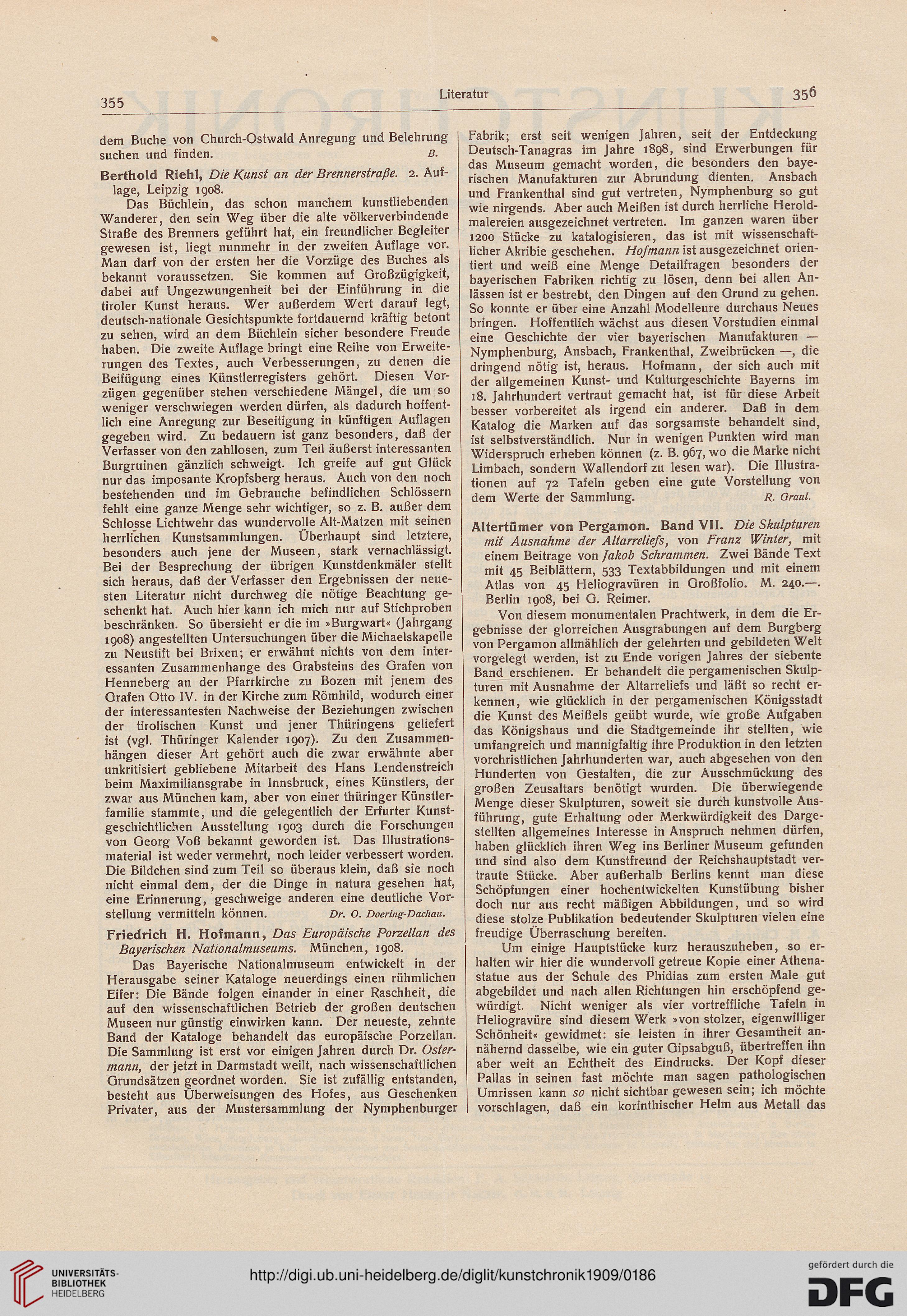355
Literatur
356
dem Buche von Church-Ostwald Anregung und Belehrung
suchen und finden. b.
Berthold Riehl, Die Kunst an der Brennerstraße. 2. Auf-
lage, Leipzig 1908.
Das Büchlein, das schon manchem kunstliebenden
Wanderer, den sein Weg über die alte völkerverbindende
Straße des Brenners geführt hat, ein freundlicher Begleiter
gewesen ist, liegt nunmehr in der zweiten Auflage vor.
Man darf von der ersten her die Vorzüge des Buches als
bekannt voraussetzen. Sie kommen auf Großzügigkeit,
dabei auf Ungezwungenheit bei der Einführung in die
tiroler Kunst heraus. Wer außerdem Wert darauf legt,
deutsch-nationale Gesichtspunkte fortdauernd kräftig betont
zu sehen, wird an dem Büchlein sicher besondere Freude
haben. Die zweite Auflage bringt eine Reihe von Erweite-
rungen des Textes, auch Verbesserungen, zu denen die
Beifügung eines Künstlerregisters gehört. Diesen Vor-
zügen gegenüber stehen verschiedene Mängel, die um so
weniger verschwiegen werden dürfen, als dadurch hoffent-
lich eine Anregung zur Beseitigung in künftigen Auflagen
gegeben wird. Zu bedauern ist ganz besonders, daß der
Verfasser von den zahllosen, zum Teil äußerst interessanten
Burgruinen gänzlich schweigt. Ich greife auf gut Glück
nur das imposante Kropfsberg heraus. Auch von den noch
bestehenden und im Gebrauche befindlichen Schlössern
fehlt eine ganze Menge sehr wichtiger, so z. B. außer dem
Schlosse Lichtwehr das wundervolle Alt-Matzen mit seinen
herrlichen Kunstsammlungen. Überhaupt sind letztere,
besonders auch jene der Museen, stark vernachlässigt.
Bei der Besprechung der übrigen Kunstdenkmäler stellt
sich heraus, daß der Verfasser den Ergebnissen der neue-
sten Literatur nicht durchweg die nötige Beachtung ge-
schenkt hat. Auch hier kann ich mich nur auf Stichproben
beschränken. So übersieht er die im »Burgwart« (Jahrgang
1908) angestellten Untersuchungen über die Michaelskapelle
zu Neustift bei Brixen; er erwähnt nichts von dem inter-
essanten Zusammenhange des Grabsteins des Grafen von
Henneberg an der Pfarrkirche zu Bozen mit jenem des
Grafen Otto IV. in der Kirche zum Römhild, wodurch einer
der interessantesten Nachweise der Beziehungen zwischen
der tirolischen Kunst und jener Thüringens geliefert
ist (vgl. Thüringer Kalender 1907). Zu den Zusammen-
hängen dieser Art gehört auch die zwar erwähnte aber
unkritisiert gebliebene Mitarbeit des Hans Lendenstreich
beim Maximiliansgrabe in Innsbruck, eines Künstlers, der
zwar aus München kam, aber von einer thüringer Künstler-
familie stammte, und die gelegentlich der Erfurter Kunst-
geschichtlichen Ausstellung 1903 durch die Forschungen
von Georg Voß bekannt geworden ist. Das Illustrations-
material ist weder vermehrt, noch leider verbessert worden.
Die Bildchen sind zum Teil so überaus klein, daß sie noch
nicht einmal dem, der die Dinge in natura gesehen hat,
eine Erinnerung, geschweige anderen eine deutliche Vor-
stellung vermitteln können. Dr. O. Doering-Dachau.
Friedrich H. Hof mann, Das Europäische Porzellan des
Bayerischen Natwnalmuseums. München, 1908.
Das Bayerische Nationalmuseum entwickelt in der
Herausgabe seiner Kataloge neuerdings einen rühmlichen
Eifer: Die Bände folgen einander in einer Raschheit, die
auf den wissenschaftlichen Betrieb der großen deutschen
Museen nur günstig einwirken kann. Der neueste, zehnte
Band der Kataloge behandelt das europäische Porzellan.
Die Sammlung ist erst vor einigen Jahren durch Dr. Oster-
mann, der jetzt in Darmstadt weilt, nach wissenschaftlichen
Grundsätzen geordnet worden. Sie ist zufällig entstanden,
besteht aus Überweisungen des Hofes, aus Geschenken
Privater, aus der Mustersammlung der Nymphenburger
Fabrik; erst seit wenigen Jahren, seit der Entdeckung
Deutsch-Tanagras im Jahre 1898, sind Erwerbungen für
das Museum gemacht worden, die besonders den baye-
rischen Manufakturen zur Abrundung dienten. Ansbach
und Frankenthal sind gut vertreten, Nymphenburg so gut
wie nirgends. Aber auch Meißen ist durch herrliche Herold-
malereien ausgezeichnet vertreten. Im ganzen waren über
1200 Stücke zu katalogisieren, das ist mit wissenschaft-
licher Akribie geschehen. Hofmann ist ausgezeichnet orien-
tiert und weiß eine Menge Detailfragen besonders der
bayerischen Fabriken richtig zu lösen, denn bei allen An-
lässen ist er bestrebt, den Dingen auf den Grund zu gehen.
So konnte er über eine Anzahl Modelleure durchaus Neues
bringen. Hoffentlich wächst aus diesen Vorstudien einmal
eine Geschichte der vier bayerischen Manufakturen —
Nymphenburg, Ansbach, Frankenthal, Zweibrücken —, die
dringend nötig ist, heraus. Hofmann, der sich auch mit
der allgemeinen Kunst- und Kulturgeschichte Bayerns im
18. Jahrhundert vertraut gemacht hat, ist für diese Arbeit
besser vorbereitet als irgend ein anderer. Daß in dem
Katalog die Marken auf das sorgsamste behandelt sind,
ist selbstverständlich. Nur in wenigen Punkten wird man
Widerspruch erheben können (z. B. 967, wo die Marke nicht
Limbach, sondern Wallendorf zu lesen war). Die Illustra-
tionen auf 72 Tafeln geben eine gute Vorstellung von
dem Werte der Sammlung. r. Graul.
Altertümer von Pergamon. Band VII. Die Skulpturen
mit Ausnahme der Altarreliefs, von Franz Winter, mit
einem Beitrage von Jakob Schrammen. Zwei Bände Text
mit 45 Beiblättern, 533 Textabbildungen und mit einem
Atlas von 45 Heliogravüren in Großfolio. M. 240.—.
Berlin 1908, bei G. Reimer.
Von diesem monumentalen Prachtwerk, in dem die Er-
gebnisse der glorreichen Ausgrabungen auf dem Burgberg
von Pergamon allmählich der gelehrten und gebildeten Welt
vorgelegt werden, ist zu Ende vorigen Jahres der siebente
Band erschienen. Er behandelt die pergamenischen Skulp-
turen mit Ausnahme der Altarreliefs und läßt so recht er-
kennen, wie glücklich in der pergamenischen Königsstadt
die Kunst des Meißels geübt wurde, wie große Aufgaben
das Königshaus und die Stadtgemeinde ihr stellten, wie
umfangreich und mannigfaltig ihre Produktion in den letzten
vorchristlichen Jahrhunderten war, auch abgesehen von den
Hunderten von Gestalten, die zur Ausschmückung des
großen Zeusaltars benötigt wurden. Die überwiegende
Menge dieser Skulpturen, soweit sie durch kunstvolle Aus-
führung, gute Erhaltung oder Merkwürdigkeit des Darge-
stellten allgemeines Interesse in Anspruch nehmen dürfen,
haben glücklich ihren Weg ins Berliner Museum gefunden
und sind also dem Kunstfreund der Reichshauptstadt ver-
traute Stücke. Aber außerhalb Berlins kennt man diese
Schöpfungen einer hochentwickelten Kunstübung bisher
doch nur aus recht mäßigen Abbildungen, und so wird
diese stolze Publikation bedeutender Skulpturen vielen eine
freudige Überraschung bereiten.
Um einige Hauptstücke kurz herauszuheben, so er-
halten wir hier die wundervoll getreue Kopie einer Athena-
statue aus der Schule des Phidias zum ersten Male gut
abgebildet und nach allen Richtungen hin erschöpfend ge-
würdigt. Nicht weniger als vier vortreffliche Tafeln in
Heliogravüre sind diesem Werk »von stolzer, eigenwilliger
Schönheit« gewidmet: sie leisten in ihrer Gesamtheit an-
nähernd dasselbe, wie ein guter Gipsabguß, übertreffen ihn
aber weit an Echtheit des Eindrucks. Der Kopf dieser
Pallas in seinen fast möchte man sagen pathologischen
Umrissen kann 50 nicht sichtbar gewesen sein; ich möchte
vorschlagen, daß ein korinthischer Helm aus Metall das
Literatur
356
dem Buche von Church-Ostwald Anregung und Belehrung
suchen und finden. b.
Berthold Riehl, Die Kunst an der Brennerstraße. 2. Auf-
lage, Leipzig 1908.
Das Büchlein, das schon manchem kunstliebenden
Wanderer, den sein Weg über die alte völkerverbindende
Straße des Brenners geführt hat, ein freundlicher Begleiter
gewesen ist, liegt nunmehr in der zweiten Auflage vor.
Man darf von der ersten her die Vorzüge des Buches als
bekannt voraussetzen. Sie kommen auf Großzügigkeit,
dabei auf Ungezwungenheit bei der Einführung in die
tiroler Kunst heraus. Wer außerdem Wert darauf legt,
deutsch-nationale Gesichtspunkte fortdauernd kräftig betont
zu sehen, wird an dem Büchlein sicher besondere Freude
haben. Die zweite Auflage bringt eine Reihe von Erweite-
rungen des Textes, auch Verbesserungen, zu denen die
Beifügung eines Künstlerregisters gehört. Diesen Vor-
zügen gegenüber stehen verschiedene Mängel, die um so
weniger verschwiegen werden dürfen, als dadurch hoffent-
lich eine Anregung zur Beseitigung in künftigen Auflagen
gegeben wird. Zu bedauern ist ganz besonders, daß der
Verfasser von den zahllosen, zum Teil äußerst interessanten
Burgruinen gänzlich schweigt. Ich greife auf gut Glück
nur das imposante Kropfsberg heraus. Auch von den noch
bestehenden und im Gebrauche befindlichen Schlössern
fehlt eine ganze Menge sehr wichtiger, so z. B. außer dem
Schlosse Lichtwehr das wundervolle Alt-Matzen mit seinen
herrlichen Kunstsammlungen. Überhaupt sind letztere,
besonders auch jene der Museen, stark vernachlässigt.
Bei der Besprechung der übrigen Kunstdenkmäler stellt
sich heraus, daß der Verfasser den Ergebnissen der neue-
sten Literatur nicht durchweg die nötige Beachtung ge-
schenkt hat. Auch hier kann ich mich nur auf Stichproben
beschränken. So übersieht er die im »Burgwart« (Jahrgang
1908) angestellten Untersuchungen über die Michaelskapelle
zu Neustift bei Brixen; er erwähnt nichts von dem inter-
essanten Zusammenhange des Grabsteins des Grafen von
Henneberg an der Pfarrkirche zu Bozen mit jenem des
Grafen Otto IV. in der Kirche zum Römhild, wodurch einer
der interessantesten Nachweise der Beziehungen zwischen
der tirolischen Kunst und jener Thüringens geliefert
ist (vgl. Thüringer Kalender 1907). Zu den Zusammen-
hängen dieser Art gehört auch die zwar erwähnte aber
unkritisiert gebliebene Mitarbeit des Hans Lendenstreich
beim Maximiliansgrabe in Innsbruck, eines Künstlers, der
zwar aus München kam, aber von einer thüringer Künstler-
familie stammte, und die gelegentlich der Erfurter Kunst-
geschichtlichen Ausstellung 1903 durch die Forschungen
von Georg Voß bekannt geworden ist. Das Illustrations-
material ist weder vermehrt, noch leider verbessert worden.
Die Bildchen sind zum Teil so überaus klein, daß sie noch
nicht einmal dem, der die Dinge in natura gesehen hat,
eine Erinnerung, geschweige anderen eine deutliche Vor-
stellung vermitteln können. Dr. O. Doering-Dachau.
Friedrich H. Hof mann, Das Europäische Porzellan des
Bayerischen Natwnalmuseums. München, 1908.
Das Bayerische Nationalmuseum entwickelt in der
Herausgabe seiner Kataloge neuerdings einen rühmlichen
Eifer: Die Bände folgen einander in einer Raschheit, die
auf den wissenschaftlichen Betrieb der großen deutschen
Museen nur günstig einwirken kann. Der neueste, zehnte
Band der Kataloge behandelt das europäische Porzellan.
Die Sammlung ist erst vor einigen Jahren durch Dr. Oster-
mann, der jetzt in Darmstadt weilt, nach wissenschaftlichen
Grundsätzen geordnet worden. Sie ist zufällig entstanden,
besteht aus Überweisungen des Hofes, aus Geschenken
Privater, aus der Mustersammlung der Nymphenburger
Fabrik; erst seit wenigen Jahren, seit der Entdeckung
Deutsch-Tanagras im Jahre 1898, sind Erwerbungen für
das Museum gemacht worden, die besonders den baye-
rischen Manufakturen zur Abrundung dienten. Ansbach
und Frankenthal sind gut vertreten, Nymphenburg so gut
wie nirgends. Aber auch Meißen ist durch herrliche Herold-
malereien ausgezeichnet vertreten. Im ganzen waren über
1200 Stücke zu katalogisieren, das ist mit wissenschaft-
licher Akribie geschehen. Hofmann ist ausgezeichnet orien-
tiert und weiß eine Menge Detailfragen besonders der
bayerischen Fabriken richtig zu lösen, denn bei allen An-
lässen ist er bestrebt, den Dingen auf den Grund zu gehen.
So konnte er über eine Anzahl Modelleure durchaus Neues
bringen. Hoffentlich wächst aus diesen Vorstudien einmal
eine Geschichte der vier bayerischen Manufakturen —
Nymphenburg, Ansbach, Frankenthal, Zweibrücken —, die
dringend nötig ist, heraus. Hofmann, der sich auch mit
der allgemeinen Kunst- und Kulturgeschichte Bayerns im
18. Jahrhundert vertraut gemacht hat, ist für diese Arbeit
besser vorbereitet als irgend ein anderer. Daß in dem
Katalog die Marken auf das sorgsamste behandelt sind,
ist selbstverständlich. Nur in wenigen Punkten wird man
Widerspruch erheben können (z. B. 967, wo die Marke nicht
Limbach, sondern Wallendorf zu lesen war). Die Illustra-
tionen auf 72 Tafeln geben eine gute Vorstellung von
dem Werte der Sammlung. r. Graul.
Altertümer von Pergamon. Band VII. Die Skulpturen
mit Ausnahme der Altarreliefs, von Franz Winter, mit
einem Beitrage von Jakob Schrammen. Zwei Bände Text
mit 45 Beiblättern, 533 Textabbildungen und mit einem
Atlas von 45 Heliogravüren in Großfolio. M. 240.—.
Berlin 1908, bei G. Reimer.
Von diesem monumentalen Prachtwerk, in dem die Er-
gebnisse der glorreichen Ausgrabungen auf dem Burgberg
von Pergamon allmählich der gelehrten und gebildeten Welt
vorgelegt werden, ist zu Ende vorigen Jahres der siebente
Band erschienen. Er behandelt die pergamenischen Skulp-
turen mit Ausnahme der Altarreliefs und läßt so recht er-
kennen, wie glücklich in der pergamenischen Königsstadt
die Kunst des Meißels geübt wurde, wie große Aufgaben
das Königshaus und die Stadtgemeinde ihr stellten, wie
umfangreich und mannigfaltig ihre Produktion in den letzten
vorchristlichen Jahrhunderten war, auch abgesehen von den
Hunderten von Gestalten, die zur Ausschmückung des
großen Zeusaltars benötigt wurden. Die überwiegende
Menge dieser Skulpturen, soweit sie durch kunstvolle Aus-
führung, gute Erhaltung oder Merkwürdigkeit des Darge-
stellten allgemeines Interesse in Anspruch nehmen dürfen,
haben glücklich ihren Weg ins Berliner Museum gefunden
und sind also dem Kunstfreund der Reichshauptstadt ver-
traute Stücke. Aber außerhalb Berlins kennt man diese
Schöpfungen einer hochentwickelten Kunstübung bisher
doch nur aus recht mäßigen Abbildungen, und so wird
diese stolze Publikation bedeutender Skulpturen vielen eine
freudige Überraschung bereiten.
Um einige Hauptstücke kurz herauszuheben, so er-
halten wir hier die wundervoll getreue Kopie einer Athena-
statue aus der Schule des Phidias zum ersten Male gut
abgebildet und nach allen Richtungen hin erschöpfend ge-
würdigt. Nicht weniger als vier vortreffliche Tafeln in
Heliogravüre sind diesem Werk »von stolzer, eigenwilliger
Schönheit« gewidmet: sie leisten in ihrer Gesamtheit an-
nähernd dasselbe, wie ein guter Gipsabguß, übertreffen ihn
aber weit an Echtheit des Eindrucks. Der Kopf dieser
Pallas in seinen fast möchte man sagen pathologischen
Umrissen kann 50 nicht sichtbar gewesen sein; ich möchte
vorschlagen, daß ein korinthischer Helm aus Metall das