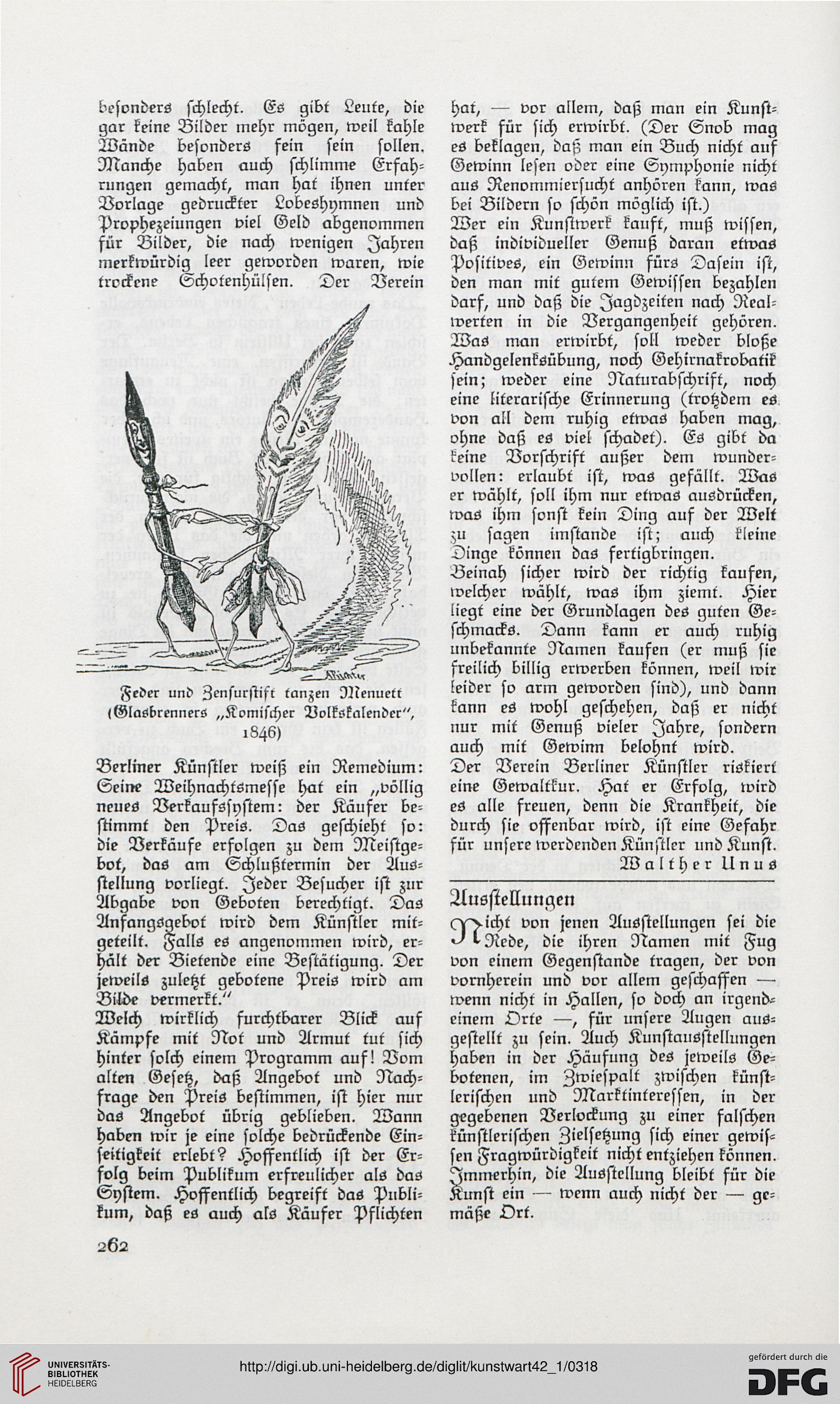besonders schlecht. Es gibt Lente, die
gar keine Bilder inehr mögen, roeil kahle
Wände besonders fein sein sollen.
Manche haben auch schlimme Erfah-
rungen gemacht, man hat ihnen unter
Borlage gedruckter Lobeshymnen und
Prophezeiungen viel Geld abgenommen
für Bilder, die nach tvenigen Jahren
merkwürdig leer geroorden waren, wie
trockcne Schotenhülsen. Der Berein
iGlasbrcnnerS „Komischer Volkükalendcc",
1846)
Berliner Künstler weiß ein Remedium:
Seine Weihnachtsmesse hat ein „völlig
neues Berkaufssystem: der Käufer be-
stimmt den Preis. Das geschiehk so:
die Verkäufe erfolgen zu dem Meistge-
bot, das am Schlußtermin der Aus-
stellung vorliegt. Jeder Besucher ist zur
Abgabe von Geboten berechtigt. Das
AnfangSgebot wird dem Künstler mit-
geteilt. Falls es angenommen wird, er-
hält der Bietende eine Bestätigung. Der
jeweils zuletzt gebotene Preis wird am
Bikde vermerkt."
Welch wirklich furchtbarer Blick auf
Kämpfe mit Not und Armut tut sich
hinter solch einem Programm auf! Bom
alten Gesetz, daß Angebot und Nach-
frage den Preis bestimmen, ist hier nur
das Angebot übrig geblieben. Wann
haben wir je eine solche bedrückende Ein-
seitigkeit erlebt? Hosfentlich ist der Er-
folg beim Publikum erfreulicher als das
System. Hoffentlich begreift das Publi-
kum, daß es auch als Käufer Pflichten
262
hat, — vor allem, daß man ein Kunst-
werk für sich erwirbt. (Der Snob mag
es beklagcn, daß man ein Buch nicht auf
Gewinn lesen oder eine Symphonie nicht
aus Renommiersucht anhören kann, was
bei Bildern so schön möglich ist.)
Wer ein Kunstwerk kauft, muß wissen,
daß individueller Genuß daran etwas
Positives, ein Gewinn fürs Dasein ist,
den man mit gutem Gewissen bezahlcn
darf, und daß die Jagdzeiten nach Real-
werten in die Bergangenheit gehören.
WaS man erwirbt, soll weder bloße
Handgelenksübung, noch Gehirnakrobatik
sein; weder eine Naturabfchrift, noch
eine literarifche Erinnerung (trotzdem eS
von all dem ruhig etwas haben mag,
ohne daß es viel fchadet). Es gibt da
keine Vorschrift außer dem wunder-
vollen: erlaubt ist, was gefällt. Was
er wählt, soll ihm nur etwas ausdrücken,
was ihm sonst kein Ding auf der Welt
zu sagen imstande ist; auch kleine
Dinge können das fertigbringcn.
Beinah sicher wird der richtig kaufen,
welcher wählt, was ihm ziemt. Hier
liegt eine der Grundlagen des guten Ge-
schmacks. Dann kann er auch ruhig
unbekannte Namen kaufen (er muß sie
freilich billig erwerben können, weil wir
leider so arm geworden sind), und dann
kann es wohl gefchehen, daß er nicht
nur mit Genuß vieler Jahre, sondern
auch mit Gewinn belohnt wird.
Der Derein Berliner Künstlcr riskiert
eine Gewaltkur. Hat er Erfolg, wird
es alle freuen, denn die Krankheit, die
durch sie offenbar wird, ist eine Gefahr
für unsere werdcndcn Künstler und Kunst.
Walther Unus
Ausstellungen
icht von jencn Ausstellungen sei die
Rede, die ihren Namen mit Fug
von einem Gegenstande tragen, der von
vornhcrein und vor allem geschasfen —
wenn nicht in Hallen, so doch an irgend-
einem Orte —, für unsere Augen aus-
gestellt zu sein. Auch Kunstausstellungen
haben in der Häufung des jeweils Ge-
botenen, im Zwiespalt zwifchen künst-
lerifchen und Marktinteressen, in der
gegebenen Berlockung zu einer falfchen
künstlerifchen Zielsetzung sich einer gewis-
sen Fragwürdigkeit nicht entziehen können.
Immerhin, dic Ausftcllung bleibt für die
Kunst ein — wenn auch nicht der — gr-
mäße Ort.
gar keine Bilder inehr mögen, roeil kahle
Wände besonders fein sein sollen.
Manche haben auch schlimme Erfah-
rungen gemacht, man hat ihnen unter
Borlage gedruckter Lobeshymnen und
Prophezeiungen viel Geld abgenommen
für Bilder, die nach tvenigen Jahren
merkwürdig leer geroorden waren, wie
trockcne Schotenhülsen. Der Berein
iGlasbrcnnerS „Komischer Volkükalendcc",
1846)
Berliner Künstler weiß ein Remedium:
Seine Weihnachtsmesse hat ein „völlig
neues Berkaufssystem: der Käufer be-
stimmt den Preis. Das geschiehk so:
die Verkäufe erfolgen zu dem Meistge-
bot, das am Schlußtermin der Aus-
stellung vorliegt. Jeder Besucher ist zur
Abgabe von Geboten berechtigt. Das
AnfangSgebot wird dem Künstler mit-
geteilt. Falls es angenommen wird, er-
hält der Bietende eine Bestätigung. Der
jeweils zuletzt gebotene Preis wird am
Bikde vermerkt."
Welch wirklich furchtbarer Blick auf
Kämpfe mit Not und Armut tut sich
hinter solch einem Programm auf! Bom
alten Gesetz, daß Angebot und Nach-
frage den Preis bestimmen, ist hier nur
das Angebot übrig geblieben. Wann
haben wir je eine solche bedrückende Ein-
seitigkeit erlebt? Hosfentlich ist der Er-
folg beim Publikum erfreulicher als das
System. Hoffentlich begreift das Publi-
kum, daß es auch als Käufer Pflichten
262
hat, — vor allem, daß man ein Kunst-
werk für sich erwirbt. (Der Snob mag
es beklagcn, daß man ein Buch nicht auf
Gewinn lesen oder eine Symphonie nicht
aus Renommiersucht anhören kann, was
bei Bildern so schön möglich ist.)
Wer ein Kunstwerk kauft, muß wissen,
daß individueller Genuß daran etwas
Positives, ein Gewinn fürs Dasein ist,
den man mit gutem Gewissen bezahlcn
darf, und daß die Jagdzeiten nach Real-
werten in die Bergangenheit gehören.
WaS man erwirbt, soll weder bloße
Handgelenksübung, noch Gehirnakrobatik
sein; weder eine Naturabfchrift, noch
eine literarifche Erinnerung (trotzdem eS
von all dem ruhig etwas haben mag,
ohne daß es viel fchadet). Es gibt da
keine Vorschrift außer dem wunder-
vollen: erlaubt ist, was gefällt. Was
er wählt, soll ihm nur etwas ausdrücken,
was ihm sonst kein Ding auf der Welt
zu sagen imstande ist; auch kleine
Dinge können das fertigbringcn.
Beinah sicher wird der richtig kaufen,
welcher wählt, was ihm ziemt. Hier
liegt eine der Grundlagen des guten Ge-
schmacks. Dann kann er auch ruhig
unbekannte Namen kaufen (er muß sie
freilich billig erwerben können, weil wir
leider so arm geworden sind), und dann
kann es wohl gefchehen, daß er nicht
nur mit Genuß vieler Jahre, sondern
auch mit Gewinn belohnt wird.
Der Derein Berliner Künstlcr riskiert
eine Gewaltkur. Hat er Erfolg, wird
es alle freuen, denn die Krankheit, die
durch sie offenbar wird, ist eine Gefahr
für unsere werdcndcn Künstler und Kunst.
Walther Unus
Ausstellungen
icht von jencn Ausstellungen sei die
Rede, die ihren Namen mit Fug
von einem Gegenstande tragen, der von
vornhcrein und vor allem geschasfen —
wenn nicht in Hallen, so doch an irgend-
einem Orte —, für unsere Augen aus-
gestellt zu sein. Auch Kunstausstellungen
haben in der Häufung des jeweils Ge-
botenen, im Zwiespalt zwifchen künst-
lerifchen und Marktinteressen, in der
gegebenen Berlockung zu einer falfchen
künstlerifchen Zielsetzung sich einer gewis-
sen Fragwürdigkeit nicht entziehen können.
Immerhin, dic Ausftcllung bleibt für die
Kunst ein — wenn auch nicht der — gr-
mäße Ort.