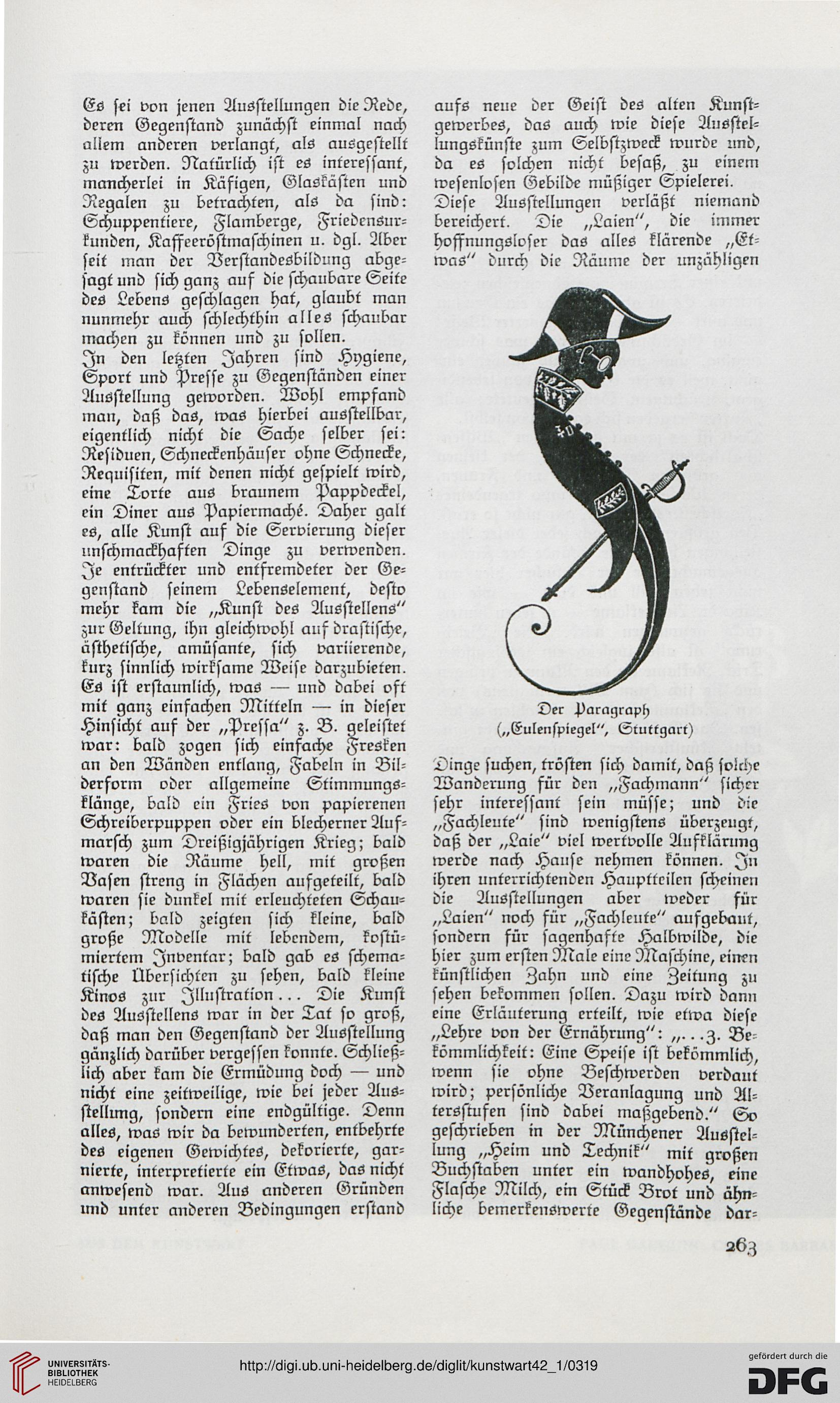Eö sei von jenen Ausstellungen die Rede,
deren Gegenstund zunächst elnmal nach
allem anderen verlangt, als ausgestellk
zu tverden. Nakürlich ist es inkeressant,
mancherlei in Käslgen, Glaskästen und
Regalen zu bekrachken, als da sind:
Schuppenkiere, Flamberge, Friedensur-
kunden, Kasseeröstmaschinen u. dgl. Aber
seit man der Bcrstandesbildung abge-
sagt und sich ganz auf die schaubare Seite
dcs Lebens geschlagen hat, glaubt man
nunmehr auch schlechthin alles schaubar
machen zu können und zu sollen.
Jn den letzten Jahren sind Hygiene,
Sport und Presse zu Gegenständen einer
Ausstellung geworden. Wohl empsand
man, daß daS, waS hierbei ausstellbar,
eigentlich nicht die Sache selber sei:
Residuen, Schneckenhäuser ohne Schnecke,
Reguisiten, mit denen nicht gespielt wird,
eine Torte auS braunem Pappdeckel,
cin Diner aus Papiermache. Daher galt
es, alle Kunst aus die Servierung dieser
unschmackhaften Dinge zu verwcnden.
Je entrückter und entsremdeter der Ge-
gcnstand seinem Lebenselement, desto
mehr kam die „Kunst des Ausstellens"
zur Geltung, ihn gleichwohl aus drastische,
ästhetische, amüsante, sich variierenöe,
kurz sinnlich wirksame Weise darzubieten.
Es ist erstaunlich, was — und dabei ost
mit ganz einfachen Mitteln — in dieser
Hinsicht auf der „Pressa" z. B. geleistet
war: bald zogen sich einfache Fresken
an dcn Wänden entlang, Fabeln in Bil-
derform oder allgcmeine Stimmungs-
klänge, bald ein Fries von papierenen
Schreiberpuppen vder ein blecherner Aus-
marsch zum Dreißigjährigen Krieg; bald
waren die Räume hell, mit grvßen
Basen strcng in Flächen aufgeteilt, bald
waren sie dunkel mi't erleuchketen Schau-
kästen; bald zeigten sich kleine, bald
große Modelle mit lebendem, kostü-
miertcm Jnventar; bald gab es schema-
tische Übersichten zu sehen, bald kleine
Kinvs zur Jllustrakion ... Dic Kunst
dcs Ausstellens war in der Tat so groß,
daß man den Gegenstand der Ausstellung
gänzlich darüber vergesscn konnte. Schließ-
lich aber kam die Ermüdung doch — und
nicht eine zeitweilige, wie bei jeder Aus-
stellung, sondern eine endgültige. Denn
alles, was wir da bewunderten, entbehrte
des eigenen Gewichtes, dekorierte, gar-
nierte, interpretierte ein Etwas, das nicht
anwesend war. Aus anderen Gründen
und unter anderen Bedingungen erstand
auss neue der Geist des alten Kunst-
gewerbeS, das auch wie diesc Ausstel-
lungskünste zum Selbstzweck wurde und,
da es solchen nicht besaß, zu cinem
wesenlosen Gebilde müßiger Spielerei.
Diese Ausstellungen verläßt niemand
bereichert. Die „Laien", die immer
hossnungsloser das alles klärende „Et-
was" durch die Räume der unzähligen
Oec stacagcaph
(„Eulenspiegel", Srutkgact)
Dinge suchen, trösten sich damit, daß svlche
Wanderung sür den „Fachmann" sichcr
sehr interessant sein müsse; und die
„Fachleute" sind wenigstens überzeugt,
daß der „Laie" vi'el wertvolle Aufklärung
werde nach Hause nehmen können. Ai
,'hren unterrichtenden Haupttcilen scheinen
die Ausstellungen aber weder sür
„Laien" noch für „Fachleute" aufgebaut,
sondern für sagenhafte Halbwilde, die
hier zum ersten Male eine Maschine, einen
künstlichen Zahn und eine Zeitung zu
sehen bekommen sollen. Dazu wird dann
cine Erläuterung erteilt, wie etwa diese
„Lehre von der Ernährung": .-Z. Be-
kömmlichkeit: Eine Speise ist bekömmlich,
wenn sie ohne Beschwerden verdaut
wird; persönliche Veranlagung und AI-
tersstufen sind dabei maßgebend." So
geschrieben in der Münchener Ausstel-
lung „Heim und Technik" mit großen
Buchstaben unter ein wandhohes, eine
Flasche Milch, em Stück Brot und ähn-
liche bemerkenswerte Gegenstände dar-
26Z
deren Gegenstund zunächst elnmal nach
allem anderen verlangt, als ausgestellk
zu tverden. Nakürlich ist es inkeressant,
mancherlei in Käslgen, Glaskästen und
Regalen zu bekrachken, als da sind:
Schuppenkiere, Flamberge, Friedensur-
kunden, Kasseeröstmaschinen u. dgl. Aber
seit man der Bcrstandesbildung abge-
sagt und sich ganz auf die schaubare Seite
dcs Lebens geschlagen hat, glaubt man
nunmehr auch schlechthin alles schaubar
machen zu können und zu sollen.
Jn den letzten Jahren sind Hygiene,
Sport und Presse zu Gegenständen einer
Ausstellung geworden. Wohl empsand
man, daß daS, waS hierbei ausstellbar,
eigentlich nicht die Sache selber sei:
Residuen, Schneckenhäuser ohne Schnecke,
Reguisiten, mit denen nicht gespielt wird,
eine Torte auS braunem Pappdeckel,
cin Diner aus Papiermache. Daher galt
es, alle Kunst aus die Servierung dieser
unschmackhaften Dinge zu verwcnden.
Je entrückter und entsremdeter der Ge-
gcnstand seinem Lebenselement, desto
mehr kam die „Kunst des Ausstellens"
zur Geltung, ihn gleichwohl aus drastische,
ästhetische, amüsante, sich variierenöe,
kurz sinnlich wirksame Weise darzubieten.
Es ist erstaunlich, was — und dabei ost
mit ganz einfachen Mitteln — in dieser
Hinsicht auf der „Pressa" z. B. geleistet
war: bald zogen sich einfache Fresken
an dcn Wänden entlang, Fabeln in Bil-
derform oder allgcmeine Stimmungs-
klänge, bald ein Fries von papierenen
Schreiberpuppen vder ein blecherner Aus-
marsch zum Dreißigjährigen Krieg; bald
waren die Räume hell, mit grvßen
Basen strcng in Flächen aufgeteilt, bald
waren sie dunkel mi't erleuchketen Schau-
kästen; bald zeigten sich kleine, bald
große Modelle mit lebendem, kostü-
miertcm Jnventar; bald gab es schema-
tische Übersichten zu sehen, bald kleine
Kinvs zur Jllustrakion ... Dic Kunst
dcs Ausstellens war in der Tat so groß,
daß man den Gegenstand der Ausstellung
gänzlich darüber vergesscn konnte. Schließ-
lich aber kam die Ermüdung doch — und
nicht eine zeitweilige, wie bei jeder Aus-
stellung, sondern eine endgültige. Denn
alles, was wir da bewunderten, entbehrte
des eigenen Gewichtes, dekorierte, gar-
nierte, interpretierte ein Etwas, das nicht
anwesend war. Aus anderen Gründen
und unter anderen Bedingungen erstand
auss neue der Geist des alten Kunst-
gewerbeS, das auch wie diesc Ausstel-
lungskünste zum Selbstzweck wurde und,
da es solchen nicht besaß, zu cinem
wesenlosen Gebilde müßiger Spielerei.
Diese Ausstellungen verläßt niemand
bereichert. Die „Laien", die immer
hossnungsloser das alles klärende „Et-
was" durch die Räume der unzähligen
Oec stacagcaph
(„Eulenspiegel", Srutkgact)
Dinge suchen, trösten sich damit, daß svlche
Wanderung sür den „Fachmann" sichcr
sehr interessant sein müsse; und die
„Fachleute" sind wenigstens überzeugt,
daß der „Laie" vi'el wertvolle Aufklärung
werde nach Hause nehmen können. Ai
,'hren unterrichtenden Haupttcilen scheinen
die Ausstellungen aber weder sür
„Laien" noch für „Fachleute" aufgebaut,
sondern für sagenhafte Halbwilde, die
hier zum ersten Male eine Maschine, einen
künstlichen Zahn und eine Zeitung zu
sehen bekommen sollen. Dazu wird dann
cine Erläuterung erteilt, wie etwa diese
„Lehre von der Ernährung": .-Z. Be-
kömmlichkeit: Eine Speise ist bekömmlich,
wenn sie ohne Beschwerden verdaut
wird; persönliche Veranlagung und AI-
tersstufen sind dabei maßgebend." So
geschrieben in der Münchener Ausstel-
lung „Heim und Technik" mit großen
Buchstaben unter ein wandhohes, eine
Flasche Milch, em Stück Brot und ähn-
liche bemerkenswerte Gegenstände dar-
26Z