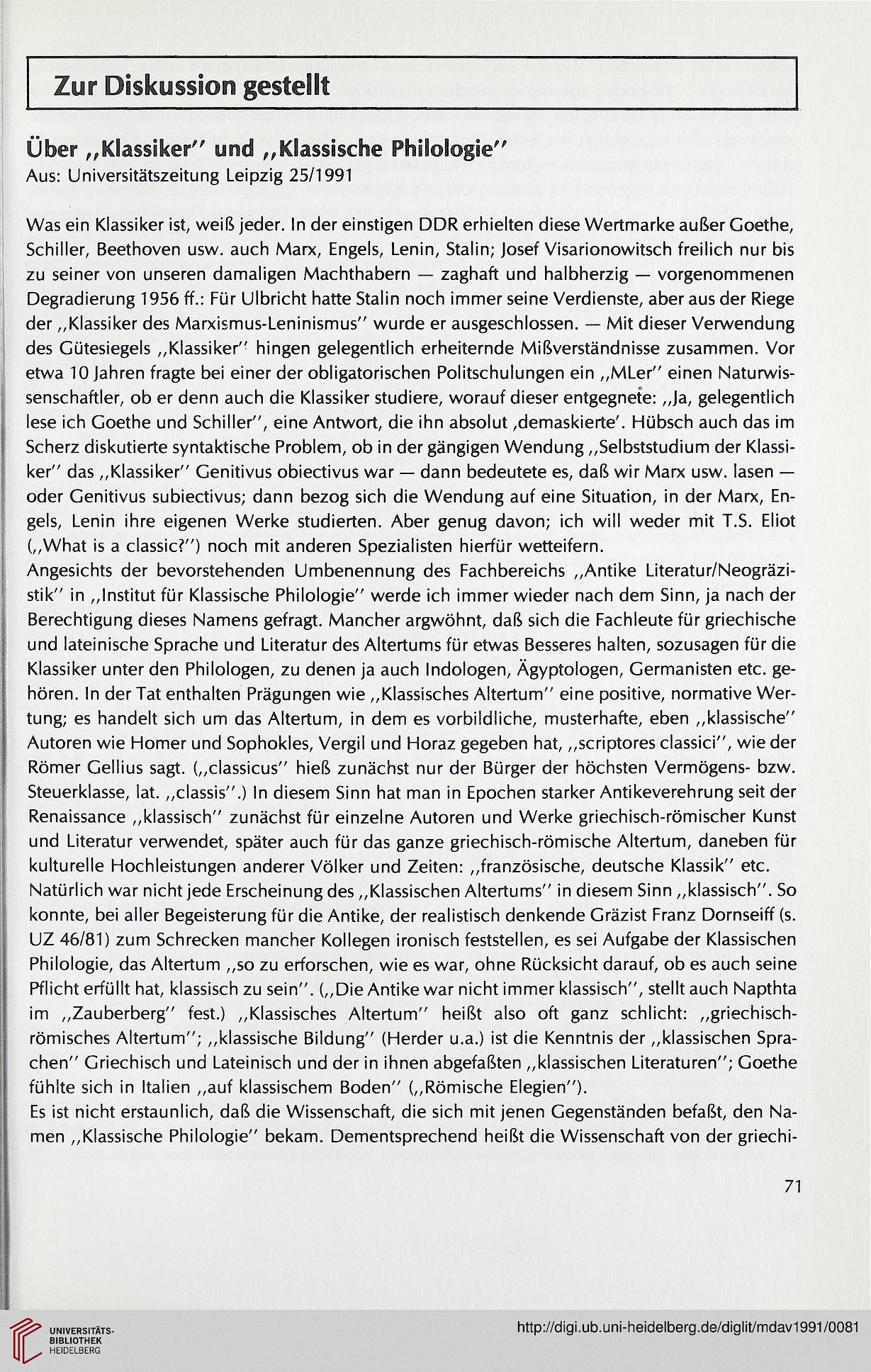Zur Diskussion gesteüt
Über „Kiassiker" und „Kiassische Phi!o!ogie '
Aus: Universitätszeitung Leipzig 25/1991
Was ein Klassiker ist, weiß jeder. In der einstigen DDR erhielten diese Wertmarke außer Goethe,
Schiller, Beethoven usw. auch Marx, Engels, Lenin, Stalin; Josef Visarionowitsch freilich nur bis
zu seiner von unseren damaligen Machthabern — zaghaft und halbherzig — vorgenommenen
Degradierung 1956 ff.: Für Ulbricht hatte Stalin noch immer seine Verdienste, aber aus der Riege
der „Klassiker des Marxismus-Leninismus" wurde er ausgeschlossen. — Mit dieser Verwendung
des Gütesiegels „Klassiker" hingen gelegentlich erheiternde Mißverständnisse zusammen. Vor
etwa 10 Jahren fragte bei einer der obligatorischen Politschulungen ein „MLer" einen Naturwis-
senschaftler, ob er denn auch die Klassiker studiere, worauf dieser entgegnete: „Ja, gelegentlich
lese ich Goethe und Schiller", eine Antwort, die ihn absolut demaskierte'. Hübsch auch das im
Scherz diskutierte syntaktische Problem, ob in der gängigen Wendung „Selbststudium der Klassi-
ker" das „Klassiker" Genitivus obiectivus war — dann bedeutete es, daß wir Marx usw. lasen —
oder Genitivus subiectivus; dann bezog sich die Wendung auf eine Situation, in der Marx, En-
gels, Lenin ihre eigenen Werke studierten. Aber genug davon; ich will weder mit T.S. Eliot
(„What is a classic?") noch mit anderen Spezialisten hierfür wetteifern.
Angesichts der bevorstehenden Umbenennung des Fachbereichs „Antike Literatur/Neogräzi-
stik" in „Institut für Klassische Philologie" werde ich immer wieder nach dem Sinn, ja nach der
Berechtigung dieses Namens gefragt. Mancher argwöhnt, daß sich die Fachleute für griechische
und lateinische Sprache und Literatur des Altertums für etwas Besseres halten, sozusagen für die
Klassiker unter den Philologen, zu denen ja auch Indologen, Ägyptologen, Germanisten etc. ge-
hören. In der Tat enthalten Prägungen wie „Klassisches Altertum" eine positive, normative Wer-
tung; es handelt sich um das Altertum, in dem es vorbildliche, musterhafte, eben „klassische"
Autoren wie Homer und Sophokles, Vergil und Horaz gegeben hat, „scriptores classici", wie der
Römer Gellius sagt, („classicus" hieß zunächst nur der Bürger der höchsten Vermögens- bzw.
Steuerklasse, lat. „classis".) In diesem Sinn hat man in Epochen starker Antikeverehrung seit der
Renaissance „klassisch" zunächst für einzelne Autoren und Werke griechisch-römischer Kunst
und Literatur verwendet, später auch für das ganze griechisch-römische Altertum, daneben für
kulturelle Hochleistungen anderer Völker und Zeiten: „französische, deutsche Klassik" etc.
Natürlich war nicht jede Erscheinung des „Klassischen Altertums" in diesem Sinn „klassisch". So
konnte, bei aller Begeisterung für die Antike, der realistisch denkende Gräzist Franz Dornseiff (s.
UZ 46/81) zum Schrecken mancher Kollegen ironisch feststellen, es sei Aufgabe der Klassischen
Philologie, das Altertum „so zu erforschen, wie es war, ohne Rücksicht darauf, ob es auch seine
Pflicht erfüllt hat, klassisch zu sein". („Die Antike war nicht immer klassisch", stellt auch Napthta
im „Zauberberg" fest.) „Klassisches Altertum" heißt also oft ganz schlicht: „griechisch-
römisches Altertum"; „klassische Bildung" (Herder u.a.) ist die Kenntnis der „klassischen Spra-
chen" Griechisch und Lateinisch und der in ihnen abgefaßten „klassischen Literaturen"; Goethe
fühlte sich in Italien „auf klassischem Boden" („Römische Elegien").
Es ist nicht erstaunlich, daß die Wissenschaft, die sich mit jenen Gegenständen befaßt, den Na-
men „Klassische Philologie" bekam. Dementsprechend heißt die Wissenschaft von der griechi-
71
Über „Kiassiker" und „Kiassische Phi!o!ogie '
Aus: Universitätszeitung Leipzig 25/1991
Was ein Klassiker ist, weiß jeder. In der einstigen DDR erhielten diese Wertmarke außer Goethe,
Schiller, Beethoven usw. auch Marx, Engels, Lenin, Stalin; Josef Visarionowitsch freilich nur bis
zu seiner von unseren damaligen Machthabern — zaghaft und halbherzig — vorgenommenen
Degradierung 1956 ff.: Für Ulbricht hatte Stalin noch immer seine Verdienste, aber aus der Riege
der „Klassiker des Marxismus-Leninismus" wurde er ausgeschlossen. — Mit dieser Verwendung
des Gütesiegels „Klassiker" hingen gelegentlich erheiternde Mißverständnisse zusammen. Vor
etwa 10 Jahren fragte bei einer der obligatorischen Politschulungen ein „MLer" einen Naturwis-
senschaftler, ob er denn auch die Klassiker studiere, worauf dieser entgegnete: „Ja, gelegentlich
lese ich Goethe und Schiller", eine Antwort, die ihn absolut demaskierte'. Hübsch auch das im
Scherz diskutierte syntaktische Problem, ob in der gängigen Wendung „Selbststudium der Klassi-
ker" das „Klassiker" Genitivus obiectivus war — dann bedeutete es, daß wir Marx usw. lasen —
oder Genitivus subiectivus; dann bezog sich die Wendung auf eine Situation, in der Marx, En-
gels, Lenin ihre eigenen Werke studierten. Aber genug davon; ich will weder mit T.S. Eliot
(„What is a classic?") noch mit anderen Spezialisten hierfür wetteifern.
Angesichts der bevorstehenden Umbenennung des Fachbereichs „Antike Literatur/Neogräzi-
stik" in „Institut für Klassische Philologie" werde ich immer wieder nach dem Sinn, ja nach der
Berechtigung dieses Namens gefragt. Mancher argwöhnt, daß sich die Fachleute für griechische
und lateinische Sprache und Literatur des Altertums für etwas Besseres halten, sozusagen für die
Klassiker unter den Philologen, zu denen ja auch Indologen, Ägyptologen, Germanisten etc. ge-
hören. In der Tat enthalten Prägungen wie „Klassisches Altertum" eine positive, normative Wer-
tung; es handelt sich um das Altertum, in dem es vorbildliche, musterhafte, eben „klassische"
Autoren wie Homer und Sophokles, Vergil und Horaz gegeben hat, „scriptores classici", wie der
Römer Gellius sagt, („classicus" hieß zunächst nur der Bürger der höchsten Vermögens- bzw.
Steuerklasse, lat. „classis".) In diesem Sinn hat man in Epochen starker Antikeverehrung seit der
Renaissance „klassisch" zunächst für einzelne Autoren und Werke griechisch-römischer Kunst
und Literatur verwendet, später auch für das ganze griechisch-römische Altertum, daneben für
kulturelle Hochleistungen anderer Völker und Zeiten: „französische, deutsche Klassik" etc.
Natürlich war nicht jede Erscheinung des „Klassischen Altertums" in diesem Sinn „klassisch". So
konnte, bei aller Begeisterung für die Antike, der realistisch denkende Gräzist Franz Dornseiff (s.
UZ 46/81) zum Schrecken mancher Kollegen ironisch feststellen, es sei Aufgabe der Klassischen
Philologie, das Altertum „so zu erforschen, wie es war, ohne Rücksicht darauf, ob es auch seine
Pflicht erfüllt hat, klassisch zu sein". („Die Antike war nicht immer klassisch", stellt auch Napthta
im „Zauberberg" fest.) „Klassisches Altertum" heißt also oft ganz schlicht: „griechisch-
römisches Altertum"; „klassische Bildung" (Herder u.a.) ist die Kenntnis der „klassischen Spra-
chen" Griechisch und Lateinisch und der in ihnen abgefaßten „klassischen Literaturen"; Goethe
fühlte sich in Italien „auf klassischem Boden" („Römische Elegien").
Es ist nicht erstaunlich, daß die Wissenschaft, die sich mit jenen Gegenständen befaßt, den Na-
men „Klassische Philologie" bekam. Dementsprechend heißt die Wissenschaft von der griechi-
71