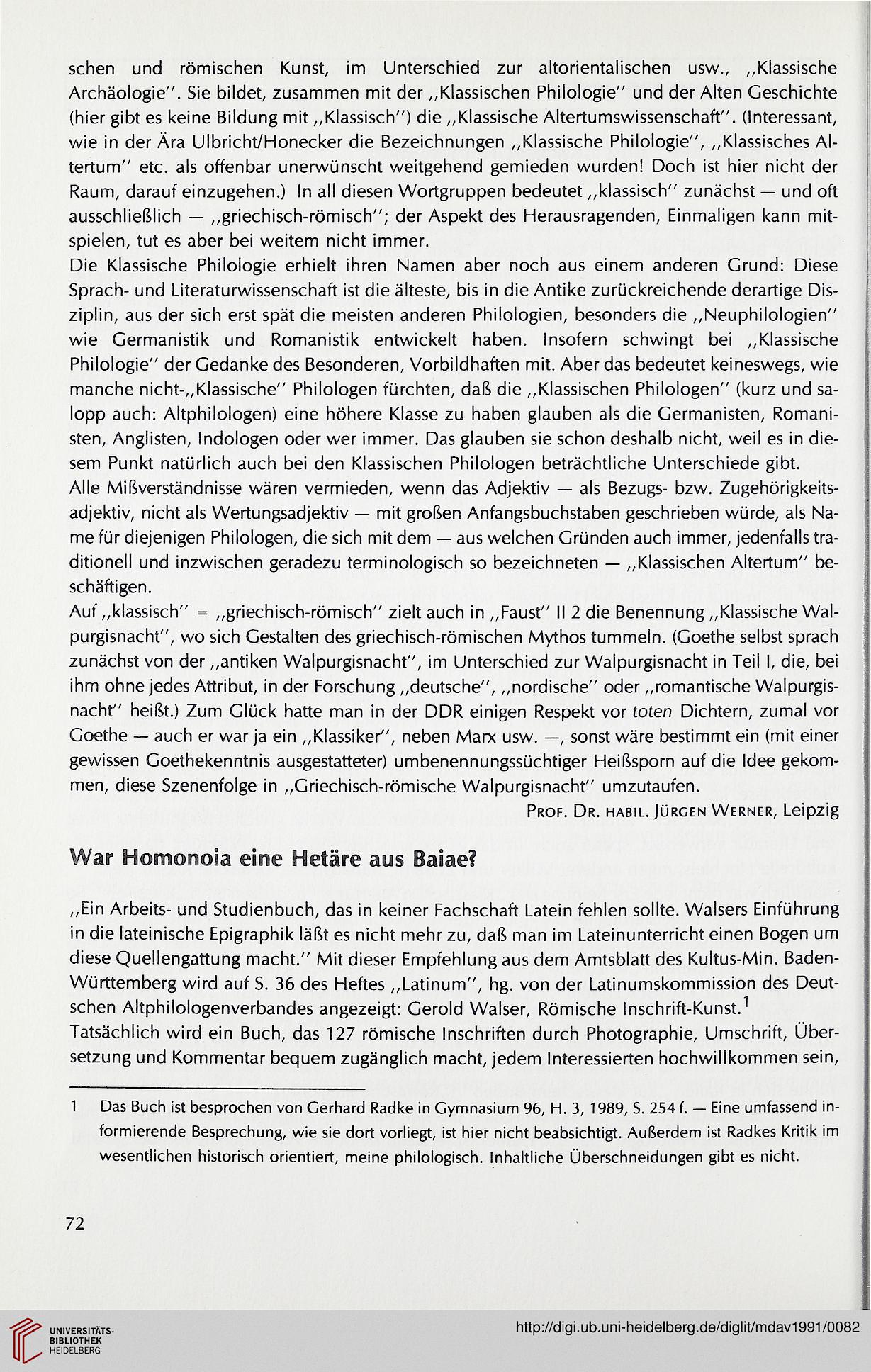sehen und römischen Kunst, im Unterschied zur altorientalischen usw., ,,Klassische
Archäologie". Sie bildet, zusammen mit der,,Klassischen Philologie" und der Alten Geschichte
(hier gibt es keine Bildung mit,,Klassisch") die „Klassische Altertumswissenschaft". (Interessant,
wie in der Ära Ulbricht/Honecker die Bezeichnungen „Klassische Philologie", „Klassisches Al-
tertum" etc. als offenbar unerwünscht weitgehend gemieden wurden! Doch ist hier nicht der
Raum, darauf einzugehen.) In all diesen Wortgruppen bedeutet „klassisch" zunächst — und oft
ausschließlich — „griechisch-römisch"; der Aspekt des Herausragenden, Einmaligen kann mit-
spielen, tut es aber bei weitem nicht immer.
Die Klassische Philologie erhielt ihren Namen aber noch aus einem anderen Grund: Diese
Sprach- und Literaturwissenschaft ist die älteste, bis in die Antike zurückreichende derartige Dis-
ziplin, aus der sich erst spät die meisten anderen Philologien, besonders die „Neuphilologien"
wie Germanistik und Romanistik entwickelt haben. Insofern schwingt bei „Klassische
Philologie" der Gedanke des Besonderen, Vorbildhaften mit. Aber das bedeutet keineswegs, wie
manche nicht-,,Klassische" Philologen fürchten, daß die „Klassischen Philologen" (kurz und sa-
lopp auch: Altphilologen) eine höhere Klasse zu haben glauben als die Germanisten, Romani-
sten, Anglisten, Indologen oder wer immer. Das glauben sie schon deshalb nicht, weil es in die-
sem Punkt natürlich auch bei den Klassischen Philologen beträchtliche Unterschiede gibt.
Alle Mißverständnisse wären vermieden, wenn das Adjektiv — als Bezugs- bzw. Zugehörigkeits-
adjektiv, nicht als Wertungsadjektiv — mit großen Anfangsbuchstaben geschrieben würde, als Na-
me für diejenigen Philologen, die sich mit dem — aus welchen Gründen auch immer, jedenfalls tra-
ditionell und inzwischen geradezu terminologisch so bezeichneten — „Klassischen Altertum" be-
schäftigen.
Auf „klassisch" = „griechisch-römisch" zielt auch in „Faust" II 2 die Benennung „Klassische Wal-
purgisnacht", wo sich Gestalten des griechisch-römischen Mythos tummeln. (Goethe selbst sprach
zunächst von der „antiken Walpurgisnacht", im Unterschied zur Walpurgisnacht in Teil I, die, bei
ihm ohne jedes Attribut, in der Forschung „deutsche", „nordische" oder „romantische Walpurgis-
nacht" heißt.) Zum Glück hatte man in der DDR einigen Respekt vor toten Dichtern, zumal vor
Goethe — auch er war ja ein „Klassiker", neben Marx usw. —, sonst wäre bestimmt ein (mit einer
gewissen Goethekenntnis ausgestatteter) umbenennungssüchtiger Heißsporn auf die Idee gekom-
men, diese Szenenfolge in „Griechisch-römische Walpurgisnacht" umzutaufen.
PROF. DR. HABIL. JÜRGEN WERNER, Leipzig
War Homonoia eine Hetäre aus Baiae?
„Ein Arbeits- und Studienbuch, das in keiner Fachschaft Latein fehlen sollte. Walsers Einführung
in die lateinische Epigraphik läßt es nicht mehr zu, daß man im Lateinunterricht einen Bogen um
diese Quellengattung macht." Mit dieser Empfehlung aus dem Amtsblatt des Kultus-Min. Baden-
Württemberg wird auf S. 36 des Heftes „Latinum", hg. von der Latinumskommission des Deut-
schen Altphilologenverbandes angezeigt: Gerold Walser, Römische Inschrift-KunstJ
Tatsächlich wird ein Buch, das 127 römische Inschriften durch Photographie, Umschrift, Über-
setzung und Kommentar bequem zugänglich macht, jedem Interessierten hochwillkommen sein,
1 Das Buch ist besprochen von Gerhard Radke in Gymnasium 96, H. 3, 1989, S. 254 f. — Eine umfassend in-
formierende Besprechung, wie sie dort vorliegt, ist hier nicht beabsichtigt. Außerdem ist Radkes Kritik im
wesentlichen historisch orientiert, meine philologisch. Inhaltliche Überschneidungen gibt es nicht.
72
Archäologie". Sie bildet, zusammen mit der,,Klassischen Philologie" und der Alten Geschichte
(hier gibt es keine Bildung mit,,Klassisch") die „Klassische Altertumswissenschaft". (Interessant,
wie in der Ära Ulbricht/Honecker die Bezeichnungen „Klassische Philologie", „Klassisches Al-
tertum" etc. als offenbar unerwünscht weitgehend gemieden wurden! Doch ist hier nicht der
Raum, darauf einzugehen.) In all diesen Wortgruppen bedeutet „klassisch" zunächst — und oft
ausschließlich — „griechisch-römisch"; der Aspekt des Herausragenden, Einmaligen kann mit-
spielen, tut es aber bei weitem nicht immer.
Die Klassische Philologie erhielt ihren Namen aber noch aus einem anderen Grund: Diese
Sprach- und Literaturwissenschaft ist die älteste, bis in die Antike zurückreichende derartige Dis-
ziplin, aus der sich erst spät die meisten anderen Philologien, besonders die „Neuphilologien"
wie Germanistik und Romanistik entwickelt haben. Insofern schwingt bei „Klassische
Philologie" der Gedanke des Besonderen, Vorbildhaften mit. Aber das bedeutet keineswegs, wie
manche nicht-,,Klassische" Philologen fürchten, daß die „Klassischen Philologen" (kurz und sa-
lopp auch: Altphilologen) eine höhere Klasse zu haben glauben als die Germanisten, Romani-
sten, Anglisten, Indologen oder wer immer. Das glauben sie schon deshalb nicht, weil es in die-
sem Punkt natürlich auch bei den Klassischen Philologen beträchtliche Unterschiede gibt.
Alle Mißverständnisse wären vermieden, wenn das Adjektiv — als Bezugs- bzw. Zugehörigkeits-
adjektiv, nicht als Wertungsadjektiv — mit großen Anfangsbuchstaben geschrieben würde, als Na-
me für diejenigen Philologen, die sich mit dem — aus welchen Gründen auch immer, jedenfalls tra-
ditionell und inzwischen geradezu terminologisch so bezeichneten — „Klassischen Altertum" be-
schäftigen.
Auf „klassisch" = „griechisch-römisch" zielt auch in „Faust" II 2 die Benennung „Klassische Wal-
purgisnacht", wo sich Gestalten des griechisch-römischen Mythos tummeln. (Goethe selbst sprach
zunächst von der „antiken Walpurgisnacht", im Unterschied zur Walpurgisnacht in Teil I, die, bei
ihm ohne jedes Attribut, in der Forschung „deutsche", „nordische" oder „romantische Walpurgis-
nacht" heißt.) Zum Glück hatte man in der DDR einigen Respekt vor toten Dichtern, zumal vor
Goethe — auch er war ja ein „Klassiker", neben Marx usw. —, sonst wäre bestimmt ein (mit einer
gewissen Goethekenntnis ausgestatteter) umbenennungssüchtiger Heißsporn auf die Idee gekom-
men, diese Szenenfolge in „Griechisch-römische Walpurgisnacht" umzutaufen.
PROF. DR. HABIL. JÜRGEN WERNER, Leipzig
War Homonoia eine Hetäre aus Baiae?
„Ein Arbeits- und Studienbuch, das in keiner Fachschaft Latein fehlen sollte. Walsers Einführung
in die lateinische Epigraphik läßt es nicht mehr zu, daß man im Lateinunterricht einen Bogen um
diese Quellengattung macht." Mit dieser Empfehlung aus dem Amtsblatt des Kultus-Min. Baden-
Württemberg wird auf S. 36 des Heftes „Latinum", hg. von der Latinumskommission des Deut-
schen Altphilologenverbandes angezeigt: Gerold Walser, Römische Inschrift-KunstJ
Tatsächlich wird ein Buch, das 127 römische Inschriften durch Photographie, Umschrift, Über-
setzung und Kommentar bequem zugänglich macht, jedem Interessierten hochwillkommen sein,
1 Das Buch ist besprochen von Gerhard Radke in Gymnasium 96, H. 3, 1989, S. 254 f. — Eine umfassend in-
formierende Besprechung, wie sie dort vorliegt, ist hier nicht beabsichtigt. Außerdem ist Radkes Kritik im
wesentlichen historisch orientiert, meine philologisch. Inhaltliche Überschneidungen gibt es nicht.
72