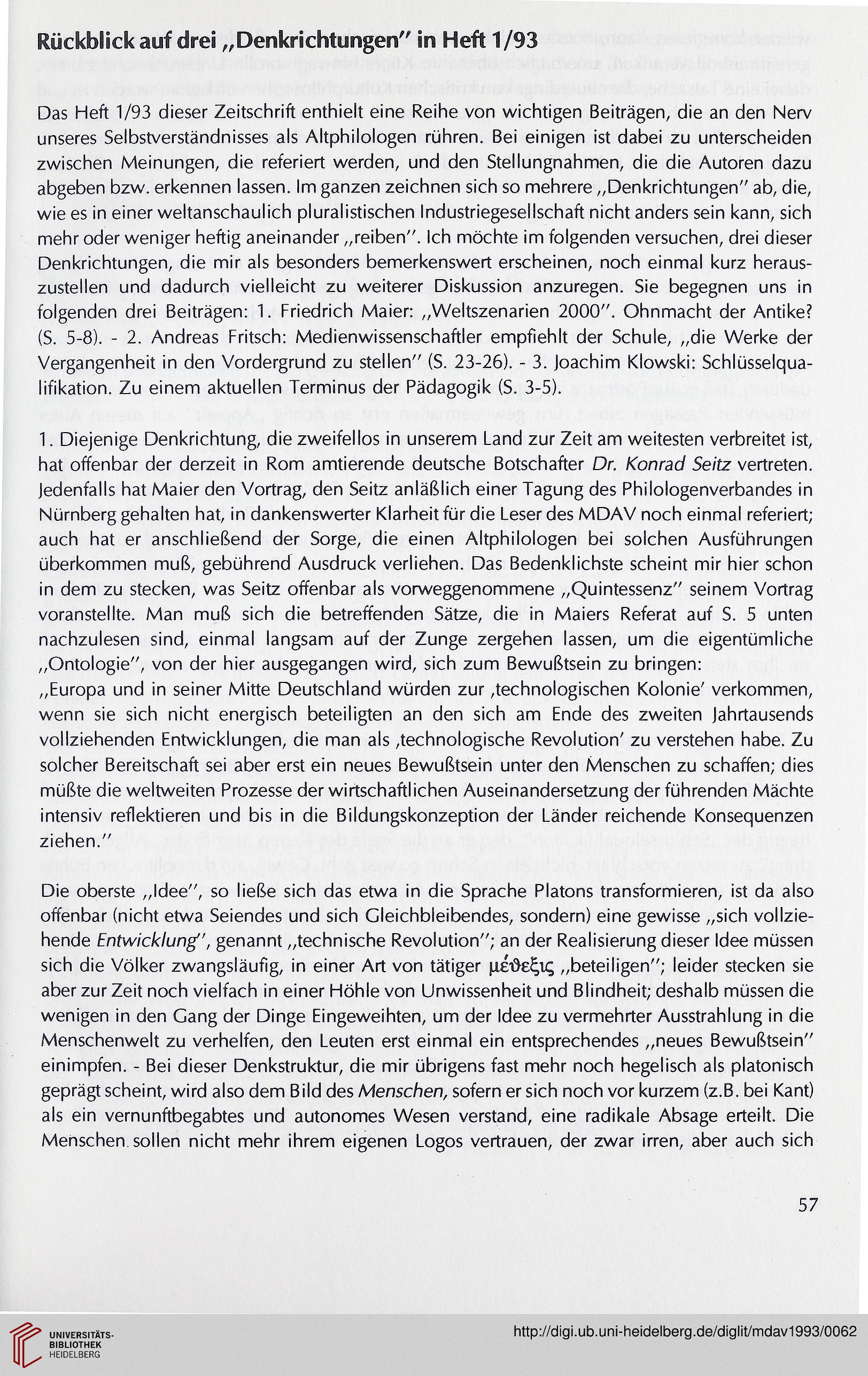Rückbück auf dre! „Denkrichtungen" in Heft 1/93
Das Heft 1/93 dieser Zeitschrift enthiett eine Reihe von wichtigen Beiträgen, die an den Nerv
unseres Selbstverständnisses als Altphilologen rühren. Bei einigen ist dabei zu unterscheiden
zwischen Meinungen, die referiert werden, und den Stellungnahmen, die die Autoren dazu
abgeben bzw. erkennen lassen. Im ganzen zeichnen sich so mehrere „Denkrichtungen" ab, die,
wie es in einer weltanschaulich pluralistischen Industriegesellschaft nicht anders sein kann, sich
mehr oder weniger heftig aneinander „reiben". Ich möchte im folgenden versuchen, drei dieser
Denkrichtungen, die mir als besonders bemerkenswert erscheinen, noch einmal kurz heraus-
zustellen und dadurch vielleicht zu weiterer Diskussion anzuregen. Sie begegnen uns in
folgenden drei Beiträgen: 1. Friedrich Maier: „Weltszenarien 2000". Ohnmacht der Antike?
(S. 5-8). - 2. Andreas Fritsch: Medienwissenschaftler empfiehlt der Schule, „die Werke der
Vergangenheit in den Vordergrund zu stellen" (S. 23-26). - 3. Joachim Klowski: Schlüsselqua-
lifikation. Zu einem aktuellen Terminus der Pädagogik (S. 3-5).
1. Diejenige Denkrichtung, die zweifellos in unserem Land zur Zeit am weitesten verbreitet ist,
hat offenbar der derzeit in Rom amtierende deutsche Botschafter Dr. /Conrad Se/'tz vertreten,
jedenfalls hat Maier den Vortrag, den Seitz anläßlich einer Tagung des Philologenverbandes in
Nürnberg gehalten hat, in dankenswerter Klarheit für die Leser des MDAV noch einmal referiert;
auch hat er anschließend der Sorge, die einen Altphilologen bei solchen Ausführungen
überkommen muß, gebührend Ausdruck verliehen. Das Bedenklichste scheint mir hier schon
in dem zu stecken, was Seitz offenbar als vorweggenommene „Quintessenz" seinem Vortrag
voranstellte. Man muß sich die betreffenden Sätze, die in Maiers Referat auf S. 5 unten
nachzulesen sind, einmal langsam auf der Zunge zergehen lassen, um die eigentümliche
„Ontotogie", von der hier ausgegangen wird, sich zum Bewußtsein zu bringen:
„Europa und in seiner Mitte Deutschland würden zur Technologischen Kolonie' verkommen,
wenn sie sich nicht energisch beteiligten an den sich am Ende des zweiten Jahrtausends
vollziehenden Entwicklungen, die man als Technologische Revolution' zu verstehen habe. Zu
solcher Bereitschaft sei aber erst ein neues Bewußtsein unter den Menschen zu schaffen; dies
müßte die weltweiten Prozesse der wirtschaftlichen Auseinandersetzung der führenden Mächte
intensiv reflektieren und bis in die Bildungskonzeption der Länder reichende Konsequenzen
ziehen."
Die oberste „Idee", so ließe sich das etwa in die Sprache Platons transformieren, ist da also
offenbar (nicht etwa Seiendes und sich Gleichbleibendes, sondern) eine gewisse „sich vollzie-
hende Tnfw/ck/ung", genannt „technische Revolution"; an der Realisierung dieser Idee müssen
sich die Völker zwangsläufig, in einer Art von tätiger „beteiligen"; leider stecken sie
aber zur Zeit noch vielfach in einer Höhle von Unwissenheit und Blindheit; deshalb müssen die
wenigen in den Gang der Dinge Eingeweihten, um der Idee zu vermehrter Ausstrahlung in die
Menschenwelt zu verhelfen, den Leuten erst einmal ein entsprechendes „neues Bewußtsein"
einimpfen. - Bei dieser Denkstruktur, die mir übrigens fast mehr noch hegelisch als platonisch
geprägt scheint, wird also dem Bild des Menschen, sofern er sich noch vor kurzem (z.B. bei Kant)
als ein vernunftbegabtes und autonomes Wesen verstand, eine radikale Absage erteilt. Die
Menschen sollen nicht mehr ihrem eigenen Logos vertrauen, der zwar irren, aber auch sich
57
Das Heft 1/93 dieser Zeitschrift enthiett eine Reihe von wichtigen Beiträgen, die an den Nerv
unseres Selbstverständnisses als Altphilologen rühren. Bei einigen ist dabei zu unterscheiden
zwischen Meinungen, die referiert werden, und den Stellungnahmen, die die Autoren dazu
abgeben bzw. erkennen lassen. Im ganzen zeichnen sich so mehrere „Denkrichtungen" ab, die,
wie es in einer weltanschaulich pluralistischen Industriegesellschaft nicht anders sein kann, sich
mehr oder weniger heftig aneinander „reiben". Ich möchte im folgenden versuchen, drei dieser
Denkrichtungen, die mir als besonders bemerkenswert erscheinen, noch einmal kurz heraus-
zustellen und dadurch vielleicht zu weiterer Diskussion anzuregen. Sie begegnen uns in
folgenden drei Beiträgen: 1. Friedrich Maier: „Weltszenarien 2000". Ohnmacht der Antike?
(S. 5-8). - 2. Andreas Fritsch: Medienwissenschaftler empfiehlt der Schule, „die Werke der
Vergangenheit in den Vordergrund zu stellen" (S. 23-26). - 3. Joachim Klowski: Schlüsselqua-
lifikation. Zu einem aktuellen Terminus der Pädagogik (S. 3-5).
1. Diejenige Denkrichtung, die zweifellos in unserem Land zur Zeit am weitesten verbreitet ist,
hat offenbar der derzeit in Rom amtierende deutsche Botschafter Dr. /Conrad Se/'tz vertreten,
jedenfalls hat Maier den Vortrag, den Seitz anläßlich einer Tagung des Philologenverbandes in
Nürnberg gehalten hat, in dankenswerter Klarheit für die Leser des MDAV noch einmal referiert;
auch hat er anschließend der Sorge, die einen Altphilologen bei solchen Ausführungen
überkommen muß, gebührend Ausdruck verliehen. Das Bedenklichste scheint mir hier schon
in dem zu stecken, was Seitz offenbar als vorweggenommene „Quintessenz" seinem Vortrag
voranstellte. Man muß sich die betreffenden Sätze, die in Maiers Referat auf S. 5 unten
nachzulesen sind, einmal langsam auf der Zunge zergehen lassen, um die eigentümliche
„Ontotogie", von der hier ausgegangen wird, sich zum Bewußtsein zu bringen:
„Europa und in seiner Mitte Deutschland würden zur Technologischen Kolonie' verkommen,
wenn sie sich nicht energisch beteiligten an den sich am Ende des zweiten Jahrtausends
vollziehenden Entwicklungen, die man als Technologische Revolution' zu verstehen habe. Zu
solcher Bereitschaft sei aber erst ein neues Bewußtsein unter den Menschen zu schaffen; dies
müßte die weltweiten Prozesse der wirtschaftlichen Auseinandersetzung der führenden Mächte
intensiv reflektieren und bis in die Bildungskonzeption der Länder reichende Konsequenzen
ziehen."
Die oberste „Idee", so ließe sich das etwa in die Sprache Platons transformieren, ist da also
offenbar (nicht etwa Seiendes und sich Gleichbleibendes, sondern) eine gewisse „sich vollzie-
hende Tnfw/ck/ung", genannt „technische Revolution"; an der Realisierung dieser Idee müssen
sich die Völker zwangsläufig, in einer Art von tätiger „beteiligen"; leider stecken sie
aber zur Zeit noch vielfach in einer Höhle von Unwissenheit und Blindheit; deshalb müssen die
wenigen in den Gang der Dinge Eingeweihten, um der Idee zu vermehrter Ausstrahlung in die
Menschenwelt zu verhelfen, den Leuten erst einmal ein entsprechendes „neues Bewußtsein"
einimpfen. - Bei dieser Denkstruktur, die mir übrigens fast mehr noch hegelisch als platonisch
geprägt scheint, wird also dem Bild des Menschen, sofern er sich noch vor kurzem (z.B. bei Kant)
als ein vernunftbegabtes und autonomes Wesen verstand, eine radikale Absage erteilt. Die
Menschen sollen nicht mehr ihrem eigenen Logos vertrauen, der zwar irren, aber auch sich
57