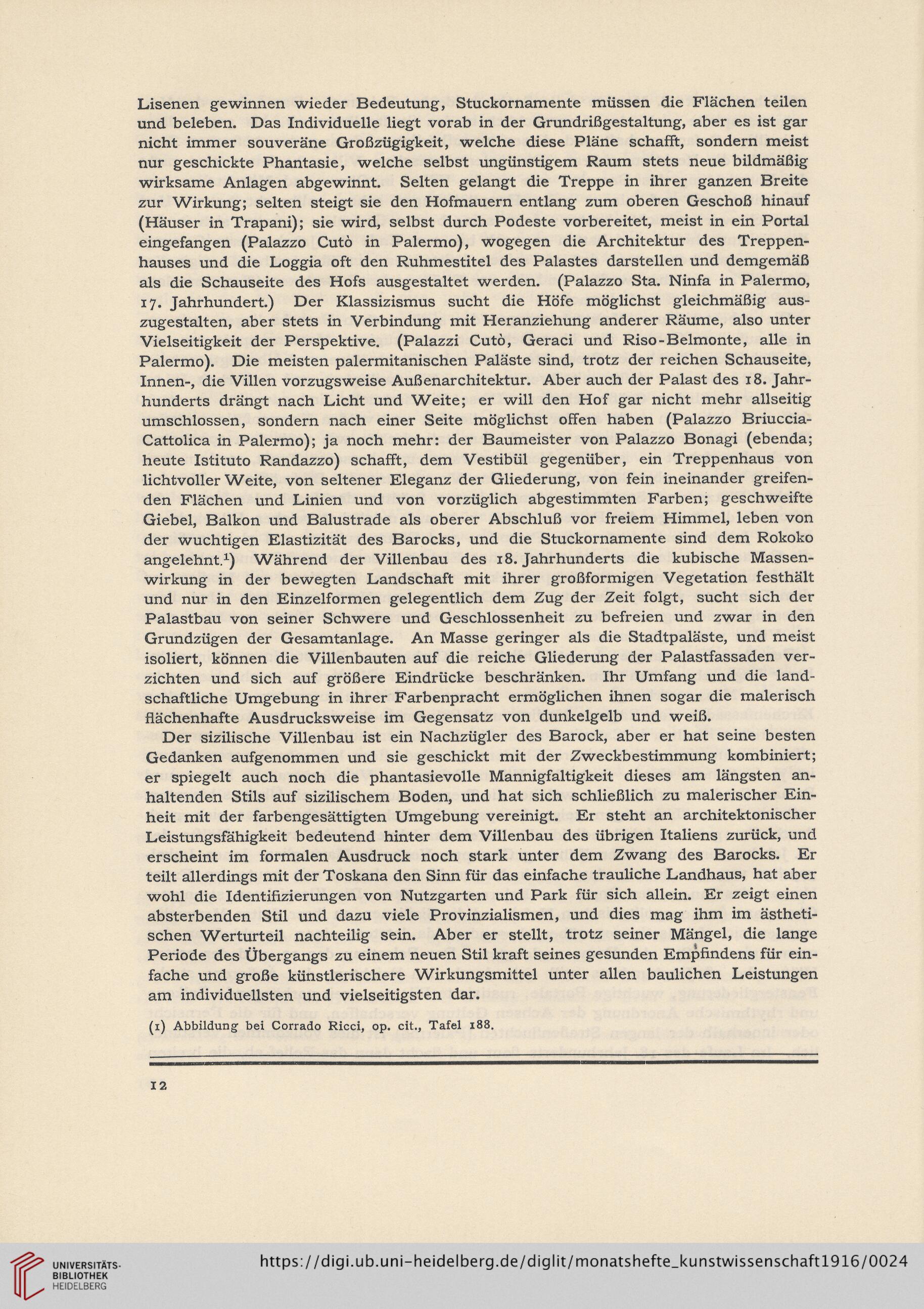Lisenen gewinnen wieder Bedeutung, Stuckornamente müssen die Flächen teilen
und beleben. Das Individuelle liegt vorab in der Grundrißgestaltung, aber es ist gar
nicht immer souveräne Großzügigkeit, welche diese Pläne schafft, sondern meist
nur geschickte Phantasie, welche selbst ungünstigem Raum stets neue bildmäßig
wirksame Anlagen abgewinnt. Selten gelangt die Treppe in ihrer ganzen Breite
zur Wirkung; selten steigt sie den Hofmauern entlang zum oberen Geschoß hinauf
(Häuser in Trapani); sie wird, selbst durch Podeste vorbereitet, meist in ein Portal
eingefangen (Palazzo Cuto in Palermo), wogegen die Architektur des Treppen-
hauses und die Loggia oft den Ruhmestitel des Palastes darstellen und demgemäß
als die Schauseite des Hofs ausgestaltet werden. (Palazzo Sta. Ninfa in Palermo,
17. Jahrhundert.) Der Klassizismus sucht die Höfe möglichst gleichmäßig aus-
zugestalten, aber stets in Verbindung mit Heranziehung anderer Räume, also unter
Vielseitigkeit der Perspektive. (Palazzi Cuto, Geraci und Riso-Belmonte, alle in
Palermo). Die meisten palermitanischen Paläste sind, trotz der reichen Schauseite,
Innen-, die Villen vorzugsweise Außenarchitektur. Aber auch der Palast des 18. Jahr-
hunderts drängt nach Licht und Weite; er will den Hof gar nicht mehr allseitig
umschlossen, sondern nach einer Seite möglichst offen haben (Palazzo Briuccia-
Cattolica in Palermo); ja noch mehr: der Baumeister von Palazzo Bonagi (ebenda;
heute Istituto Randazzo) schafft, dem Vestibül gegenüber, ein Treppenhaus von
lichtvoller Weite, von seltener Eleganz der Gliederung, von fein ineinander greifen-
den Flächen und Linien und von vorzüglich abgestimmten Farben; geschweifte
Giebel, Balkon und Balustrade als oberer Abschluß vor freiem Himmel, leben von
der wuchtigen Elastizität des Barocks, und die Stuckornamente sind dem Rokoko
angelehnt.1) Während der Villenbau des 18. Jahrhunderts die kubische Massen-
wirkung in der bewegten Landschaft mit ihrer großformigen Vegetation festhält
und nur in den Einzelformen gelegentlich dem Zug der Zeit folgt, sucht sich der
Palastbau von seiner Schwere und Geschlossenheit zu befreien und zwar in den
Grundzügen der Gesamtanlage. An Masse geringer als die Stadtpaläste, und meist
isoliert, können die Villenbauten auf die reiche Gliederung der Palastfassaden ver-
zichten und sich auf größere Eindrücke beschränken. Ihr Umfang und die land-
schaftliche Umgebung in ihrer Farbenpracht ermöglichen ihnen sogar die malerisch
flächenhafte Ausdrucksweise im Gegensatz von dunkelgelb und weiß.
Der sizilische Villenbau ist ein Nachzügler des Barock, aber er hat seine besten
Gedanken aufgenommen und sie geschickt mit der Zweckbestimmung kombiniert;
er spiegelt auch noch die phantasievolle Mannigfaltigkeit dieses am längsten an-
haltenden Stils auf sizilischem Boden, und hat sich schließlich zu malerischer Ein-
heit mit der farbengesättigten Umgebung vereinigt. Er steht an architektonischer
Leistungsfähigkeit bedeutend hinter dem Villenbau des übrigen Italiens zurück, und
erscheint im formalen Ausdruck noch stark unter dem Zwang des Barocks. Er
teilt allerdings mit der Toskana den Sinn für das einfache trauliche Landhaus, hat aber
wohl die Identifizierungen von Nutzgarten und Park für sich allein. Er zeigt einen
absterbenden Stil und dazu viele Provinzialismen, und dies mag ihm im ästheti-
schen Werturteil nachteilig sein. Aber er stellt, trotz seiner Mängel, die lange
Periode des Übergangs zu einem neuen Stil kraft seines gesunden Empfindens für ein-
fache und große künstlerischere Wirkungsmittel unter allen baulichen Leistungen
am individuellsten und vielseitigsten dar.
(1) Abbildung bei Corrado Ricci, op. cit., Tafel 188.
12
und beleben. Das Individuelle liegt vorab in der Grundrißgestaltung, aber es ist gar
nicht immer souveräne Großzügigkeit, welche diese Pläne schafft, sondern meist
nur geschickte Phantasie, welche selbst ungünstigem Raum stets neue bildmäßig
wirksame Anlagen abgewinnt. Selten gelangt die Treppe in ihrer ganzen Breite
zur Wirkung; selten steigt sie den Hofmauern entlang zum oberen Geschoß hinauf
(Häuser in Trapani); sie wird, selbst durch Podeste vorbereitet, meist in ein Portal
eingefangen (Palazzo Cuto in Palermo), wogegen die Architektur des Treppen-
hauses und die Loggia oft den Ruhmestitel des Palastes darstellen und demgemäß
als die Schauseite des Hofs ausgestaltet werden. (Palazzo Sta. Ninfa in Palermo,
17. Jahrhundert.) Der Klassizismus sucht die Höfe möglichst gleichmäßig aus-
zugestalten, aber stets in Verbindung mit Heranziehung anderer Räume, also unter
Vielseitigkeit der Perspektive. (Palazzi Cuto, Geraci und Riso-Belmonte, alle in
Palermo). Die meisten palermitanischen Paläste sind, trotz der reichen Schauseite,
Innen-, die Villen vorzugsweise Außenarchitektur. Aber auch der Palast des 18. Jahr-
hunderts drängt nach Licht und Weite; er will den Hof gar nicht mehr allseitig
umschlossen, sondern nach einer Seite möglichst offen haben (Palazzo Briuccia-
Cattolica in Palermo); ja noch mehr: der Baumeister von Palazzo Bonagi (ebenda;
heute Istituto Randazzo) schafft, dem Vestibül gegenüber, ein Treppenhaus von
lichtvoller Weite, von seltener Eleganz der Gliederung, von fein ineinander greifen-
den Flächen und Linien und von vorzüglich abgestimmten Farben; geschweifte
Giebel, Balkon und Balustrade als oberer Abschluß vor freiem Himmel, leben von
der wuchtigen Elastizität des Barocks, und die Stuckornamente sind dem Rokoko
angelehnt.1) Während der Villenbau des 18. Jahrhunderts die kubische Massen-
wirkung in der bewegten Landschaft mit ihrer großformigen Vegetation festhält
und nur in den Einzelformen gelegentlich dem Zug der Zeit folgt, sucht sich der
Palastbau von seiner Schwere und Geschlossenheit zu befreien und zwar in den
Grundzügen der Gesamtanlage. An Masse geringer als die Stadtpaläste, und meist
isoliert, können die Villenbauten auf die reiche Gliederung der Palastfassaden ver-
zichten und sich auf größere Eindrücke beschränken. Ihr Umfang und die land-
schaftliche Umgebung in ihrer Farbenpracht ermöglichen ihnen sogar die malerisch
flächenhafte Ausdrucksweise im Gegensatz von dunkelgelb und weiß.
Der sizilische Villenbau ist ein Nachzügler des Barock, aber er hat seine besten
Gedanken aufgenommen und sie geschickt mit der Zweckbestimmung kombiniert;
er spiegelt auch noch die phantasievolle Mannigfaltigkeit dieses am längsten an-
haltenden Stils auf sizilischem Boden, und hat sich schließlich zu malerischer Ein-
heit mit der farbengesättigten Umgebung vereinigt. Er steht an architektonischer
Leistungsfähigkeit bedeutend hinter dem Villenbau des übrigen Italiens zurück, und
erscheint im formalen Ausdruck noch stark unter dem Zwang des Barocks. Er
teilt allerdings mit der Toskana den Sinn für das einfache trauliche Landhaus, hat aber
wohl die Identifizierungen von Nutzgarten und Park für sich allein. Er zeigt einen
absterbenden Stil und dazu viele Provinzialismen, und dies mag ihm im ästheti-
schen Werturteil nachteilig sein. Aber er stellt, trotz seiner Mängel, die lange
Periode des Übergangs zu einem neuen Stil kraft seines gesunden Empfindens für ein-
fache und große künstlerischere Wirkungsmittel unter allen baulichen Leistungen
am individuellsten und vielseitigsten dar.
(1) Abbildung bei Corrado Ricci, op. cit., Tafel 188.
12