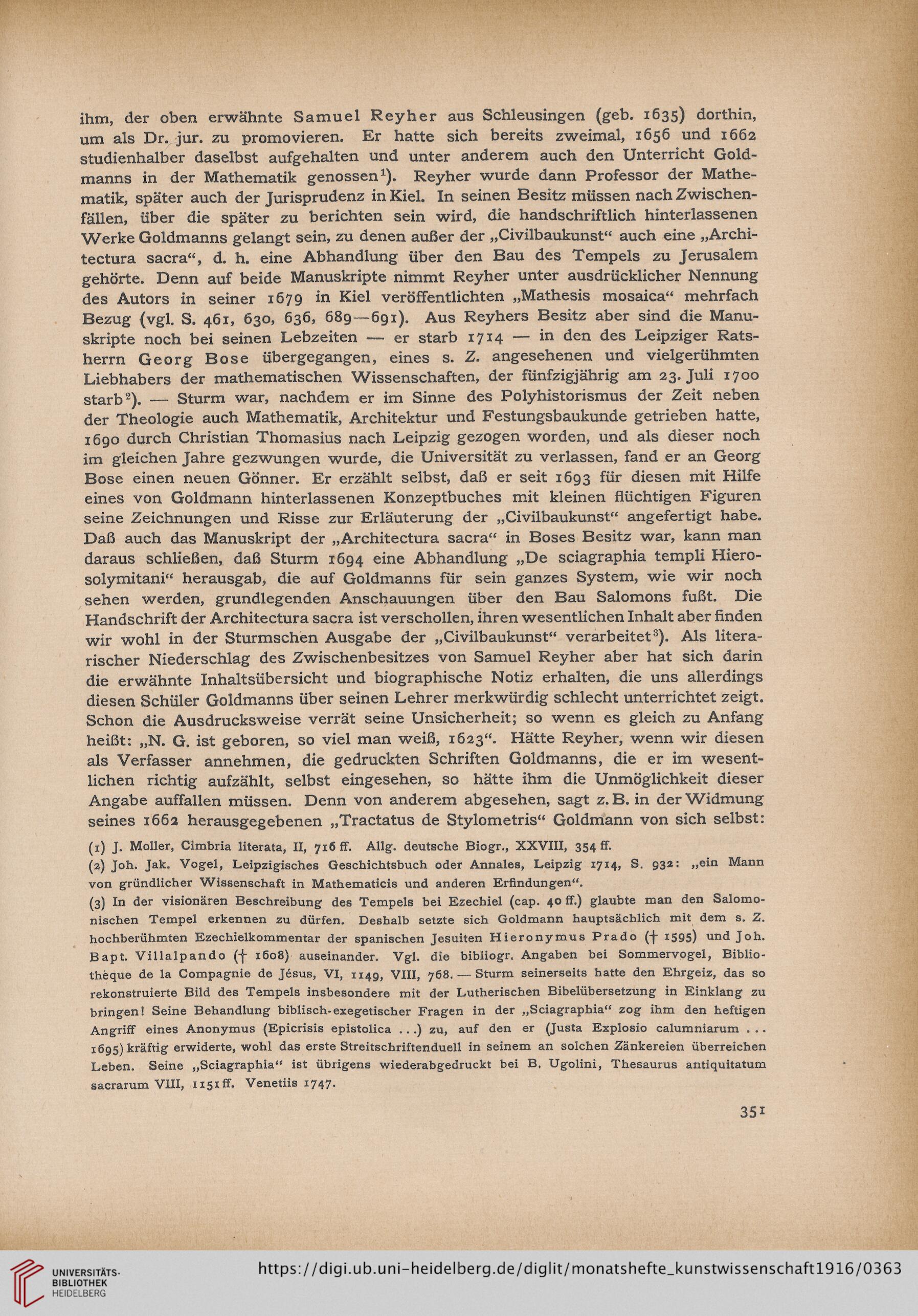ihm, der oben erwähnte Samuel Reyher aus Schleusingen (geb. 1635) dorthin,
um als Dr. jur. zu promovieren. Er hatte sich bereits zweimal, 1656 und 1662
studienhalber daselbst aufgehalten und unter anderem auch den Unterricht Gold-
manns in der Mathematik genossen1). Reyher wurde dann Professor der Mathe-
matik, später auch der Jurisprudenz in Kiel. In seinen Besitz müssen nach Zwischen-
fällen, über die später zu berichten sein wird, die handschriftlich hinterlassenen
Werke Goldmanns gelangt sein, zu denen außer der „Civilbaukunst“ auch eine „Archi-
tectura sacra“, d. h. eine Abhandlung über den Bau des Tempels zu Jerusalem
gehörte. Denn auf beide Manuskripte nimmt Reyher unter ausdrücklicher Nennung
des Autors in seiner 1679 in Kiel veröffentlichten „Mathesis mosaica“ mehrfach
Bezug (vgl. S. 461, 630, 636, 689—691). Aus Reyhers Besitz aber sind die Manu-
skripte noch bei seinen Lebzeiten — er starb 1714 — in den des Leipziger Rats-
herrn Georg Bose übergegangen, eines s. Z. angesehenen und vielgerühmten
Liebhabers der mathematischen Wissenschaften, der fünfzigjährig am 23. Juli 1700
starb2). — Sturm war, nachdem er im Sinne des Polyhistorismus der Zeit neben
der Theologie auch Mathematik, Architektur und Festungsbaukunde getrieben hatte,
1690 durch Christian Thomasius nach Leipzig gezogen worden, und als dieser noch
im gleichen Jahre gezwungen wurde, die Universität zu verlassen, fand er an Georg
Bose einen neuen Gönner. Er erzählt selbst, daß er seit 1693 für diesen mit Hilfe
eines von Goldmann hinterlassenen Konzeptbuches mit kleinen flüchtigen Figuren
seine Zeichnungen und Risse zur Erläuterung der „Civilbaukunst“ angefertigt habe.
Daß auch das Manuskript der „Architectura sacra“ in Boses Besitz war, kann man
daraus schließen, daß Sturm 1694 eine Abhandlung „De sciagraphia templi Hiero-
solymitani“ herausgab, die auf Goldmanns für sein ganzes System, wie wir noch
sehen werden, grundlegenden Anschauungen über den Bau Salomons fußt. Die
Handschrift der Architectura sacra ist verschollen, ihren wesentlichen Inhalt aber finden
wir wohl in der Sturmschen Ausgabe der „Civilbaukunst“ verarbeitet3). Als litera-
rischer Niederschlag des Zwischenbesitzes von Samuel Reyher aber hat sich darin
die erwähnte Inhaltsübersicht und biographische Notiz erhalten, die uns allerdings
diesen Schüler Goldmanns über seinen Lehrer merkwürdig schlecht unterrichtet zeigt.
Schon die Ausdrucksweise verrät seine Unsicherheit; so wenn es gleich zu Anfang
heißt: „N. G. ist geboren, so viel man weiß, 1623“. Hätte Reyher, wenn wir diesen
als Verfasser annehmen, die gedruckten Schriften Goldmanns, die er im wesent-
lichen richtig aufzählt, selbst eingesehen, so hätte ihm die Unmöglichkeit dieser
Angabe auffallen müssen. Denn von anderem abgesehen, sagt z. B. in der Widmung
seines 1662 herausgegebenen „Tractatus de Stylometris“ Goldmann von sich selbst:
(1) J. Moller, Cimbria literata, II, 716 ff. Allg. deutsche Biogr., XXVIII, 354 ff.
(2) Joh. Jak. Vogel, Leipzigisches Geschichtsbuch oder Annales, Leipzig 1714, S. 932: „ein Mann
von gründlicher Wissenschaft in Mathematicis und anderen Erfindungen“.
(3) In der visionären Beschreibung des Tempels bei Ezechiel (cap. 40 ff.) glaubte man den Salomo-
nischen Tempel erkennen zu dürfen. Deshalb setzte sich Goldmann hauptsächlich mit dem s. Z.
hochberühmten Ezechielkommentar der spanischen Jesuiten Hieronymus Prado (j- 1595) und Joh.
Bapt. Villalpando (j- 1608) auseinander. Vgl. die bibliogr. Angaben bei Sommervogel, Biblio-
theque de la Compagnie de Jesus, VI, 1149, VIII, 768. — Sturm seinerseits hatte den Ehrgeiz, das so
rekonstruierte Bild des Tempels insbesondere mit der Lutherischen Bibelübersetzung in Einklang zu
bringen! Seine Behandlung biblisch-exegetischer Fragen in der „Sciagraphia“ zog ihm den heftigen
Angriff eines Anonymus (Epicrisis epistolica ...) zu, auf den er (Justa Explosio calumniarum . ..
1695) kräftig erwiderte, wohl das erste Streitschriftenduell in seinem an solchen Zänkereien überreichen
Leben. Seine „Sciagraphia“ ist übrigens wiederabgedruckt bei B. Ugolini, Thesaurus antiquitatum
sacrarum VIII, usiff. Venetiis 1747.
351
um als Dr. jur. zu promovieren. Er hatte sich bereits zweimal, 1656 und 1662
studienhalber daselbst aufgehalten und unter anderem auch den Unterricht Gold-
manns in der Mathematik genossen1). Reyher wurde dann Professor der Mathe-
matik, später auch der Jurisprudenz in Kiel. In seinen Besitz müssen nach Zwischen-
fällen, über die später zu berichten sein wird, die handschriftlich hinterlassenen
Werke Goldmanns gelangt sein, zu denen außer der „Civilbaukunst“ auch eine „Archi-
tectura sacra“, d. h. eine Abhandlung über den Bau des Tempels zu Jerusalem
gehörte. Denn auf beide Manuskripte nimmt Reyher unter ausdrücklicher Nennung
des Autors in seiner 1679 in Kiel veröffentlichten „Mathesis mosaica“ mehrfach
Bezug (vgl. S. 461, 630, 636, 689—691). Aus Reyhers Besitz aber sind die Manu-
skripte noch bei seinen Lebzeiten — er starb 1714 — in den des Leipziger Rats-
herrn Georg Bose übergegangen, eines s. Z. angesehenen und vielgerühmten
Liebhabers der mathematischen Wissenschaften, der fünfzigjährig am 23. Juli 1700
starb2). — Sturm war, nachdem er im Sinne des Polyhistorismus der Zeit neben
der Theologie auch Mathematik, Architektur und Festungsbaukunde getrieben hatte,
1690 durch Christian Thomasius nach Leipzig gezogen worden, und als dieser noch
im gleichen Jahre gezwungen wurde, die Universität zu verlassen, fand er an Georg
Bose einen neuen Gönner. Er erzählt selbst, daß er seit 1693 für diesen mit Hilfe
eines von Goldmann hinterlassenen Konzeptbuches mit kleinen flüchtigen Figuren
seine Zeichnungen und Risse zur Erläuterung der „Civilbaukunst“ angefertigt habe.
Daß auch das Manuskript der „Architectura sacra“ in Boses Besitz war, kann man
daraus schließen, daß Sturm 1694 eine Abhandlung „De sciagraphia templi Hiero-
solymitani“ herausgab, die auf Goldmanns für sein ganzes System, wie wir noch
sehen werden, grundlegenden Anschauungen über den Bau Salomons fußt. Die
Handschrift der Architectura sacra ist verschollen, ihren wesentlichen Inhalt aber finden
wir wohl in der Sturmschen Ausgabe der „Civilbaukunst“ verarbeitet3). Als litera-
rischer Niederschlag des Zwischenbesitzes von Samuel Reyher aber hat sich darin
die erwähnte Inhaltsübersicht und biographische Notiz erhalten, die uns allerdings
diesen Schüler Goldmanns über seinen Lehrer merkwürdig schlecht unterrichtet zeigt.
Schon die Ausdrucksweise verrät seine Unsicherheit; so wenn es gleich zu Anfang
heißt: „N. G. ist geboren, so viel man weiß, 1623“. Hätte Reyher, wenn wir diesen
als Verfasser annehmen, die gedruckten Schriften Goldmanns, die er im wesent-
lichen richtig aufzählt, selbst eingesehen, so hätte ihm die Unmöglichkeit dieser
Angabe auffallen müssen. Denn von anderem abgesehen, sagt z. B. in der Widmung
seines 1662 herausgegebenen „Tractatus de Stylometris“ Goldmann von sich selbst:
(1) J. Moller, Cimbria literata, II, 716 ff. Allg. deutsche Biogr., XXVIII, 354 ff.
(2) Joh. Jak. Vogel, Leipzigisches Geschichtsbuch oder Annales, Leipzig 1714, S. 932: „ein Mann
von gründlicher Wissenschaft in Mathematicis und anderen Erfindungen“.
(3) In der visionären Beschreibung des Tempels bei Ezechiel (cap. 40 ff.) glaubte man den Salomo-
nischen Tempel erkennen zu dürfen. Deshalb setzte sich Goldmann hauptsächlich mit dem s. Z.
hochberühmten Ezechielkommentar der spanischen Jesuiten Hieronymus Prado (j- 1595) und Joh.
Bapt. Villalpando (j- 1608) auseinander. Vgl. die bibliogr. Angaben bei Sommervogel, Biblio-
theque de la Compagnie de Jesus, VI, 1149, VIII, 768. — Sturm seinerseits hatte den Ehrgeiz, das so
rekonstruierte Bild des Tempels insbesondere mit der Lutherischen Bibelübersetzung in Einklang zu
bringen! Seine Behandlung biblisch-exegetischer Fragen in der „Sciagraphia“ zog ihm den heftigen
Angriff eines Anonymus (Epicrisis epistolica ...) zu, auf den er (Justa Explosio calumniarum . ..
1695) kräftig erwiderte, wohl das erste Streitschriftenduell in seinem an solchen Zänkereien überreichen
Leben. Seine „Sciagraphia“ ist übrigens wiederabgedruckt bei B. Ugolini, Thesaurus antiquitatum
sacrarum VIII, usiff. Venetiis 1747.
351