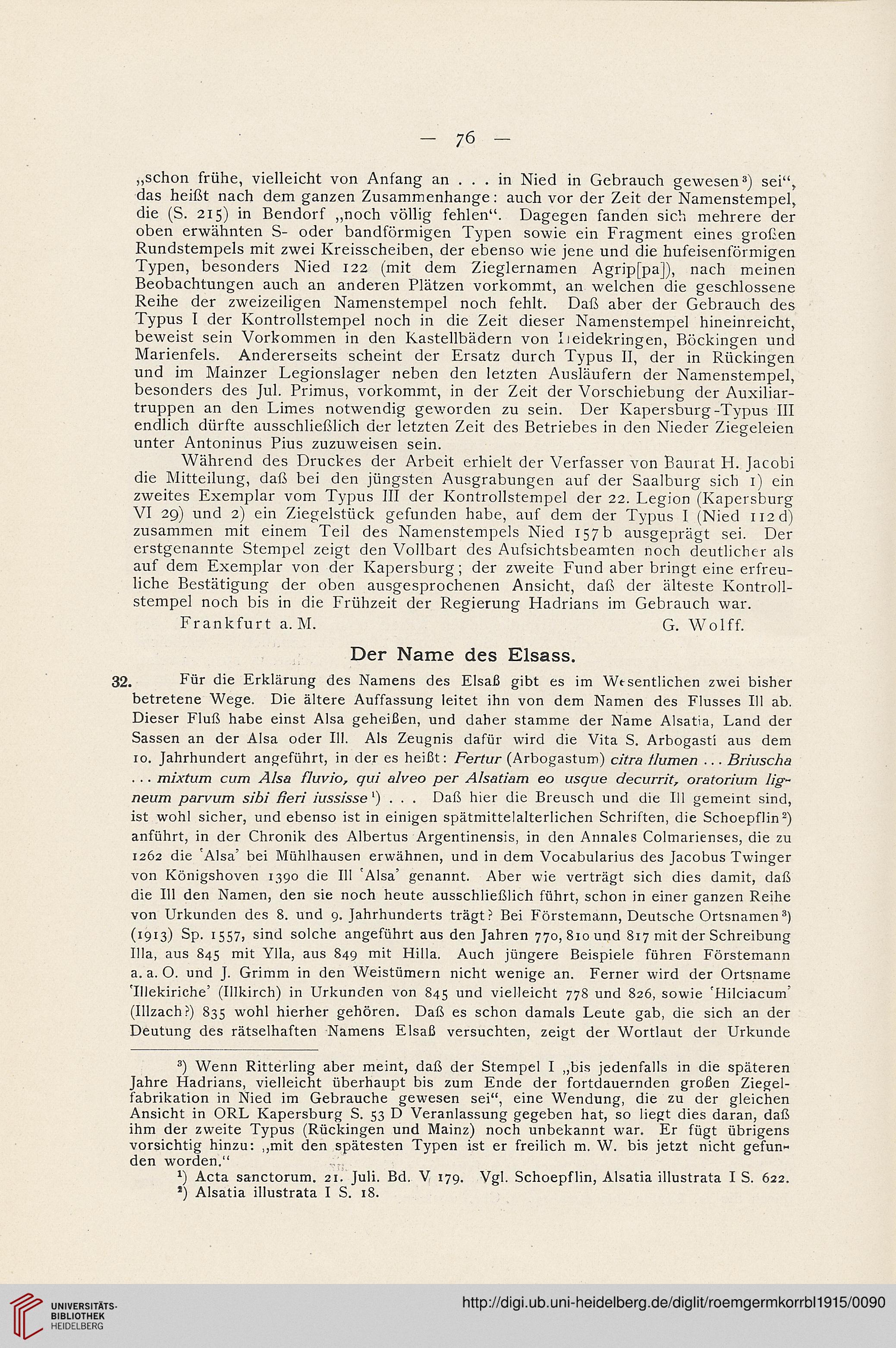76
„schon frühe, vielleicht von Anfang an . . . in Nied in Gebrauch gewesen 3) sei“,
das heißt nach dem ganzen Zusammenhange : auch vor der Zeit der Namenstempel,
die (S. 215) in Bendorf „noch völlig fehlen“. Dagegen fanden sich mehrere der
oben erwähnten S- oder bandförmigen Typen sowie ein Fragment eines großen
Rundstempels mit zwei Kreisscheiben, der ebenso wie jene und die hufeisenförmigen
Typen, besonders Nied 122 (mit dem Zieglernamen Agrip[pa]), nach meinen
Beobachtungen auch an anderen Plätzen vorkommt, an welchen die geschlossene
Reihe der zweizeiligen Namenstempel noch fehlt. Daß aber der Gebrauch des
Typus I der Kontrollstempel noch in die Zeit dieser Namenstempel hineinreicht,
beweist sein Vorkommen in den Kastellbädern von Iieidekringen, Böckingen und
Marienfels. Andererseits scheint der Ersatz durch Typus II, der in Rückingen
und im Mainzer Legionslager neben den letzten Ausläufern der Namenstempel,
besonders des Jul. Primus, vorkommt, in der Zeit der Vorscbiebung der Auxiliar-
truppen an den Limes notwendig geworden zu sein. Der Kapersburg-Typus III
endlich diirfte ausschließlich der letzten Zeit des Betriebes in den Nieder Ziegeleien
unter Antoninus Pius zuzuweisen sein.
Während des Druckes der Arbeit erhielt der Verfasser von Baurat H. Jacobi
die Mitteilung, daß bei den jüngsten Ausgrabungen auf der Saalburg sich 1) ein
zweites Exemplar vom Typus III der Kontrollstempel der 22. Legion (Kapersburg
VI 29) und 2) ein Ziegelstück gefunden habe, auf dem der Typus I (Nied Ii2d)
zusammen mit einem Teil des Namenstempels Nied 157b ausgeprägt sei. Der
erstgenannte Stempel zeigt den Vollbart des Aufsichtsbeamten noch deutlicher als
auf dem Exemplar von der Kapersburg ; der zweite Fund aber bringt eine erfreu-
liche Bestätigung der oben ausgesprochenen Ansicht, daß der älteste Kontroll-
stempel noch bis in die Frühzeit der Regierung Hadrians im Gebrauch war.
Frankfurt a. M. G. Wolff.
Der Name des Elsass.
32. Für die Erklärung des Namens des Elsaß gibt es im Wrsentlichen zwei bisher
betretene Wege. Die ältere Auffassung leitet ihn von dem Namen des Flusses 111 ab.
Dieser Fluß habe einst Alsa geheißen, und daher stamme der Name Alsatia, Land der
Sassen an der Alsa oder 111. Als Zeugnis dafür wird die Vita S. Arbogasti aus dem
10. Jahrhundert angeführt, in der es heißt: Fertur (Arbogastum) citra tlumen ... Briuscha
. . . mixtum cum Alsa fluvio, qui a/veo per Alsatiam eo usque decurrit, oratorium lig-
neum parvum sibi fieri iussisse') . ■ . Daß hier die Breusch und die III gemeint sind,
ist wohl sicher, und ebenso ist in einigen spätmittelalterlichen Schriften, die Schoepflin 2)
anführt, in der Chronik des Albertus Argentinensis, in den Annales Colmarienses, die zu
1262 die 'Alsa’ bei Mühlhausen erwähnen, und in dem Vocabularius des Jacobus Twinger
von Königshoven 1390 die III 'Alsa’ genannt. Aber wie verträgt sich dies damit, daß
die 111 den Namen, den sie noch heute ausschließlich führt, schon in einer ganzen Reihe
von Urkunden des 8. und 9. Jahrhunderts trägt? Bei Förstemann, Deutsche Ortsnamen 3)
(1913) Sp. 1557, sind solche angeführt aus den Jahren 770, 810 und 817 mit der Schreibung
Illa, aus 845 mit Ylla, aus 849 mit Hilla. Auch jüngere Beispiele führen Förstemann
a. a. O. und J. Grimm in den Weistümern nicht wenige an. Ferner wird der Ortsname
'Hiekiriche’ (Illkirch) in Urkunden von 845 und vielleicht 778 und 826, sowie 'Hilciacum
(Illzach?) 835 wohl hierher gehören. Daß es schon damals Leute gab, die sich an der
Deutung des rätselhaften Namens Elsaß versuchten, zeigt der Wortlaut der Urkunde
3) Wenn Ritterling aber meint, daß der Stempel I „bis jedenfalls in die späteren
Jahre Hadrians, vielleicht überhaupt bis zum Ende der fortdauernden großen Ziegel-
fabrikation in Nied im Gebrauche gewesen sei“, eine Wendung, die zu der gleichen
Ansicht in ORL Kapersburg S. 53 D Veranlassung gegeben hat, so liegt dies daran, daß
ihm der zweite Typus (Rückingen und Mainz) noch unbekannt war. Er fügt übrigens
vorsichtig hinzu: „mit den spätesten Typen ist er freilich m. W. bis jetzt nicht gefun-
den worden.“
*) Acta sanctorum. 21. Juli. Bd. V 179. Vgl. Schoepflin, Alsatia illustrata I S. 622.
*) Alsatia illustrata I S. 18.
„schon frühe, vielleicht von Anfang an . . . in Nied in Gebrauch gewesen 3) sei“,
das heißt nach dem ganzen Zusammenhange : auch vor der Zeit der Namenstempel,
die (S. 215) in Bendorf „noch völlig fehlen“. Dagegen fanden sich mehrere der
oben erwähnten S- oder bandförmigen Typen sowie ein Fragment eines großen
Rundstempels mit zwei Kreisscheiben, der ebenso wie jene und die hufeisenförmigen
Typen, besonders Nied 122 (mit dem Zieglernamen Agrip[pa]), nach meinen
Beobachtungen auch an anderen Plätzen vorkommt, an welchen die geschlossene
Reihe der zweizeiligen Namenstempel noch fehlt. Daß aber der Gebrauch des
Typus I der Kontrollstempel noch in die Zeit dieser Namenstempel hineinreicht,
beweist sein Vorkommen in den Kastellbädern von Iieidekringen, Böckingen und
Marienfels. Andererseits scheint der Ersatz durch Typus II, der in Rückingen
und im Mainzer Legionslager neben den letzten Ausläufern der Namenstempel,
besonders des Jul. Primus, vorkommt, in der Zeit der Vorscbiebung der Auxiliar-
truppen an den Limes notwendig geworden zu sein. Der Kapersburg-Typus III
endlich diirfte ausschließlich der letzten Zeit des Betriebes in den Nieder Ziegeleien
unter Antoninus Pius zuzuweisen sein.
Während des Druckes der Arbeit erhielt der Verfasser von Baurat H. Jacobi
die Mitteilung, daß bei den jüngsten Ausgrabungen auf der Saalburg sich 1) ein
zweites Exemplar vom Typus III der Kontrollstempel der 22. Legion (Kapersburg
VI 29) und 2) ein Ziegelstück gefunden habe, auf dem der Typus I (Nied Ii2d)
zusammen mit einem Teil des Namenstempels Nied 157b ausgeprägt sei. Der
erstgenannte Stempel zeigt den Vollbart des Aufsichtsbeamten noch deutlicher als
auf dem Exemplar von der Kapersburg ; der zweite Fund aber bringt eine erfreu-
liche Bestätigung der oben ausgesprochenen Ansicht, daß der älteste Kontroll-
stempel noch bis in die Frühzeit der Regierung Hadrians im Gebrauch war.
Frankfurt a. M. G. Wolff.
Der Name des Elsass.
32. Für die Erklärung des Namens des Elsaß gibt es im Wrsentlichen zwei bisher
betretene Wege. Die ältere Auffassung leitet ihn von dem Namen des Flusses 111 ab.
Dieser Fluß habe einst Alsa geheißen, und daher stamme der Name Alsatia, Land der
Sassen an der Alsa oder 111. Als Zeugnis dafür wird die Vita S. Arbogasti aus dem
10. Jahrhundert angeführt, in der es heißt: Fertur (Arbogastum) citra tlumen ... Briuscha
. . . mixtum cum Alsa fluvio, qui a/veo per Alsatiam eo usque decurrit, oratorium lig-
neum parvum sibi fieri iussisse') . ■ . Daß hier die Breusch und die III gemeint sind,
ist wohl sicher, und ebenso ist in einigen spätmittelalterlichen Schriften, die Schoepflin 2)
anführt, in der Chronik des Albertus Argentinensis, in den Annales Colmarienses, die zu
1262 die 'Alsa’ bei Mühlhausen erwähnen, und in dem Vocabularius des Jacobus Twinger
von Königshoven 1390 die III 'Alsa’ genannt. Aber wie verträgt sich dies damit, daß
die 111 den Namen, den sie noch heute ausschließlich führt, schon in einer ganzen Reihe
von Urkunden des 8. und 9. Jahrhunderts trägt? Bei Förstemann, Deutsche Ortsnamen 3)
(1913) Sp. 1557, sind solche angeführt aus den Jahren 770, 810 und 817 mit der Schreibung
Illa, aus 845 mit Ylla, aus 849 mit Hilla. Auch jüngere Beispiele führen Förstemann
a. a. O. und J. Grimm in den Weistümern nicht wenige an. Ferner wird der Ortsname
'Hiekiriche’ (Illkirch) in Urkunden von 845 und vielleicht 778 und 826, sowie 'Hilciacum
(Illzach?) 835 wohl hierher gehören. Daß es schon damals Leute gab, die sich an der
Deutung des rätselhaften Namens Elsaß versuchten, zeigt der Wortlaut der Urkunde
3) Wenn Ritterling aber meint, daß der Stempel I „bis jedenfalls in die späteren
Jahre Hadrians, vielleicht überhaupt bis zum Ende der fortdauernden großen Ziegel-
fabrikation in Nied im Gebrauche gewesen sei“, eine Wendung, die zu der gleichen
Ansicht in ORL Kapersburg S. 53 D Veranlassung gegeben hat, so liegt dies daran, daß
ihm der zweite Typus (Rückingen und Mainz) noch unbekannt war. Er fügt übrigens
vorsichtig hinzu: „mit den spätesten Typen ist er freilich m. W. bis jetzt nicht gefun-
den worden.“
*) Acta sanctorum. 21. Juli. Bd. V 179. Vgl. Schoepflin, Alsatia illustrata I S. 622.
*) Alsatia illustrata I S. 18.