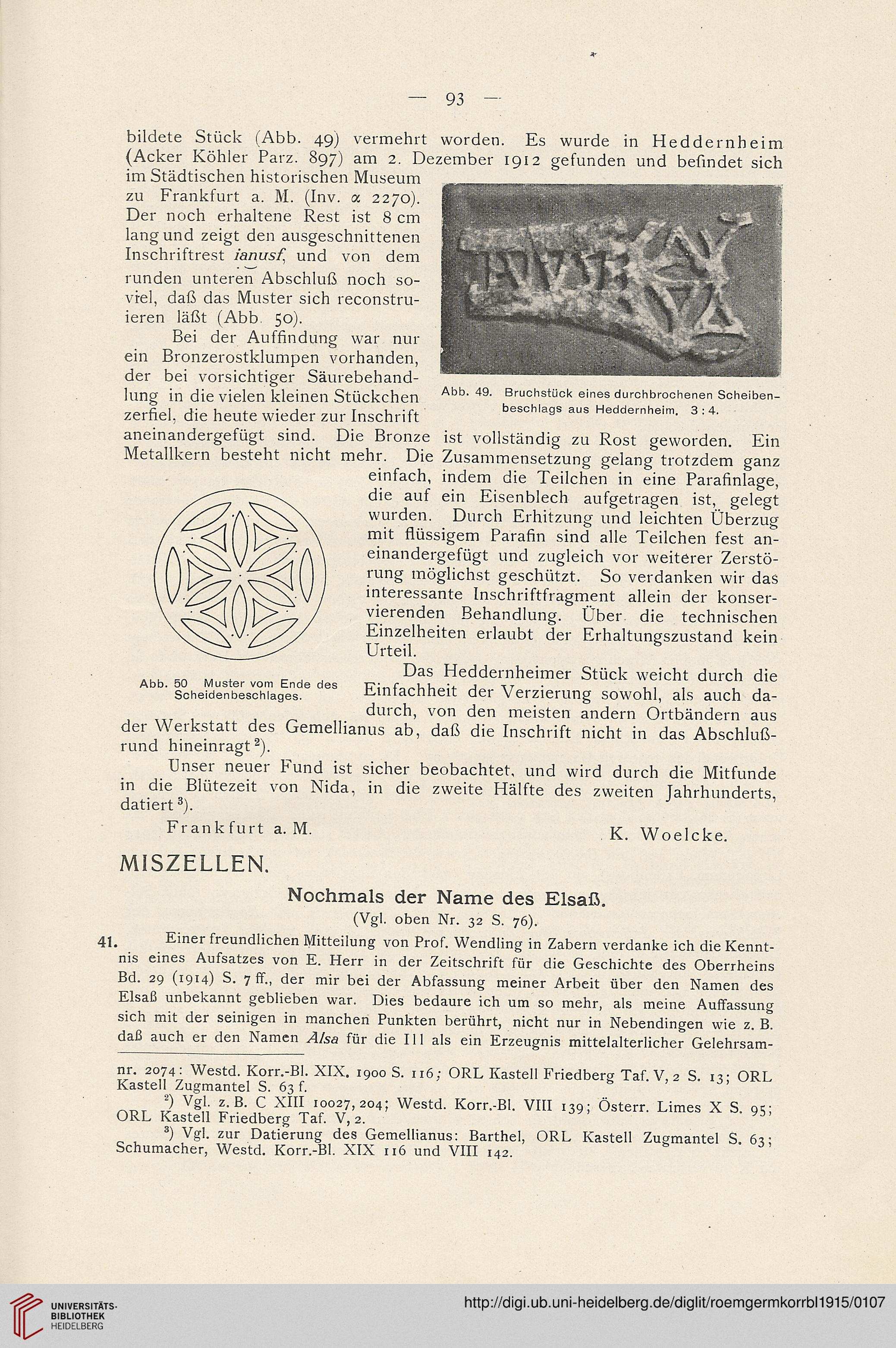93
Abb. 49. Bruchstück eines durchbrochenen Scheiben-
beschlags aus Heddernheim, 3:4.
bildete Stück (Abb. 49) vermehrt worden. Es wurde in Heddernheim
(Acker Kôhler Parz. 897) am 2. Dezember 1912 gefunden und befindet sich
im Stâdtischen historischen Museum
zu Frankfurt a. M. (Inv. α 2270).
Der noch erhaltene Rest ist 8 cm
langund zeigt den ausgeschnittenen
Inschriftrest ianusf, und von dem
runden unteren Abschluß noch so-
vrel, daß das Muster sich reconstru-
ieren läßt (Abb. 5°)·
Bei der Auffindung war nur
ein Bronzerostklumpen vorhanden,
der bei vorsichtiger Sâurebehand-
lung in die vielen kleinen Stückchen
zerfiel, die heute wieder zur Inschrift
aneinandergefügt sind. Die Bronze ist vollstândig zu Rost geworden. Ein
Metallkern besteht nicht mehr. Die Zusammensetzung gelang trotzdem ganz
einfach, indem die Teilchen in eine Parafinlage,
die auf ein Eisenblech aufgetragen ist, gelegt
wurden. Durch Erhitzung und leichten Überzug
mit flüssigem Parafin sind alle Teilchen fest an-
einandergefügt und zugleich vor weiterer Zerstô-
rung môglichst geschützt. So verdanken wir das
interessante Inschriftfragment allein der konser-
vierenden Behandlung. Über die technischen
Einzelheiten erlaubt der Erhaltungszustand kein
Urteil.
Das Heddernheimer Stück weicht durch die
Einfachheit der Verzierung sowohl, als auch da-
durch, von den meisten andern Ortbândern aus
der Werkstatt des Gemellianus ab, daß die Inschrift nicht in das Abschluß-
rund hineinragt * 2).
Unser neuer Fund ist sicher beobachtet, und wird durch die Mitfunde
in die Blütezeit von Nida, in die zweite Halfte des zweiten Jahrhunderts,
datiert 3).
Frankfurt a. M. K. Woelcke.
Abb. 50 Muster vom Ende des
Scheidenbeschlages.
MISZELLEN.
Nochmals der Name des Elsaß.
(Vgl. oben Nr. 32 S. 76).
4J. Einer freundlichen Mitteilung von Prof. Wendling in Zabern verdanke ich die Kennt-
nis eines Aufsatzes von E. Herr in der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins
Bd. 29 (1914) S. 7 ff., der mir bei der Abfassung meiner Arbeit über den Namen des
Elsaß unbekannt geblieben war. Dies bedaure ich um so mehr, als meine Auffassung
sich mit der seinigen in manchen Punkten berührt, nicht nur in Nebendingen wie z. B.
daß auch er den Namen Alsa für die 111 als ein Erzeugnis mittelalterlicher Gelehrsam-
nr. 2074: Westd. Korr.-Bl. XIX, 1900 S. 116; ORL Kastell ï'riedberg Taf. V, 2 S. 13; ORL
Kastell Zugmantel S. 63 f.
2) Vgl. z. B. C XIII 10027,204; Westd. Korr.-BI. VIII 139; Österr. Limes X S. 95;
ORL Kastell Friedberg Taf. V, 2.
3) Vgl. zur Datierung des Gemellianus: Barthel, ORL Kastell Zugmantel S. 63;
Schumacher, Westd. Korr.-Bl. XIX 116 und VIII 142.
Abb. 49. Bruchstück eines durchbrochenen Scheiben-
beschlags aus Heddernheim, 3:4.
bildete Stück (Abb. 49) vermehrt worden. Es wurde in Heddernheim
(Acker Kôhler Parz. 897) am 2. Dezember 1912 gefunden und befindet sich
im Stâdtischen historischen Museum
zu Frankfurt a. M. (Inv. α 2270).
Der noch erhaltene Rest ist 8 cm
langund zeigt den ausgeschnittenen
Inschriftrest ianusf, und von dem
runden unteren Abschluß noch so-
vrel, daß das Muster sich reconstru-
ieren läßt (Abb. 5°)·
Bei der Auffindung war nur
ein Bronzerostklumpen vorhanden,
der bei vorsichtiger Sâurebehand-
lung in die vielen kleinen Stückchen
zerfiel, die heute wieder zur Inschrift
aneinandergefügt sind. Die Bronze ist vollstândig zu Rost geworden. Ein
Metallkern besteht nicht mehr. Die Zusammensetzung gelang trotzdem ganz
einfach, indem die Teilchen in eine Parafinlage,
die auf ein Eisenblech aufgetragen ist, gelegt
wurden. Durch Erhitzung und leichten Überzug
mit flüssigem Parafin sind alle Teilchen fest an-
einandergefügt und zugleich vor weiterer Zerstô-
rung môglichst geschützt. So verdanken wir das
interessante Inschriftfragment allein der konser-
vierenden Behandlung. Über die technischen
Einzelheiten erlaubt der Erhaltungszustand kein
Urteil.
Das Heddernheimer Stück weicht durch die
Einfachheit der Verzierung sowohl, als auch da-
durch, von den meisten andern Ortbândern aus
der Werkstatt des Gemellianus ab, daß die Inschrift nicht in das Abschluß-
rund hineinragt * 2).
Unser neuer Fund ist sicher beobachtet, und wird durch die Mitfunde
in die Blütezeit von Nida, in die zweite Halfte des zweiten Jahrhunderts,
datiert 3).
Frankfurt a. M. K. Woelcke.
Abb. 50 Muster vom Ende des
Scheidenbeschlages.
MISZELLEN.
Nochmals der Name des Elsaß.
(Vgl. oben Nr. 32 S. 76).
4J. Einer freundlichen Mitteilung von Prof. Wendling in Zabern verdanke ich die Kennt-
nis eines Aufsatzes von E. Herr in der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins
Bd. 29 (1914) S. 7 ff., der mir bei der Abfassung meiner Arbeit über den Namen des
Elsaß unbekannt geblieben war. Dies bedaure ich um so mehr, als meine Auffassung
sich mit der seinigen in manchen Punkten berührt, nicht nur in Nebendingen wie z. B.
daß auch er den Namen Alsa für die 111 als ein Erzeugnis mittelalterlicher Gelehrsam-
nr. 2074: Westd. Korr.-Bl. XIX, 1900 S. 116; ORL Kastell ï'riedberg Taf. V, 2 S. 13; ORL
Kastell Zugmantel S. 63 f.
2) Vgl. z. B. C XIII 10027,204; Westd. Korr.-BI. VIII 139; Österr. Limes X S. 95;
ORL Kastell Friedberg Taf. V, 2.
3) Vgl. zur Datierung des Gemellianus: Barthel, ORL Kastell Zugmantel S. 63;
Schumacher, Westd. Korr.-Bl. XIX 116 und VIII 142.