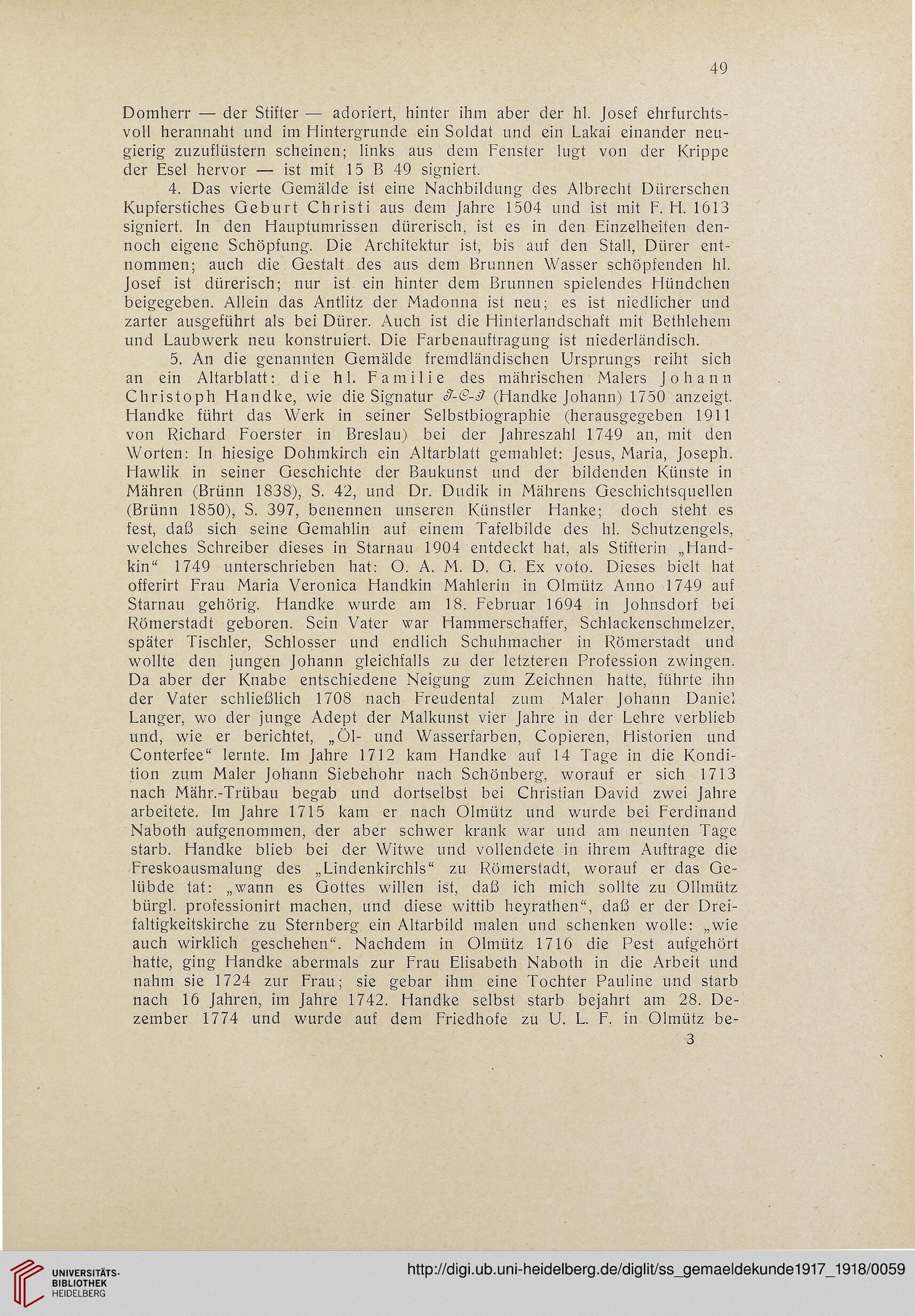49
Domherr — der Stifter — adoriert, hinter ihm aber der hl. Josef ehrfurchts-
voll herannaht und im Hintergründe ein Soldat und ein Lakai einander neu-
gierig zuzuflüstern scheinen; links aus dem Fenster lugt von der Krippe
der Esel hervor — ist mit 15 B 49 signiert.
4. Das vierte Gemälde ist eine Nachbildung des Albrecht Dürerschen
Kupferstiches Geburt Christi aus dem Jahre 1504 und ist mit F. H. 1613
signiert. In den Hauptumrissen dürerisch, ist es in den Einzelheiten den-
noch eigene Schöpfung. Die Architektur ist, bis auf den Stall, Dürer ent-
nommen; auch die Gestalt des aus dem Brunnen Wasser schöpfenden hl.
Josef ist dürerisch; nur ist ein hinter dem Brunnen spielendes Hündchen
beigegeben. Allein das Antlitz der Madonna ist neu; es ist niedlicher und
zarter ausgeführt als bei Dürer. Auch ist die Hinterlandschaft mit Bethlehem
und Laubwerk neu konstruiert. Die Farbenauftragung ist niederländisch.
5. An die genannten Gemälde fremdländischen Ursprungs reiht sich
an ein Altarblatt: die hl. Familie des mährischen Malers Johann
Christoph Handke, wie dieSignatur 3-Q-3 (Handke Johann) 1750 anzeigt.
Handke führt das Werk in seiner Selbstbiographie (herausgegeben 1911
von Richard Foerster in Breslau) bei der Jahreszahl 1749 an, mit den
Worten: In hiesige Dohmkirch ein Altarblatt gemahlet: Jesus, Maria, Joseph.
Hawlik in seiner Geschichte der Baukunst und der bildenden Künste in
Mähren (Brünn 1838), S. 42, und Dr. Dudik in Mährens Geschichtsquellen
(Brünn 1850), S. 397, benennen unseren Künstler Hanke; doch steht es
fest, daß sich seine Gemahlin auf einem Tafelbilde des hl. Schutzengels,
welches Schreiber dieses in Starnau 1904 entdeckt hat, als Stifterin „Hand-
kin“ 1749 unterschrieben hat: O. A. M. D. G. Ex voto. Dieses bielt hat
offerirt Frau Maria Veronica Handkin Mahlerin in Olmütz Anno 1749 auf
Starnau gehörig. Handke wurde am 18. Februar 1694 in Johnsdorf bei
Römerstadt geboren. Sein Vater war Hammerschaffer, Schlackenschmelzer,
später Tischler, Schlosser und endlich Schuhmacher in Römerstadt und
wollte den jungen Johann gleichfalls zu der letzteren Profession zwingen.
Da aber der Knabe entschiedene Neigung zum Zeichnen hatte, führte ihn
der Vater schließlich 1708 nach Freudental zum Maler Johann Daniel
Langer, wo der junge Adept der Malkunst vier Jahre in der Lehre verblieb
und, wie er berichtet, „Öl- und Wasserfarben, Copieren, Historien und
Conterfee“ lernte. Im Jahre 1712 kam Handke auf 14 Tage in die Kondi-
tion zum Maler Johann Siebehohr nach Schönberg, worauf er sich 1713
nach Mähr.-Trübau begab und dortselbs! bei Christian David zwei Jahre
arbeitete. Im Jahre 1715 kam er nach Olmütz und wurde bei Ferdinand
Naboth aufgenommen, der aber schwer krank war und am neunten Tage
starb. Handke blieb bei der Witwe und vollendete in ihrem Auftrage die
Freskoausmalung des „Lindenkirchls“ zu Römerstadt, worauf er das Ge-
lübde tat: „wann es Gottes willen ist, daß ich mich sollte zu Ollmütz
bürgl. professionirt machen, und diese wittib heyrathen“, daß er der Drei-
faltigkeitskirche zu Sternberg ein Altarbild malen und schenken wolle: „wie
auch wirklich geschehen“. Nachdem in Olmütz 1716 die Pest aufgehört
hatte, ging Handke abermals zur Frau Elisabeth Naboth in die Arbeit und
nahm sie 1724 zur Frau; sie gebar ihm eine Tochter Pauline und starb
nach 16 Jahren, im Jahre 1742. Handke selbst starb bejahrt am 28. De-
zember 1774 und wurde auf dem Friedhöfe zu U. L. F. in Olmütz be-
3
Domherr — der Stifter — adoriert, hinter ihm aber der hl. Josef ehrfurchts-
voll herannaht und im Hintergründe ein Soldat und ein Lakai einander neu-
gierig zuzuflüstern scheinen; links aus dem Fenster lugt von der Krippe
der Esel hervor — ist mit 15 B 49 signiert.
4. Das vierte Gemälde ist eine Nachbildung des Albrecht Dürerschen
Kupferstiches Geburt Christi aus dem Jahre 1504 und ist mit F. H. 1613
signiert. In den Hauptumrissen dürerisch, ist es in den Einzelheiten den-
noch eigene Schöpfung. Die Architektur ist, bis auf den Stall, Dürer ent-
nommen; auch die Gestalt des aus dem Brunnen Wasser schöpfenden hl.
Josef ist dürerisch; nur ist ein hinter dem Brunnen spielendes Hündchen
beigegeben. Allein das Antlitz der Madonna ist neu; es ist niedlicher und
zarter ausgeführt als bei Dürer. Auch ist die Hinterlandschaft mit Bethlehem
und Laubwerk neu konstruiert. Die Farbenauftragung ist niederländisch.
5. An die genannten Gemälde fremdländischen Ursprungs reiht sich
an ein Altarblatt: die hl. Familie des mährischen Malers Johann
Christoph Handke, wie dieSignatur 3-Q-3 (Handke Johann) 1750 anzeigt.
Handke führt das Werk in seiner Selbstbiographie (herausgegeben 1911
von Richard Foerster in Breslau) bei der Jahreszahl 1749 an, mit den
Worten: In hiesige Dohmkirch ein Altarblatt gemahlet: Jesus, Maria, Joseph.
Hawlik in seiner Geschichte der Baukunst und der bildenden Künste in
Mähren (Brünn 1838), S. 42, und Dr. Dudik in Mährens Geschichtsquellen
(Brünn 1850), S. 397, benennen unseren Künstler Hanke; doch steht es
fest, daß sich seine Gemahlin auf einem Tafelbilde des hl. Schutzengels,
welches Schreiber dieses in Starnau 1904 entdeckt hat, als Stifterin „Hand-
kin“ 1749 unterschrieben hat: O. A. M. D. G. Ex voto. Dieses bielt hat
offerirt Frau Maria Veronica Handkin Mahlerin in Olmütz Anno 1749 auf
Starnau gehörig. Handke wurde am 18. Februar 1694 in Johnsdorf bei
Römerstadt geboren. Sein Vater war Hammerschaffer, Schlackenschmelzer,
später Tischler, Schlosser und endlich Schuhmacher in Römerstadt und
wollte den jungen Johann gleichfalls zu der letzteren Profession zwingen.
Da aber der Knabe entschiedene Neigung zum Zeichnen hatte, führte ihn
der Vater schließlich 1708 nach Freudental zum Maler Johann Daniel
Langer, wo der junge Adept der Malkunst vier Jahre in der Lehre verblieb
und, wie er berichtet, „Öl- und Wasserfarben, Copieren, Historien und
Conterfee“ lernte. Im Jahre 1712 kam Handke auf 14 Tage in die Kondi-
tion zum Maler Johann Siebehohr nach Schönberg, worauf er sich 1713
nach Mähr.-Trübau begab und dortselbs! bei Christian David zwei Jahre
arbeitete. Im Jahre 1715 kam er nach Olmütz und wurde bei Ferdinand
Naboth aufgenommen, der aber schwer krank war und am neunten Tage
starb. Handke blieb bei der Witwe und vollendete in ihrem Auftrage die
Freskoausmalung des „Lindenkirchls“ zu Römerstadt, worauf er das Ge-
lübde tat: „wann es Gottes willen ist, daß ich mich sollte zu Ollmütz
bürgl. professionirt machen, und diese wittib heyrathen“, daß er der Drei-
faltigkeitskirche zu Sternberg ein Altarbild malen und schenken wolle: „wie
auch wirklich geschehen“. Nachdem in Olmütz 1716 die Pest aufgehört
hatte, ging Handke abermals zur Frau Elisabeth Naboth in die Arbeit und
nahm sie 1724 zur Frau; sie gebar ihm eine Tochter Pauline und starb
nach 16 Jahren, im Jahre 1742. Handke selbst starb bejahrt am 28. De-
zember 1774 und wurde auf dem Friedhöfe zu U. L. F. in Olmütz be-
3