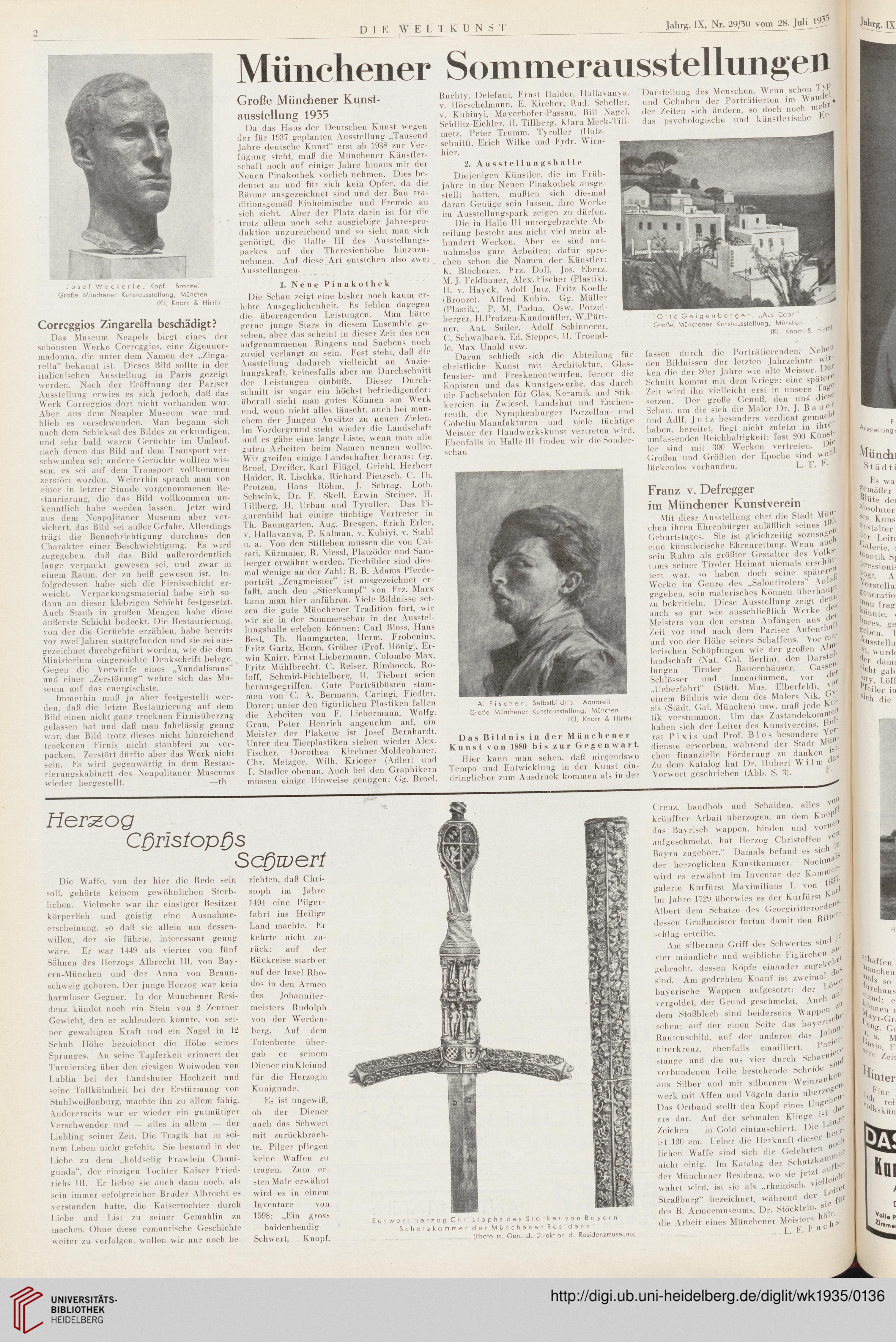2
Jahrg. IX, Nr. 29/30 vom 28. Juli
D I E W E L T K U N S T
Josef Wa c k e r I e , Kopf. Bronze.
Große Münchener Kunstausstellung, München
(Kl. Knorr & Hirth)
Correggios Zingarella beschädigt?
Das Museum Neapels birgt eines der
schönsten Werke Correggios, eine Zigeuner-
madonna, die unter dem Namen der „Zinga-
rella“ bekannt ist. Dieses Bild sollte in der
italienischen Ausstellung in Paris gezeigt
werden. Nach der Eröffnung der Pariser
Ausstellung erwies es sich jedoch, daß das
Werk Correggios dort nicht vorhanden war.
Aber aus dem Neapler Museum war und
blieb es verschwunden. Man begann sich
nach dem Schicksal des Bildes zu erkundigen,
und sehr bald waren Gerüchte im Umlauf,
nach denen das Bild auf dem Transport ver-
schwunden sei; andere Gerüchte wollten wis-
sen, es sei auf dem Transport vollkommen
zerstört worden. Weiterhin sprach man von
einer in letzter Stunde vorgenommenen Re-
staurierung, die das Bild vollkommen un-
kenntlich habe werden lassen. Jetzt wird
aus dem Neapolitaner Museum aber ver-
sichert, das Bild sei außer Gefahr. Allerdings
trägt die Benachrichtigung durchaus den
Charakter einer Beschwichtigung. Es wird
zugegeben, daß das Bild außerordentlich
lange verpackt gewesen sei, und zwar in
einem Raum, der zu heiß gewesen ist. In-
folgedessen habe sich die Firnisschicht er-
weicht. Verpackungsmaterial habe sich so-
dann an dieser klebrigen Schicht festgesetzt.
Auch Staub in großen Mengen habe diese
äußerste Schicht bedeckt. Die Restaurierung,
von der die Gerüchte erzählen, habe bereits
vor zwei Jahren stattgefunden und sie sei aus-
gezeichnet durchgeführt worden, wie die dem
Ministerium eingereichte Denkschrift belege.
Gegen die Vorwürfe eines „Vandalismus“
und einer „Zerstörung“ wehre sich das Mu-
seum auf das energischste.
Immerhin muß ja aber festgestellt wer-
den, daß die letzte Restaurierung auf dem
Bild einen nicht ganz trocknen Firnisüberzug
gelassen hat und daß man fahrlässig genug
war, das Bild trotz dieses nicht hinreichend
trockenen Firnis nicht staubfrei zu ver-
packen. Zerstört dürfte aber das Werk nicht
sein. Es wird gegenwärtig in dem Restau-
rierungskabinett des Neapolitaner Museums
wieder hergestellt. —-th
Münchener Sommerausstellungen
Große Münchener Kunst-
ausstellung 1935
Da das Haus der Deutschen Kunst wegen
der für 1937 geplanten Ausstellung „Tausend
Jahre deutsche Kunst“ erst ab 1938 zur Ver-
fügung steht, muß die Münchener Künstler-
schaft noch auf einige Jahre hinaus mit der
Neuen Pinakothek vorlieb nehmen. Dies be-
deutet an und für sich kein Opfer, da die
Räume ausgezeichnet sind und der Bau tra-
ditionsgemäß Einheimische und Fremde an
sich zieht. Aber der Platz darin ist für die
trotz allem noch sehr ausgiebige Jahrespro-
duktion unzureichend und so sieht man sich
genötigt, die Halle III des Ausstellungs-
parkes auf der Theresienhöhe hinzuzu-
nehmen. Auf diese Art entstehen also zwei
Ausstellungen.
1. Neue Pinakothek
Die Schau zeigt eine bisher noch kaum er-
lebte Ausgeglichenheit. Es fehlen dagegen
die. überragenden Leistungen. Man hätte
gerne junge Stars in diesem Ensemble ge-
sehen, aber das scheint in dieser Zeit des neu
auf genommenen Ringens und Suchens noch
zuviel verlangt zu sein. Fest steht, daß die
Ausstellung dadurch vielleicht an Anzie-
hungskraft, keinesfalls aber am Durchschnitt
der Leistungen einbüßt. Dieser Durch-
schnitt ist sogar ein höchst befriedigender:
überall sieht man gutes Können am Werk
und, wenn nicht alles täuscht, auch bei man-
chem der Jungen Ansätze zu neuen Zielen.
Im Vordergrund steht wieder die Landschaft
und es gäbe eine lange Liste, wenn man alle
guten Arbeiten beim Namen nennen wollte.
Wir greifen einige Landschafter heraus: Gg.
Broel. Dreißer, Karl Flügel, Griehl, Herbert
Haider, R. Lischka, Richard Pietzsch, C. Th.
Protzen, Hans Röhm, J. Schräg. Loth.
Schwink, Dr. F. Skell, Erwin Steiner, H.
Tillberg, H. Urban und Tyroller. Das Fi-
gurenbild hat einige tüchtige Vertreter in
Th. Baumgarten, Aug. Bresgen, Erich Erler,
v. Hallavanya, P. Kalman, v. Kubiyi, v. Stahl
u. a. Von den Stilleben müssen die von Cai-
rati, Kürmaier, R. Niessl, Platzöder und Sam-
berger erwähnt werden. Tierbilder sind dies-
mal Wenige an der Zahl: R. B. Adams Pferde-
porträt „Zeugmeister“ ist ausgezeichnet er-
faßt, auch den „Stierkampf“ von Frz. Marx
kann man hier anführen. Viele Bildnisse set-
zen die gute Münchener Tradition fort, wie
wir sie in der Sommerschau in der Ausstel-
lungshalle erleben können: Carl Bloss, Hans
Best, Th. Baumgarten, Herrn. Frobenius,
Fritz Gartz, Herrn. Gröber (Prof. Honig), Er-
win Knirr, Ernst Liebermann, Colombo Max,
Fritz Mühlbrecht, C. Reiser, Rimboeck, Ro-
loff, Schmid-Fichtelberg, H. Tiebert seien
herausgegriffen. Gute Porträtbüsten stam-
men von C. A. Bermann, Caringi, Fiedler,
Dorer; unter den figürlichen Plastiken fallen
die Arbeiten von F. Liebermann, Wolfg.
Grau, Peter Henrich angenehm auf, ein
Meister der Plakette ist Josef Bernhardt.
Unter den Tierplastiken stehen wieder Alex.
Fischer, Dorothea Kirchner-Moldenhauer,
Chr. Metzger, Wilh. Krieger (Adler) und
F. Stadler obenan. Auch bei den Graphikern
müssen einige Hinweise genügen: Gg. Broel,
Buchty, Delefant, Ernst Haider, Hallavanya,
v. Hörschelmann, E. Kircher, Rud. Scheller,
v. Kubinyi, Mayerhofer-Passau, Bill Nagel,
Seidlitz-Eichler, H. Tillberg, Klara Merk-Till-
Darstellung des Menschen. Wenn schon TyP
und Gehaben der Porträtierten im Wand1 ,
der Zeiten sich ändern, so doch noch md*1
das psychologische und künstlerische Fr'
metz, Peter Trumm, Tyroller (Holz-
schnitt), Erich Wilke und Frdr. Wirn-
hier.
2. Ausstellungshalle
Diejenigen Künstler, die im Früh-
jahre in der Neuen Pinakothek ausge-
stellt hatten, mußten sich diesmal
daran Genüge sein lassen, ihre Werke
im Ausstellungspark zeigen zu dürfen.
Die in Halle III untergebrachte Ab-
teilung besteht aus nicht viel mehr als
hundert Werken. Aber es sind aus-
nahmslos gute Arbeiten; dafür spre-
chen schon die Namen der Künstler:
K. Blocherer, Frz. Doll, Jos. Eberz,
M. J. Feldbauer, Alex. Fischer (Plastik),
H. v. Hayek. Adolf Jutz, Fritz Koelle
(Bronze), Alfred Kubin, Gg. Müller
(Plastik), P. M. Padua, Osw. Pötzel-
berger, H.Protzen-Kundmüller, W.Pütt-
ner, Ant. Sailer, Adolf Schinnerer,
C. Schwalbach, Ed. Steppes, H. Troend-
le, Max Unold usw.
Daran schließt sich die Abteilung für
christliche Kunst mit Architektur, Glas-
fenster- und Freskenentwürfen, ferner die
Kopisten und das Kunstgewerbe, das durch
die Fachschulen für Glas, Keramik und Stik-
kereien in Zwiesel, Landshut und Enchen-
reuth, die Nymphenburger Porzellan- und
Gobelin-Manufakturen und viele tüchtige
Meister der Handwerkskunst vertreten wird.
Ebenfalls in Halle TU finden wir die Sonder-
schau
A. Fischer., Selbstbildnis. Aquarell
Große Münchener Kunstausstellung, München
(Kl. Knorr & Hirth)
Das Bildnis in der Münchener
Kunst von 1880 bis zur Gegenwart.
Liier kann man sehen, daß nirgendswo
Tempo und Entwicklung in der Kunst ein-
dringlicher zum Ausdruck kommen als in der
Otto Geigen berger, „Aus Capri"
Große Münchener Kunstausstellung, München
(Kl. Knorr & Hirth’
fassen durch die Porträtierenden. Neb6»
den Bildnissen der letzten Jahrzehnte W*r'
ken die der 80er Jahre wie alte Meister. De*
Schnitt kommt mit dem Kriege: eine später6
Zeit wird ihn vielleicht erst in unsere Tag1
setzen. Der große Genuß, den uns" dies6
Schau, um die sich die Maler Dr. J. BauU
und Adlf. Jutz besonders verdient gemad1
haben, bereitet, liegt nicht zuletzt in ihr6'
umfassenden Reichhaltigkeit: fast 200 Künd'
ler sind mit SCO Werken vertreten. D»
Großen und Größten der Epoche sind wol*1
lückenlos vorhanden. L. F. F-
Darstel'
Gass6»’
d61
vor
später6»
aes „oaiuiiuruierö“ Aul3
malerisches Können über liaup
Diese Ausstellung zeigt den»
wiie ausschließlich Werke <I6i
den ersten Anfängen aus <l(’‘
nach dem Pariser Aufenth®1
Franz v. Defregger
im Münchener Kunstverein
Mit diesr Ausstellung ehrt die Stadt Mi*»'
eilen ihren Ehrenbürger anläßlich seines 1» '
Geburtstages. Sie ist gleichzeitig sozusag6»
eine künstlerische Ehrenrettung. Wenn a**6*
sein Ruhm als größter Gestalter des Volks'
tums seiner Tiroler Heimat niemals ersc hü*;
tert war, so haben doch seine
Werke im Genre des „Salontirolers“
gegeben, sein
zu bekritteln.
auch so gut
Meisters von
Zeit vor und
und von der Höhe seines Schaffens. Vor m®
lerischen Schöpfungen wie der großen Al*»'
landschaft (Nat. Gal. Berlin), den " i'>
lungen Tiroler Bauernhäuser,
Schlösser und Innenräumen, vor
„Ueberfahrt“ (Städt. Mus. Elberfeld),
einem Bildnis wie dem des Malers Nik. GY
sis (Städt. Gal. München) usw. muß jede Kr)
tik verstummen. Um das Zustandekom®6"
haben sich der Leiter des Kunstvereins, 11°.
rat Pixis und Prof. Bios besondere W’1
dienste erworben, während der Stadt M**»
chen finanzielle Förderung zu danken
Zu dem Katalog hat Dr. Hubert Wilm (J»
Vorwort geschrieben (Abb. S. 3). F-
Herzog
CQristo'pQs
ScQweri
Die Waffe, von der hier die Rede sein
soll, gehörte keinem gewöhnlichen Sterb-
lichen. Vielmehr war ihr einstiger Besitzer
körperlich und geistig eine Ausnahme-
erscheinung, so daß sie allein um dessen-
willen, der sie führte, interessant genug
wäre. Er war 1449 als vierter von fünf
Söhnen des Herzogs Albrecht III. von Bay-
ern-München und der Anna von Braun-
schweig geboren. Der junge Herzog war kein
harmloser Gegner. In der Münchener Resi-
denz kündet noch ein Stein von 3 Zentner
Gewicht, den er schleudern konnte, von sei-
ner gewaltigen Kraft und ein Nagel in 12
Schuh Höhe bezeichnet die Höhe seines
Sprunges. An seine Tapferkeit erinnert der
Turniersieg über den riesigen Woiwoden von
Lublin bei der Landshuter Hochzeit und
seine Tollkühnheit bei der Erstürmung von
Stuhlweißenburg, machte ihn zu allem fähig.
Andererseits war er wieder ein gutmütiger
Verschwender und — alles in allem — der
Liebling seiner Zeit. Die Tragik hat in sei-
nem Leben nicht gefehlt. Sie bestand in der
Liebe zu dem „holdselig Frawlein Chuni-
gunda“, der einzigen Tochter Kaiser Fried-
richs HL Er liebte sie auch dann noch, als
sein immer erfolgreicher Bruder Albrecht es
verstanden hatte, die Kaisertochter durch
Liebe und List zu seiner Gemahlin zu
machen. Ohne diese romantische Geschichte
weiter zu verfolgen, wollen wir nur noch be¬
richten, daß Chri-
stoph im Jahre
1494 eine Pilger-
fahrt ins Heilige
Land machte. Er
kehrte nicht zu-
rück: auf der
Rückreise starb er
auf der Insel Rho-
dos in den Armen
des Johanniter-
meisters Rudolph
von der Werden-
berg. Auf dem
Totenbette über-
gab er seinem
Diener einKleinod
für die Herzogin
Kunigunde.
Es ist ungewiß,
ob der Diener
auch das Schwert
mit zurückbrach-
te. Pilger pflegen
keine Waffen zu
tragen. Zum er-
sten Male erwähnt
wird es in einem
Inventare von
1598: „Ein gross
baidenhendig
Schwert, Knopf.
Schwert Herzog Christophs des Stork en von Bayern
Schatzkammer der Münchener Residenz
(Photo m. Gen. d. Direktion d. Residenzmuseums)
Creuz, handhöb und Schaiden, alles v
kriipffter Arbait überzogen, an dem Knop
das
aufgeschmelzt, hat Herzog
Bayrn zugehört.“
der herzoglichen
wird es erwähnt
galerie Kurfürst
Seite das
anderen
emailliert.
durch Schar**1»
ro»
,ff
Bayrisch wappen, hiinden und vor*16"
Christoffen v°1’
Damals befand es sich 1
Kunstkammer. Noch®»
im Inventar der Kani*1»1,
Maximilians I. von
Im Jahre 1729 überwies es der Kurfürst F®
dem Schatze des Georgiritterorde*
Großmeister fortan damit den Rit*1'
erteilte.
silbernen Griff des Schwertes sind
a»'
:l*ft
d®5
rö"1’
Auch »**
z»
bayeris»1'1
das Job®-,
Pa*'*»1
ie*-1’
si*lfl
'**'
>•£**■
Albert
dessen
schlag
Am
vier männliche und weibliche Figürchen 1
gebracht, dessen Köpfe einander zugekd
sind. Am gedrehten Knauf ist zweimal 1
bayerische Wappen aufgesetzt: der L
vergoldet, der Grund geschmelzt,
dem Stoßblech sind beiderseits Wappen
sehen: auf der einen
Rautenschild, auf der
niterkreuz, ebenfalls
stange und die aus vier
verbundenen Teile bestehende Scheide
aus Silber und mit silbernen Weinrank6
werk mit Affen und Vögeln darin überzofe
- li e»
Das Ortband stellt den Kopf eines Ung® g
ers dar. Auf der schmalen Klinge ist
Zeichen in Gold eintauschiiert. Die L®»!’
ist 130 cm. Ueber die Herkunft dieser l*1
liehen Waffe sind sich die Gelehrten 111
nicht einig. Im Katalog der Schatzka®»^
der Münchener Residenz, wo sie jetzt ®* . i
wahrt wird, ist sie als ..rheinisch, v*e*‘
T
Straßburg“ bezeichnet, während der
des B. Armeemuseums, Dr. Stöcklein, s*
die Arbeit eines Münchener Meisters 1®
L. F. F •* 6 11
Jahrg. IX, Nr. 29/30 vom 28. Juli
D I E W E L T K U N S T
Josef Wa c k e r I e , Kopf. Bronze.
Große Münchener Kunstausstellung, München
(Kl. Knorr & Hirth)
Correggios Zingarella beschädigt?
Das Museum Neapels birgt eines der
schönsten Werke Correggios, eine Zigeuner-
madonna, die unter dem Namen der „Zinga-
rella“ bekannt ist. Dieses Bild sollte in der
italienischen Ausstellung in Paris gezeigt
werden. Nach der Eröffnung der Pariser
Ausstellung erwies es sich jedoch, daß das
Werk Correggios dort nicht vorhanden war.
Aber aus dem Neapler Museum war und
blieb es verschwunden. Man begann sich
nach dem Schicksal des Bildes zu erkundigen,
und sehr bald waren Gerüchte im Umlauf,
nach denen das Bild auf dem Transport ver-
schwunden sei; andere Gerüchte wollten wis-
sen, es sei auf dem Transport vollkommen
zerstört worden. Weiterhin sprach man von
einer in letzter Stunde vorgenommenen Re-
staurierung, die das Bild vollkommen un-
kenntlich habe werden lassen. Jetzt wird
aus dem Neapolitaner Museum aber ver-
sichert, das Bild sei außer Gefahr. Allerdings
trägt die Benachrichtigung durchaus den
Charakter einer Beschwichtigung. Es wird
zugegeben, daß das Bild außerordentlich
lange verpackt gewesen sei, und zwar in
einem Raum, der zu heiß gewesen ist. In-
folgedessen habe sich die Firnisschicht er-
weicht. Verpackungsmaterial habe sich so-
dann an dieser klebrigen Schicht festgesetzt.
Auch Staub in großen Mengen habe diese
äußerste Schicht bedeckt. Die Restaurierung,
von der die Gerüchte erzählen, habe bereits
vor zwei Jahren stattgefunden und sie sei aus-
gezeichnet durchgeführt worden, wie die dem
Ministerium eingereichte Denkschrift belege.
Gegen die Vorwürfe eines „Vandalismus“
und einer „Zerstörung“ wehre sich das Mu-
seum auf das energischste.
Immerhin muß ja aber festgestellt wer-
den, daß die letzte Restaurierung auf dem
Bild einen nicht ganz trocknen Firnisüberzug
gelassen hat und daß man fahrlässig genug
war, das Bild trotz dieses nicht hinreichend
trockenen Firnis nicht staubfrei zu ver-
packen. Zerstört dürfte aber das Werk nicht
sein. Es wird gegenwärtig in dem Restau-
rierungskabinett des Neapolitaner Museums
wieder hergestellt. —-th
Münchener Sommerausstellungen
Große Münchener Kunst-
ausstellung 1935
Da das Haus der Deutschen Kunst wegen
der für 1937 geplanten Ausstellung „Tausend
Jahre deutsche Kunst“ erst ab 1938 zur Ver-
fügung steht, muß die Münchener Künstler-
schaft noch auf einige Jahre hinaus mit der
Neuen Pinakothek vorlieb nehmen. Dies be-
deutet an und für sich kein Opfer, da die
Räume ausgezeichnet sind und der Bau tra-
ditionsgemäß Einheimische und Fremde an
sich zieht. Aber der Platz darin ist für die
trotz allem noch sehr ausgiebige Jahrespro-
duktion unzureichend und so sieht man sich
genötigt, die Halle III des Ausstellungs-
parkes auf der Theresienhöhe hinzuzu-
nehmen. Auf diese Art entstehen also zwei
Ausstellungen.
1. Neue Pinakothek
Die Schau zeigt eine bisher noch kaum er-
lebte Ausgeglichenheit. Es fehlen dagegen
die. überragenden Leistungen. Man hätte
gerne junge Stars in diesem Ensemble ge-
sehen, aber das scheint in dieser Zeit des neu
auf genommenen Ringens und Suchens noch
zuviel verlangt zu sein. Fest steht, daß die
Ausstellung dadurch vielleicht an Anzie-
hungskraft, keinesfalls aber am Durchschnitt
der Leistungen einbüßt. Dieser Durch-
schnitt ist sogar ein höchst befriedigender:
überall sieht man gutes Können am Werk
und, wenn nicht alles täuscht, auch bei man-
chem der Jungen Ansätze zu neuen Zielen.
Im Vordergrund steht wieder die Landschaft
und es gäbe eine lange Liste, wenn man alle
guten Arbeiten beim Namen nennen wollte.
Wir greifen einige Landschafter heraus: Gg.
Broel. Dreißer, Karl Flügel, Griehl, Herbert
Haider, R. Lischka, Richard Pietzsch, C. Th.
Protzen, Hans Röhm, J. Schräg. Loth.
Schwink, Dr. F. Skell, Erwin Steiner, H.
Tillberg, H. Urban und Tyroller. Das Fi-
gurenbild hat einige tüchtige Vertreter in
Th. Baumgarten, Aug. Bresgen, Erich Erler,
v. Hallavanya, P. Kalman, v. Kubiyi, v. Stahl
u. a. Von den Stilleben müssen die von Cai-
rati, Kürmaier, R. Niessl, Platzöder und Sam-
berger erwähnt werden. Tierbilder sind dies-
mal Wenige an der Zahl: R. B. Adams Pferde-
porträt „Zeugmeister“ ist ausgezeichnet er-
faßt, auch den „Stierkampf“ von Frz. Marx
kann man hier anführen. Viele Bildnisse set-
zen die gute Münchener Tradition fort, wie
wir sie in der Sommerschau in der Ausstel-
lungshalle erleben können: Carl Bloss, Hans
Best, Th. Baumgarten, Herrn. Frobenius,
Fritz Gartz, Herrn. Gröber (Prof. Honig), Er-
win Knirr, Ernst Liebermann, Colombo Max,
Fritz Mühlbrecht, C. Reiser, Rimboeck, Ro-
loff, Schmid-Fichtelberg, H. Tiebert seien
herausgegriffen. Gute Porträtbüsten stam-
men von C. A. Bermann, Caringi, Fiedler,
Dorer; unter den figürlichen Plastiken fallen
die Arbeiten von F. Liebermann, Wolfg.
Grau, Peter Henrich angenehm auf, ein
Meister der Plakette ist Josef Bernhardt.
Unter den Tierplastiken stehen wieder Alex.
Fischer, Dorothea Kirchner-Moldenhauer,
Chr. Metzger, Wilh. Krieger (Adler) und
F. Stadler obenan. Auch bei den Graphikern
müssen einige Hinweise genügen: Gg. Broel,
Buchty, Delefant, Ernst Haider, Hallavanya,
v. Hörschelmann, E. Kircher, Rud. Scheller,
v. Kubinyi, Mayerhofer-Passau, Bill Nagel,
Seidlitz-Eichler, H. Tillberg, Klara Merk-Till-
Darstellung des Menschen. Wenn schon TyP
und Gehaben der Porträtierten im Wand1 ,
der Zeiten sich ändern, so doch noch md*1
das psychologische und künstlerische Fr'
metz, Peter Trumm, Tyroller (Holz-
schnitt), Erich Wilke und Frdr. Wirn-
hier.
2. Ausstellungshalle
Diejenigen Künstler, die im Früh-
jahre in der Neuen Pinakothek ausge-
stellt hatten, mußten sich diesmal
daran Genüge sein lassen, ihre Werke
im Ausstellungspark zeigen zu dürfen.
Die in Halle III untergebrachte Ab-
teilung besteht aus nicht viel mehr als
hundert Werken. Aber es sind aus-
nahmslos gute Arbeiten; dafür spre-
chen schon die Namen der Künstler:
K. Blocherer, Frz. Doll, Jos. Eberz,
M. J. Feldbauer, Alex. Fischer (Plastik),
H. v. Hayek. Adolf Jutz, Fritz Koelle
(Bronze), Alfred Kubin, Gg. Müller
(Plastik), P. M. Padua, Osw. Pötzel-
berger, H.Protzen-Kundmüller, W.Pütt-
ner, Ant. Sailer, Adolf Schinnerer,
C. Schwalbach, Ed. Steppes, H. Troend-
le, Max Unold usw.
Daran schließt sich die Abteilung für
christliche Kunst mit Architektur, Glas-
fenster- und Freskenentwürfen, ferner die
Kopisten und das Kunstgewerbe, das durch
die Fachschulen für Glas, Keramik und Stik-
kereien in Zwiesel, Landshut und Enchen-
reuth, die Nymphenburger Porzellan- und
Gobelin-Manufakturen und viele tüchtige
Meister der Handwerkskunst vertreten wird.
Ebenfalls in Halle TU finden wir die Sonder-
schau
A. Fischer., Selbstbildnis. Aquarell
Große Münchener Kunstausstellung, München
(Kl. Knorr & Hirth)
Das Bildnis in der Münchener
Kunst von 1880 bis zur Gegenwart.
Liier kann man sehen, daß nirgendswo
Tempo und Entwicklung in der Kunst ein-
dringlicher zum Ausdruck kommen als in der
Otto Geigen berger, „Aus Capri"
Große Münchener Kunstausstellung, München
(Kl. Knorr & Hirth’
fassen durch die Porträtierenden. Neb6»
den Bildnissen der letzten Jahrzehnte W*r'
ken die der 80er Jahre wie alte Meister. De*
Schnitt kommt mit dem Kriege: eine später6
Zeit wird ihn vielleicht erst in unsere Tag1
setzen. Der große Genuß, den uns" dies6
Schau, um die sich die Maler Dr. J. BauU
und Adlf. Jutz besonders verdient gemad1
haben, bereitet, liegt nicht zuletzt in ihr6'
umfassenden Reichhaltigkeit: fast 200 Künd'
ler sind mit SCO Werken vertreten. D»
Großen und Größten der Epoche sind wol*1
lückenlos vorhanden. L. F. F-
Darstel'
Gass6»’
d61
vor
später6»
aes „oaiuiiuruierö“ Aul3
malerisches Können über liaup
Diese Ausstellung zeigt den»
wiie ausschließlich Werke <I6i
den ersten Anfängen aus <l(’‘
nach dem Pariser Aufenth®1
Franz v. Defregger
im Münchener Kunstverein
Mit diesr Ausstellung ehrt die Stadt Mi*»'
eilen ihren Ehrenbürger anläßlich seines 1» '
Geburtstages. Sie ist gleichzeitig sozusag6»
eine künstlerische Ehrenrettung. Wenn a**6*
sein Ruhm als größter Gestalter des Volks'
tums seiner Tiroler Heimat niemals ersc hü*;
tert war, so haben doch seine
Werke im Genre des „Salontirolers“
gegeben, sein
zu bekritteln.
auch so gut
Meisters von
Zeit vor und
und von der Höhe seines Schaffens. Vor m®
lerischen Schöpfungen wie der großen Al*»'
landschaft (Nat. Gal. Berlin), den " i'>
lungen Tiroler Bauernhäuser,
Schlösser und Innenräumen, vor
„Ueberfahrt“ (Städt. Mus. Elberfeld),
einem Bildnis wie dem des Malers Nik. GY
sis (Städt. Gal. München) usw. muß jede Kr)
tik verstummen. Um das Zustandekom®6"
haben sich der Leiter des Kunstvereins, 11°.
rat Pixis und Prof. Bios besondere W’1
dienste erworben, während der Stadt M**»
chen finanzielle Förderung zu danken
Zu dem Katalog hat Dr. Hubert Wilm (J»
Vorwort geschrieben (Abb. S. 3). F-
Herzog
CQristo'pQs
ScQweri
Die Waffe, von der hier die Rede sein
soll, gehörte keinem gewöhnlichen Sterb-
lichen. Vielmehr war ihr einstiger Besitzer
körperlich und geistig eine Ausnahme-
erscheinung, so daß sie allein um dessen-
willen, der sie führte, interessant genug
wäre. Er war 1449 als vierter von fünf
Söhnen des Herzogs Albrecht III. von Bay-
ern-München und der Anna von Braun-
schweig geboren. Der junge Herzog war kein
harmloser Gegner. In der Münchener Resi-
denz kündet noch ein Stein von 3 Zentner
Gewicht, den er schleudern konnte, von sei-
ner gewaltigen Kraft und ein Nagel in 12
Schuh Höhe bezeichnet die Höhe seines
Sprunges. An seine Tapferkeit erinnert der
Turniersieg über den riesigen Woiwoden von
Lublin bei der Landshuter Hochzeit und
seine Tollkühnheit bei der Erstürmung von
Stuhlweißenburg, machte ihn zu allem fähig.
Andererseits war er wieder ein gutmütiger
Verschwender und — alles in allem — der
Liebling seiner Zeit. Die Tragik hat in sei-
nem Leben nicht gefehlt. Sie bestand in der
Liebe zu dem „holdselig Frawlein Chuni-
gunda“, der einzigen Tochter Kaiser Fried-
richs HL Er liebte sie auch dann noch, als
sein immer erfolgreicher Bruder Albrecht es
verstanden hatte, die Kaisertochter durch
Liebe und List zu seiner Gemahlin zu
machen. Ohne diese romantische Geschichte
weiter zu verfolgen, wollen wir nur noch be¬
richten, daß Chri-
stoph im Jahre
1494 eine Pilger-
fahrt ins Heilige
Land machte. Er
kehrte nicht zu-
rück: auf der
Rückreise starb er
auf der Insel Rho-
dos in den Armen
des Johanniter-
meisters Rudolph
von der Werden-
berg. Auf dem
Totenbette über-
gab er seinem
Diener einKleinod
für die Herzogin
Kunigunde.
Es ist ungewiß,
ob der Diener
auch das Schwert
mit zurückbrach-
te. Pilger pflegen
keine Waffen zu
tragen. Zum er-
sten Male erwähnt
wird es in einem
Inventare von
1598: „Ein gross
baidenhendig
Schwert, Knopf.
Schwert Herzog Christophs des Stork en von Bayern
Schatzkammer der Münchener Residenz
(Photo m. Gen. d. Direktion d. Residenzmuseums)
Creuz, handhöb und Schaiden, alles v
kriipffter Arbait überzogen, an dem Knop
das
aufgeschmelzt, hat Herzog
Bayrn zugehört.“
der herzoglichen
wird es erwähnt
galerie Kurfürst
Seite das
anderen
emailliert.
durch Schar**1»
ro»
,ff
Bayrisch wappen, hiinden und vor*16"
Christoffen v°1’
Damals befand es sich 1
Kunstkammer. Noch®»
im Inventar der Kani*1»1,
Maximilians I. von
Im Jahre 1729 überwies es der Kurfürst F®
dem Schatze des Georgiritterorde*
Großmeister fortan damit den Rit*1'
erteilte.
silbernen Griff des Schwertes sind
a»'
:l*ft
d®5
rö"1’
Auch »**
z»
bayeris»1'1
das Job®-,
Pa*'*»1
ie*-1’
si*lfl
'**'
>•£**■
Albert
dessen
schlag
Am
vier männliche und weibliche Figürchen 1
gebracht, dessen Köpfe einander zugekd
sind. Am gedrehten Knauf ist zweimal 1
bayerische Wappen aufgesetzt: der L
vergoldet, der Grund geschmelzt,
dem Stoßblech sind beiderseits Wappen
sehen: auf der einen
Rautenschild, auf der
niterkreuz, ebenfalls
stange und die aus vier
verbundenen Teile bestehende Scheide
aus Silber und mit silbernen Weinrank6
werk mit Affen und Vögeln darin überzofe
- li e»
Das Ortband stellt den Kopf eines Ung® g
ers dar. Auf der schmalen Klinge ist
Zeichen in Gold eintauschiiert. Die L®»!’
ist 130 cm. Ueber die Herkunft dieser l*1
liehen Waffe sind sich die Gelehrten 111
nicht einig. Im Katalog der Schatzka®»^
der Münchener Residenz, wo sie jetzt ®* . i
wahrt wird, ist sie als ..rheinisch, v*e*‘
T
Straßburg“ bezeichnet, während der
des B. Armeemuseums, Dr. Stöcklein, s*
die Arbeit eines Münchener Meisters 1®
L. F. F •* 6 11