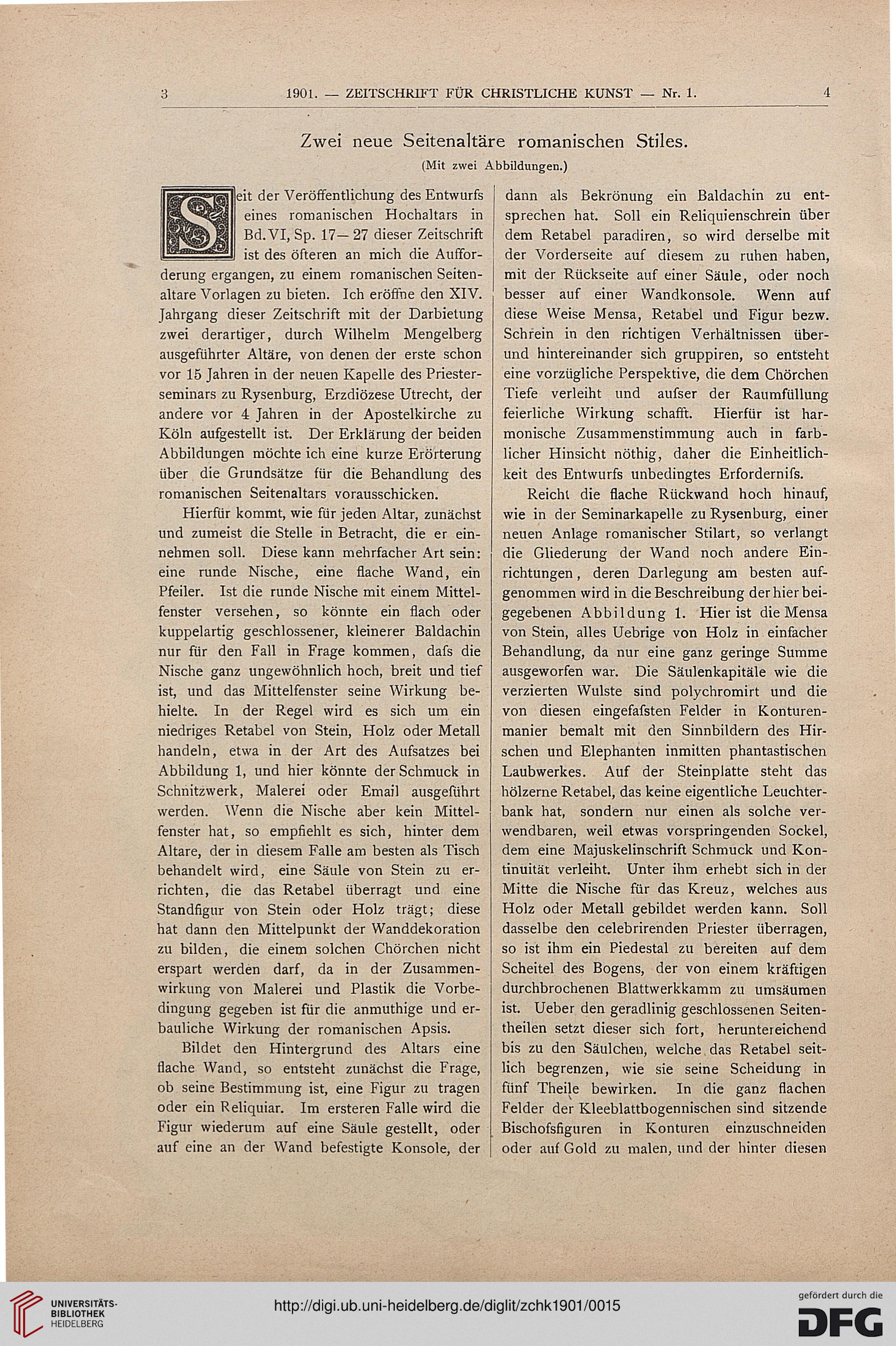1901.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 1.
Zwei neue Seitenaltäre romanischen Stiles.
(Mit zwei Abbildungen.)
eit der Veröffentlichung des Entwurfs
eines romanischen Hochaltars in
Bd. VI, Sp. 17- 27 dieser Zeitschrift
ist des öfteren an mich die Auffor-
derung ergangen, zu einem romanischen Seiten-
altare Vorlagen zu bieten. Ich eröffne den XIV.
Jahrgang dieser Zeitschrift mit der Darbietung
zwei derartiger, durch Wilhelm Mengelberg
ausgeführter Altäre, von denen der erste schon
vor 15 Jahren in der neuen Kapelle des Priester-
seminars zu Rysenburg, Erzdiözese Utrecht, der
andere vor 4 Jahren in der Apostelkirche zu
Köln aufgestellt ist. Der Erklärung der beiden
Abbildungen möchte ich eine kurze Erörterung
über die Grundsätze für die Behandlung des
romanischen Seitenaltars vorausschicken.
Hierfür kommt, wie für jeden Altar, zunächst
und zumeist die Stelle in Betracht, die er ein-
nehmen soll. Diese kann mehrfacher Art sein:
eine runde Nische, eine flache Wand, ein
Pfeiler. Ist die runde Nische mit einem Mittel-
fenster versehen, so könnte ein flach oder
kuppelartig geschlossener, kleinerer Baldachin
nur für den Fall in Frage kommen, dafs die
Nische ganz ungewöhnlich hoch, breit und tief
ist, und das Mittelfenster seine Wirkung be-
hielte. In der Regel wird es sich um ein
niedriges Retabel von Stein, Holz oder Metall
handeln, etwa in der Art des Aufsatzes bei
Abbildung 1, und hier könnte der Schmuck in
Schnitzwerk, Malerei oder Email ausgeführt
werden. Wenn die Nische aber kein Mittel-
fenster hat, so empfiehlt es sich, hinter dem
Altare, der in diesem Falle am besten als Tisch
behandelt wird, eine Säule von Stein zu er-
richten, die das Retabel überragt und eine
Standfigur von Stein oder Holz trägt; diese
hat dann den Mittelpunkt der Wanddekoration
zu bilden, die einem solchen Chörchen nicht
erspart werden darf, da in der Zusammen-
wirkung von Malerei und Plastik die Vorbe-
dingung gegeben ist für die anmuthige und er-
bauliche Wirkung der romanischen Apsis.
Bildet den Hintergrund des Altars eine
flache Wand, so entsteht zunächst die Frage,
ob seine Bestimmung ist, eine Figur zu tragen
oder ein Reliquiar. Im ersteren Falle wird die
Figur wiederum auf eine Säule gestellt, oder
auf eine an der Wand befestigte Konsole, der
dann als Bekrönung ein Baldachin zu ent-
sprechen hat. Soll ein Reliquienschrein über
dem Retabel paradiren, so wird derselbe mit
der Vorderseite auf diesem zu ruhen haben,
mit der Rückseite auf einer Säule, oder noch
besser auf einer Wandkonsole. Wenn auf
diese Weise Mensa, Retabel und Figur bezw.
Schrein in den richtigen Verhältnissen über-
und hintereinander sich gruppiren, so entsteht
eine vorzügliche Perspektive, die dem Chörchen
Tiefe verleiht und aufser der Raumfüllung
feierliche Wirkung schafft. Hierfür ist har-
monische Zusammenstimmung auch in farb-
licher Hinsicht nöthig, daher die Einheitlich-
keit des Entwurfs unbedingtes Erfordernifs.
Reicht die flache Rückwand hoch hinauf,
wie in der Seminarkapelle zu Rysenburg, einer
neuen Anlage romanischer Stilart, so verlangt
die Gliederung der Wand noch andere Ein-
richtungen , deren Darlegung am besten auf-
genommen wird in die Beschreibung der hier bei-
gegebenen Abbildung 1. Hier ist die Mensa
von Stein, alles Uebrige von Holz in einfacher
Behandlung, da nur eine ganz geringe Summe
ausgeworfen war. Die Säulenkapitäle wie die
verzierten Wulste sind polychromirt und die
von diesen eingefafsten Felder in Konturen-
manier bemalt mit den Sinnbildern des Hir-
schen und Elephanten inmitten phantastischen
Laubwerkes. Auf der Steinplatte steht das
hölzerne Retabel, das keine eigentliche Leuchter-
bank hat, sondern nur einen als solche ver-
wendbaren, weil etwas vorspringenden Sockel,
dem eine Majuskelinschrift Schmuck und Kon-
tinuität verleiht. Unter ihm erhebt sich in der
Mitte die Nische für das Kreuz, welches aus
Holz oder Metall gebildet werden kann. Soll
dasselbe den celebrirenden Priester überragen,
so ist ihm ein Piedestal zu bereiten auf dem
Scheitel des Bogens, der von einem kräftigen
durchbrochenen Blattwerkkamm zu umsäumen
ist. Ueber den geradlinig geschlossenen Seiten-
theilen setzt dieser sich fort, heruntereichend
bis zu den Säulchen, welche das Retabel seit-
lich begrenzen, wie sie seine Scheidung in
fünf Theile bewirken. In die ganz flachen
Felder der Kleeblattbogennischen sind sitzende
Bischofsfiguren in Konturen einzuschneiden
oder auf Gold zu malen, und der hinter diesen
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 1.
Zwei neue Seitenaltäre romanischen Stiles.
(Mit zwei Abbildungen.)
eit der Veröffentlichung des Entwurfs
eines romanischen Hochaltars in
Bd. VI, Sp. 17- 27 dieser Zeitschrift
ist des öfteren an mich die Auffor-
derung ergangen, zu einem romanischen Seiten-
altare Vorlagen zu bieten. Ich eröffne den XIV.
Jahrgang dieser Zeitschrift mit der Darbietung
zwei derartiger, durch Wilhelm Mengelberg
ausgeführter Altäre, von denen der erste schon
vor 15 Jahren in der neuen Kapelle des Priester-
seminars zu Rysenburg, Erzdiözese Utrecht, der
andere vor 4 Jahren in der Apostelkirche zu
Köln aufgestellt ist. Der Erklärung der beiden
Abbildungen möchte ich eine kurze Erörterung
über die Grundsätze für die Behandlung des
romanischen Seitenaltars vorausschicken.
Hierfür kommt, wie für jeden Altar, zunächst
und zumeist die Stelle in Betracht, die er ein-
nehmen soll. Diese kann mehrfacher Art sein:
eine runde Nische, eine flache Wand, ein
Pfeiler. Ist die runde Nische mit einem Mittel-
fenster versehen, so könnte ein flach oder
kuppelartig geschlossener, kleinerer Baldachin
nur für den Fall in Frage kommen, dafs die
Nische ganz ungewöhnlich hoch, breit und tief
ist, und das Mittelfenster seine Wirkung be-
hielte. In der Regel wird es sich um ein
niedriges Retabel von Stein, Holz oder Metall
handeln, etwa in der Art des Aufsatzes bei
Abbildung 1, und hier könnte der Schmuck in
Schnitzwerk, Malerei oder Email ausgeführt
werden. Wenn die Nische aber kein Mittel-
fenster hat, so empfiehlt es sich, hinter dem
Altare, der in diesem Falle am besten als Tisch
behandelt wird, eine Säule von Stein zu er-
richten, die das Retabel überragt und eine
Standfigur von Stein oder Holz trägt; diese
hat dann den Mittelpunkt der Wanddekoration
zu bilden, die einem solchen Chörchen nicht
erspart werden darf, da in der Zusammen-
wirkung von Malerei und Plastik die Vorbe-
dingung gegeben ist für die anmuthige und er-
bauliche Wirkung der romanischen Apsis.
Bildet den Hintergrund des Altars eine
flache Wand, so entsteht zunächst die Frage,
ob seine Bestimmung ist, eine Figur zu tragen
oder ein Reliquiar. Im ersteren Falle wird die
Figur wiederum auf eine Säule gestellt, oder
auf eine an der Wand befestigte Konsole, der
dann als Bekrönung ein Baldachin zu ent-
sprechen hat. Soll ein Reliquienschrein über
dem Retabel paradiren, so wird derselbe mit
der Vorderseite auf diesem zu ruhen haben,
mit der Rückseite auf einer Säule, oder noch
besser auf einer Wandkonsole. Wenn auf
diese Weise Mensa, Retabel und Figur bezw.
Schrein in den richtigen Verhältnissen über-
und hintereinander sich gruppiren, so entsteht
eine vorzügliche Perspektive, die dem Chörchen
Tiefe verleiht und aufser der Raumfüllung
feierliche Wirkung schafft. Hierfür ist har-
monische Zusammenstimmung auch in farb-
licher Hinsicht nöthig, daher die Einheitlich-
keit des Entwurfs unbedingtes Erfordernifs.
Reicht die flache Rückwand hoch hinauf,
wie in der Seminarkapelle zu Rysenburg, einer
neuen Anlage romanischer Stilart, so verlangt
die Gliederung der Wand noch andere Ein-
richtungen , deren Darlegung am besten auf-
genommen wird in die Beschreibung der hier bei-
gegebenen Abbildung 1. Hier ist die Mensa
von Stein, alles Uebrige von Holz in einfacher
Behandlung, da nur eine ganz geringe Summe
ausgeworfen war. Die Säulenkapitäle wie die
verzierten Wulste sind polychromirt und die
von diesen eingefafsten Felder in Konturen-
manier bemalt mit den Sinnbildern des Hir-
schen und Elephanten inmitten phantastischen
Laubwerkes. Auf der Steinplatte steht das
hölzerne Retabel, das keine eigentliche Leuchter-
bank hat, sondern nur einen als solche ver-
wendbaren, weil etwas vorspringenden Sockel,
dem eine Majuskelinschrift Schmuck und Kon-
tinuität verleiht. Unter ihm erhebt sich in der
Mitte die Nische für das Kreuz, welches aus
Holz oder Metall gebildet werden kann. Soll
dasselbe den celebrirenden Priester überragen,
so ist ihm ein Piedestal zu bereiten auf dem
Scheitel des Bogens, der von einem kräftigen
durchbrochenen Blattwerkkamm zu umsäumen
ist. Ueber den geradlinig geschlossenen Seiten-
theilen setzt dieser sich fort, heruntereichend
bis zu den Säulchen, welche das Retabel seit-
lich begrenzen, wie sie seine Scheidung in
fünf Theile bewirken. In die ganz flachen
Felder der Kleeblattbogennischen sind sitzende
Bischofsfiguren in Konturen einzuschneiden
oder auf Gold zu malen, und der hinter diesen