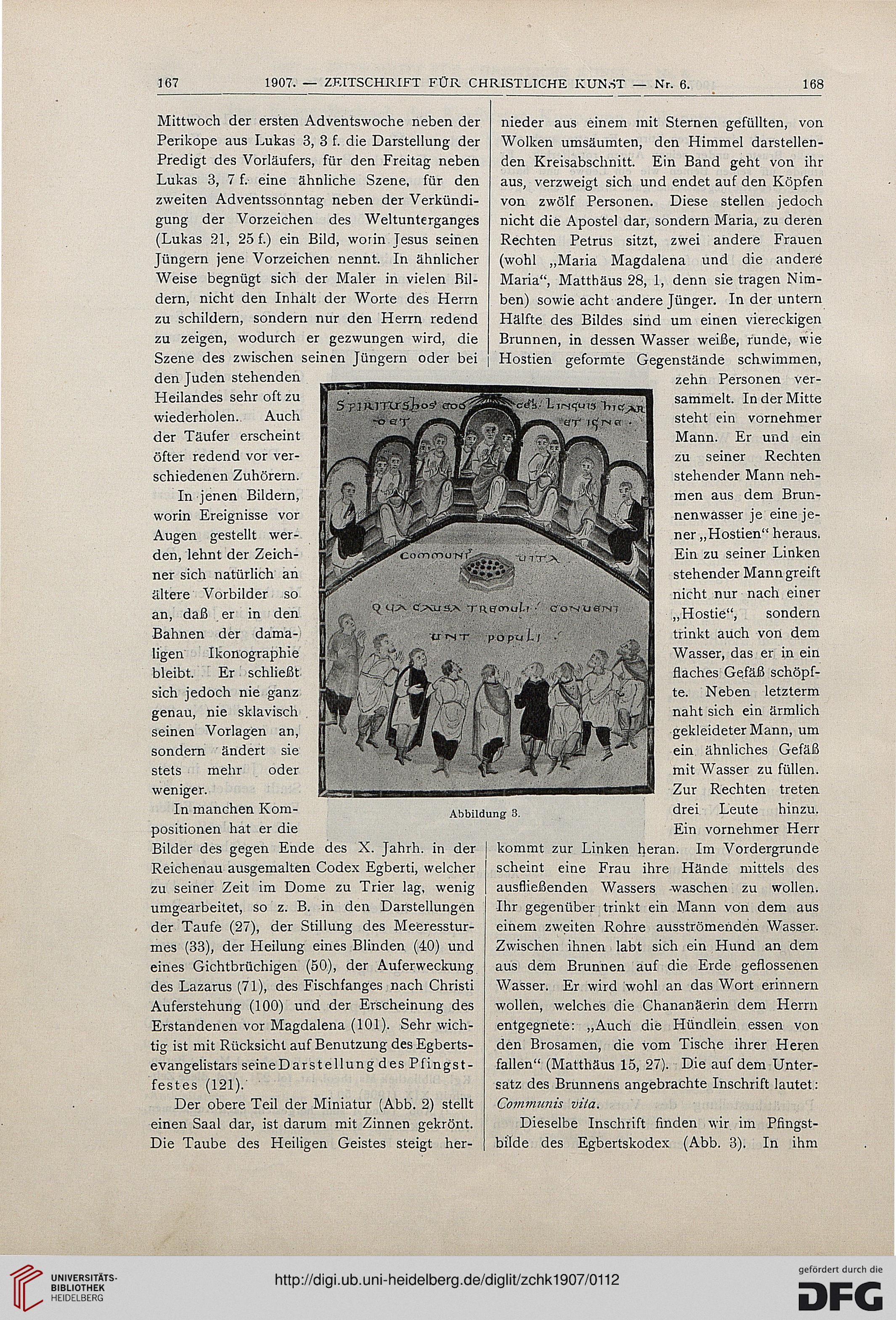167
1907. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 6.
168
Mittwoch der ersten Adventswoche neben der
Perikope aus Lukas 3, 3 f. die Darstellung der
Predigt des Vorläufers, für den Freitag neben
Lukas 3, 7 f.- eine ähnliche Szene, für den
zweiten Adventssonntag neben der Verkündi-
gung der Vorzeichen des Weltunterganges
(Lukas 21, 25 f.) ein Bild, worin Jesus seinen
Jüngern jene Vorzeichen nennt. In ähnlicher
Weise begnügt sich der Maler in vielen Bil-
dern, nicht den Inhalt der Worte des Herrn
zu schildern, sondern nur den Herrn redend
zu zeigen, wodurch er gezwungen wird, die
Szene des zwischen seinen Jüngern oder bei j
den Juden stehenden
Heilandes sehr oft zu
wiederholen.. Auch
der Täufer erscheint
öfter redend vor ver-
schiedenen Zuhörern.
In jenen Bildern,
worin Ereignisse vor
Augen gestellt wer-
den, lehnt der Zeich-
ner sich natürlich an
ältere Vorbilder so
an, daß er in den
Bahnen der dama-'
ligen Ikonographie
bleibt. Er schließt
sich jedoch nie ganz
genau, nie sklavisch
seinen Vorlagen an,
sondern ändert sie
stets mehr oder
weniger.
In manchen Kom-
positionen hat er die
Bilder des gegen Ende des X. Jahrh. in der
Reichenau ausgemalten Codex Egberti, welcher
zu seiner Zeit im Dome zu Trier lag, wenig
umgearbeitet, so z. B. in den Darstellungen
der Taufe (27), der Stillung des Meeresstur-
mes (33), der Heilung eines Blinden (40) und
eines Gichtbrüchigen (50), der Auferweckung
des Lazarus (71), des Fischfanges nach Christi
Auferstehung (100) und der Erscheinung des
Erstandenen vor Magdalena (101). Sehr wich-
tig ist mit Rücksicht auf Benutzung des Egberts-
evangelistars seineDarstellung des Pfingst-
festes (121).
Der obere Teil der Miniatur (Abb. 2) stellt
einen Saal dar, ist darum mit Zinnen gekrönt.
Die Taube des Heiligen Geistes steigt her-
"triNT-
Abbildung 3.
nieder aus einem mit Sternen gefüllten, von
Wolken umsäumten, den Himmel darstellen-
den Kreisabschnitt. Ein Band geht von ihr
aus, verzweigt sich und endet auf den Köpfen
von zwölf Personen. Diese stellen jedoch
nicht die Apostel dar, sondern Maria, zu deren
Rechten Petrus sitzt, zwei andere Frauen
(wohl „Maria Magdalena und die andere
Maria", Matthäus 28, 1, denn sie tragen Nim-
ben) sowie acht andere Jünger. In der untern
Hälfte des Bildes sind um einen viereckigen
Brunnen, in dessen Wasser weiße, runde, wie
Hostien geformte Gegenstände schwimmen,
zehn Personen ver-
sammelt. In der Mitte
steht ein vornehmer
Mann. Er und ein
zu seiner Rechten
stehender Mann neh-
men aus dem Brun-
nenwasser je eine je-
ner „Hostien" heraus.
Ein zu seiner Linken
stehender Mann greift
nicht nur nach einer
„Hostie", sondern
trinkt auch von dem
Wasser, das er in ein
flaches Gefäß schöpf-
te. Neben letzterm
naht sich ein ärmlich
gekleideter Mann, um
ein ähnliches Gefäß
mit Wasser zu füllen.
Zur Rechten treten
drei Leute hinzu.
Ein vornehmer Herr
kommt zur Linken heran. Im Vordergrunde
scheint eine Frau ihre Hände mittels des
ausfließenden Wassers -waschen zu wollen-
Ihr gegenüber trinkt ein Mann von dem aus
einem zweiten Rohre ausströmenden Wasser.
Zwischen ihnen labt sich ein Hund an dem
aus dem Brunnen auf die Erde geflossenen
Wasser. Er wird wohl an das Wort erinnern
wollen, welches die Chananäerin dem Herrn
entgegnete: „Auch die Hündlein essen von
den Brosamen, die vom Tische ihrer Heren
fallen" (Matthäus 15, 27). Die auf dem Unter-
satz des Brunnens angebrachte Inschrift lautet:
Communis vila.
Dieselbe Inschrift finden wir im Pfingst-
bilde des Egbertskodex (Abb. 3). In ihm
popuhi •'.
1907. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 6.
168
Mittwoch der ersten Adventswoche neben der
Perikope aus Lukas 3, 3 f. die Darstellung der
Predigt des Vorläufers, für den Freitag neben
Lukas 3, 7 f.- eine ähnliche Szene, für den
zweiten Adventssonntag neben der Verkündi-
gung der Vorzeichen des Weltunterganges
(Lukas 21, 25 f.) ein Bild, worin Jesus seinen
Jüngern jene Vorzeichen nennt. In ähnlicher
Weise begnügt sich der Maler in vielen Bil-
dern, nicht den Inhalt der Worte des Herrn
zu schildern, sondern nur den Herrn redend
zu zeigen, wodurch er gezwungen wird, die
Szene des zwischen seinen Jüngern oder bei j
den Juden stehenden
Heilandes sehr oft zu
wiederholen.. Auch
der Täufer erscheint
öfter redend vor ver-
schiedenen Zuhörern.
In jenen Bildern,
worin Ereignisse vor
Augen gestellt wer-
den, lehnt der Zeich-
ner sich natürlich an
ältere Vorbilder so
an, daß er in den
Bahnen der dama-'
ligen Ikonographie
bleibt. Er schließt
sich jedoch nie ganz
genau, nie sklavisch
seinen Vorlagen an,
sondern ändert sie
stets mehr oder
weniger.
In manchen Kom-
positionen hat er die
Bilder des gegen Ende des X. Jahrh. in der
Reichenau ausgemalten Codex Egberti, welcher
zu seiner Zeit im Dome zu Trier lag, wenig
umgearbeitet, so z. B. in den Darstellungen
der Taufe (27), der Stillung des Meeresstur-
mes (33), der Heilung eines Blinden (40) und
eines Gichtbrüchigen (50), der Auferweckung
des Lazarus (71), des Fischfanges nach Christi
Auferstehung (100) und der Erscheinung des
Erstandenen vor Magdalena (101). Sehr wich-
tig ist mit Rücksicht auf Benutzung des Egberts-
evangelistars seineDarstellung des Pfingst-
festes (121).
Der obere Teil der Miniatur (Abb. 2) stellt
einen Saal dar, ist darum mit Zinnen gekrönt.
Die Taube des Heiligen Geistes steigt her-
"triNT-
Abbildung 3.
nieder aus einem mit Sternen gefüllten, von
Wolken umsäumten, den Himmel darstellen-
den Kreisabschnitt. Ein Band geht von ihr
aus, verzweigt sich und endet auf den Köpfen
von zwölf Personen. Diese stellen jedoch
nicht die Apostel dar, sondern Maria, zu deren
Rechten Petrus sitzt, zwei andere Frauen
(wohl „Maria Magdalena und die andere
Maria", Matthäus 28, 1, denn sie tragen Nim-
ben) sowie acht andere Jünger. In der untern
Hälfte des Bildes sind um einen viereckigen
Brunnen, in dessen Wasser weiße, runde, wie
Hostien geformte Gegenstände schwimmen,
zehn Personen ver-
sammelt. In der Mitte
steht ein vornehmer
Mann. Er und ein
zu seiner Rechten
stehender Mann neh-
men aus dem Brun-
nenwasser je eine je-
ner „Hostien" heraus.
Ein zu seiner Linken
stehender Mann greift
nicht nur nach einer
„Hostie", sondern
trinkt auch von dem
Wasser, das er in ein
flaches Gefäß schöpf-
te. Neben letzterm
naht sich ein ärmlich
gekleideter Mann, um
ein ähnliches Gefäß
mit Wasser zu füllen.
Zur Rechten treten
drei Leute hinzu.
Ein vornehmer Herr
kommt zur Linken heran. Im Vordergrunde
scheint eine Frau ihre Hände mittels des
ausfließenden Wassers -waschen zu wollen-
Ihr gegenüber trinkt ein Mann von dem aus
einem zweiten Rohre ausströmenden Wasser.
Zwischen ihnen labt sich ein Hund an dem
aus dem Brunnen auf die Erde geflossenen
Wasser. Er wird wohl an das Wort erinnern
wollen, welches die Chananäerin dem Herrn
entgegnete: „Auch die Hündlein essen von
den Brosamen, die vom Tische ihrer Heren
fallen" (Matthäus 15, 27). Die auf dem Unter-
satz des Brunnens angebrachte Inschrift lautet:
Communis vila.
Dieselbe Inschrift finden wir im Pfingst-
bilde des Egbertskodex (Abb. 3). In ihm
popuhi •'.