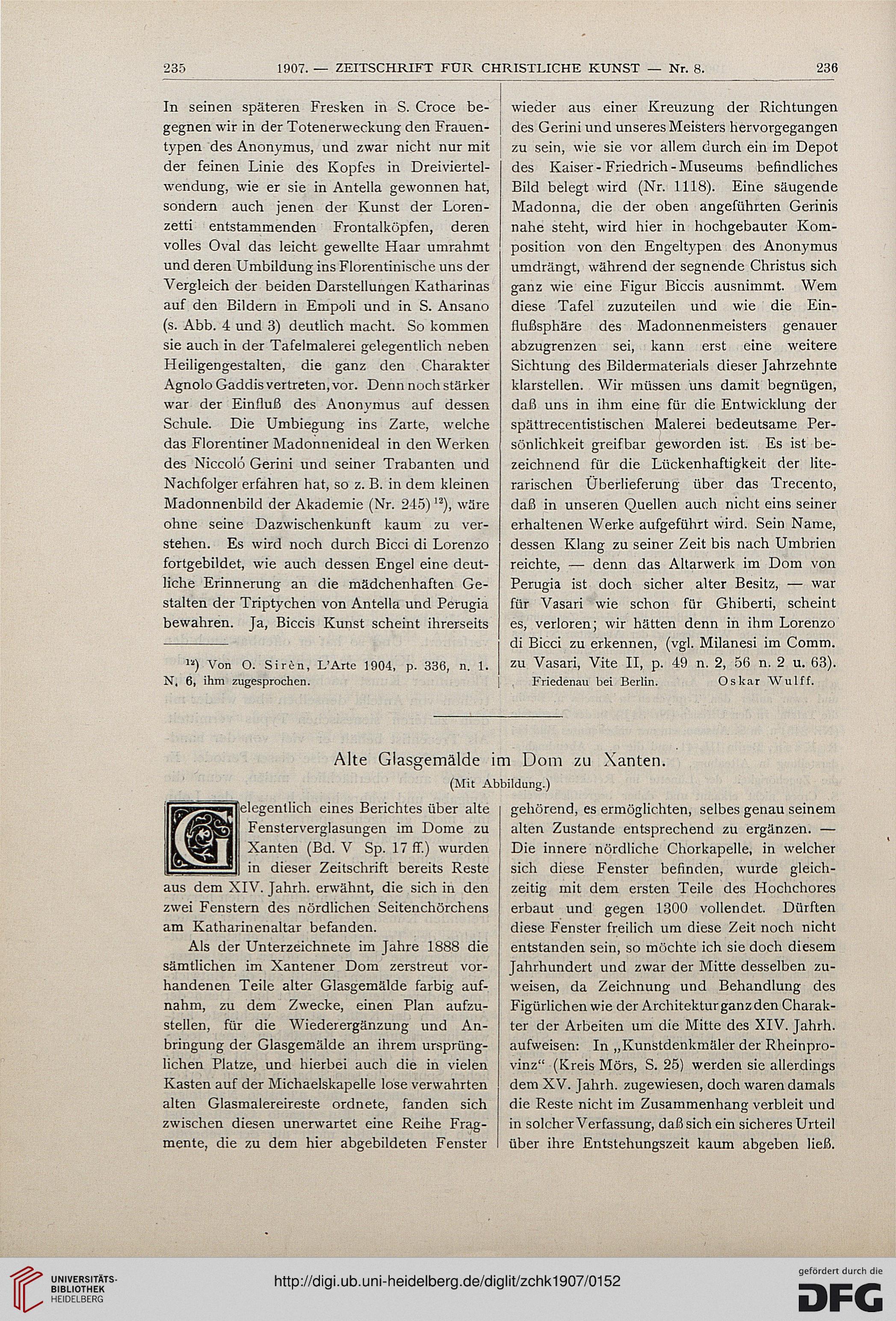235
1907.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST
Nr. 8.
236
In seinen späteren Fresken in S. Croce be-
gegnen wir in der Totenerweckung den Frauen-
typen des Anonymus, und zwar nicht nur mit
der feinen Linie des Kopfes in Dreiviertel-
wendung, wie er sie in Antella gewonnen hat,
sondern auch jenen der Kunst der Loren-
zetti entstammenden Frontalköpfen, deren
volles Oval das leicht gewellte Haar umrahmt
und deren Umbildung ins Florentinische uns der
Vergleich der beiden Darstellungen Katharinas
auf den Bildern in Empoli und in S. Ansano
(s. Abb. 4 und 3) deutlich macht. So kommen
sie auch in der Tafelmalerei gelegentlich neben
Heiligengestalten, die ganz den Charakter
Agnolo Gaddis vertreten, vor. Denn noch stärker
war der Einfluß des Anonymus auf dessen
Schule. Die Umbiegung ins Zarte, welche
das Florentiner Madonnenideal in den Werken
des Niccolö Gerini und seiner Trabanten und
Nachfolger erfahren hat, so z. B. in dem kleinen
Madonnenbild der Akademie (Nr. 245)12), wäre
ohne seine Dazwischenkunft kaum zu ver-
stehen. Es wird noch durch Bicci di Lorenzo
fortgebildet, wie auch dessen Engel eine deut-
liche Erinnerung an die mädchenhaften Ge-
stalten der Triptychen von Antella und Perugia
bewahren. Ja, Biccis Kunst scheint ihrerseits
la) Von O. Siren, L'Arte 1904, p. 336, n. 1.
N, 6, ihm zugesprochen.
wieder aus einer Kreuzung der Richtungen
des Gerini und unseres Meisters hervorgegangen
zu sein, wie sie vor allem durch ein im Depot
des Kaiser - Friedrich - Museums befindliches
Bild belegt wird (Nr. 1118). Eine säugende
Madonna, die der oben angeführten Gerinis
nahe steht, wird hier in hochgebauter Kom-
position von den Engeltypen des Anonymus
umdrängt, während der segnende Christus sich
ganz wie eine Figur Biccis ausnimmt. Wem
diese Tafel zuzuteilen und wie die Ein-
flußsphäre des Madonnenmeisters genauer
abzugrenzen sei, kann erst eine weitere
Sichtung des Bildermaterials dieser Jahrzehnte
klarstellen. Wir müssen uns damit begnügen,
daß uns in ihm eine für die Entwicklung der
spättrecentistischen Malerei bedeutsame Per-
sönlichkeit greifbar geworden ist. Es ist be-
zeichnend für die Lückenhaftigkeit der lite-
rarischen Überlieferung über das Trecento,
daß in unseren Quellen auch nicht eins seiner
erhaltenen Werke aufgeführt wird. Sein Name,
dessen Klang zu seiner Zeit bis nach Umbrien
reichte, — denn das Altarwerk im Dom von
Perugia ist doch sicher alter Besitz, — war
für Vasari wie schon für Ghiberti, scheint
es, verloren; wir hätten denn in ihm Lorenzo
di Bicci zu erkennen, (vgl. Milanesi im Comm.
zu Vasari, Vite II, p. 49 n. 2, 56 n. 2 u. 63).
Friedenau bei Berlin. Oskar Wulff.
Alte Glasgemälde im Dom zu Xanten.
(Mit Abbildung.)
elegentlich eines Berichtes über alte
Fensterverglasungen im Dome zu
Xanten (Bd. V Sp. 17 ff.) wurden
in dieser Zeitschrift bereits Reste
aus dem XIV. Jahrh. erwähnt, die sich in den
zwei Fenstern des nördlichen Seitenchörchens
am Katharinenaltar befanden.
Als der Unterzeichnete im Jahre 1888 die
sämtlichen im Xantener Dom zerstreut vor-
handenen Teile alter Glasgemälde farbig auf-
nahm, zu dem Zwecke, einen Plan aufzu-
stellen, für die Wiederergänzung und An-
bringung der Glasgemälde an ihrem ursprüng-
lichen Platze, und hierbei auch die in vielen
Kasten auf der Michaelskapelle lose verwahrten
alten Glasmalereireste ordnete, fanden sich
zwischen diesen unerwartet eine Reihe Frag-
mente, die zu dem hier abgebildeten Fenster
gehörend, es ermöglichten, selbes genau seinem
alten Zustande entsprechend zu ergänzen. —
Die innere nördliche Chorkapelle, in welcher
sich diese Fenster befinden, wurde gleich-
zeitig mit dem ersten Teile des Hochchores
erbaut und gegen 1300 vollendet. Dürften
diese Fenster freilich um diese Zeit noch nicht
entstanden sein, so möchte ich sie doch diesem
Jahrhundert und zwar der Mitte desselben zu-
weisen, da Zeichnung und Behandlung des
Figürlichen wie der Architektur ganz den Charak-
ter der Arbeiten um die Mitte des XIV. Jahrh.
aufweisen: In „Kunstdenkmäler der Rheinpro-
vinz" (Kreis Mors, S. 25) werden sie allerdings
dem XV. Jahrh. zugewiesen, doch waren damals
die Reste nicht im Zusammenhang verbleit und
in solcher Verfassung, daß sich ein sicheres Urteil
über ihre Entstehungszeit kaum abgeben ließ.
1907.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST
Nr. 8.
236
In seinen späteren Fresken in S. Croce be-
gegnen wir in der Totenerweckung den Frauen-
typen des Anonymus, und zwar nicht nur mit
der feinen Linie des Kopfes in Dreiviertel-
wendung, wie er sie in Antella gewonnen hat,
sondern auch jenen der Kunst der Loren-
zetti entstammenden Frontalköpfen, deren
volles Oval das leicht gewellte Haar umrahmt
und deren Umbildung ins Florentinische uns der
Vergleich der beiden Darstellungen Katharinas
auf den Bildern in Empoli und in S. Ansano
(s. Abb. 4 und 3) deutlich macht. So kommen
sie auch in der Tafelmalerei gelegentlich neben
Heiligengestalten, die ganz den Charakter
Agnolo Gaddis vertreten, vor. Denn noch stärker
war der Einfluß des Anonymus auf dessen
Schule. Die Umbiegung ins Zarte, welche
das Florentiner Madonnenideal in den Werken
des Niccolö Gerini und seiner Trabanten und
Nachfolger erfahren hat, so z. B. in dem kleinen
Madonnenbild der Akademie (Nr. 245)12), wäre
ohne seine Dazwischenkunft kaum zu ver-
stehen. Es wird noch durch Bicci di Lorenzo
fortgebildet, wie auch dessen Engel eine deut-
liche Erinnerung an die mädchenhaften Ge-
stalten der Triptychen von Antella und Perugia
bewahren. Ja, Biccis Kunst scheint ihrerseits
la) Von O. Siren, L'Arte 1904, p. 336, n. 1.
N, 6, ihm zugesprochen.
wieder aus einer Kreuzung der Richtungen
des Gerini und unseres Meisters hervorgegangen
zu sein, wie sie vor allem durch ein im Depot
des Kaiser - Friedrich - Museums befindliches
Bild belegt wird (Nr. 1118). Eine säugende
Madonna, die der oben angeführten Gerinis
nahe steht, wird hier in hochgebauter Kom-
position von den Engeltypen des Anonymus
umdrängt, während der segnende Christus sich
ganz wie eine Figur Biccis ausnimmt. Wem
diese Tafel zuzuteilen und wie die Ein-
flußsphäre des Madonnenmeisters genauer
abzugrenzen sei, kann erst eine weitere
Sichtung des Bildermaterials dieser Jahrzehnte
klarstellen. Wir müssen uns damit begnügen,
daß uns in ihm eine für die Entwicklung der
spättrecentistischen Malerei bedeutsame Per-
sönlichkeit greifbar geworden ist. Es ist be-
zeichnend für die Lückenhaftigkeit der lite-
rarischen Überlieferung über das Trecento,
daß in unseren Quellen auch nicht eins seiner
erhaltenen Werke aufgeführt wird. Sein Name,
dessen Klang zu seiner Zeit bis nach Umbrien
reichte, — denn das Altarwerk im Dom von
Perugia ist doch sicher alter Besitz, — war
für Vasari wie schon für Ghiberti, scheint
es, verloren; wir hätten denn in ihm Lorenzo
di Bicci zu erkennen, (vgl. Milanesi im Comm.
zu Vasari, Vite II, p. 49 n. 2, 56 n. 2 u. 63).
Friedenau bei Berlin. Oskar Wulff.
Alte Glasgemälde im Dom zu Xanten.
(Mit Abbildung.)
elegentlich eines Berichtes über alte
Fensterverglasungen im Dome zu
Xanten (Bd. V Sp. 17 ff.) wurden
in dieser Zeitschrift bereits Reste
aus dem XIV. Jahrh. erwähnt, die sich in den
zwei Fenstern des nördlichen Seitenchörchens
am Katharinenaltar befanden.
Als der Unterzeichnete im Jahre 1888 die
sämtlichen im Xantener Dom zerstreut vor-
handenen Teile alter Glasgemälde farbig auf-
nahm, zu dem Zwecke, einen Plan aufzu-
stellen, für die Wiederergänzung und An-
bringung der Glasgemälde an ihrem ursprüng-
lichen Platze, und hierbei auch die in vielen
Kasten auf der Michaelskapelle lose verwahrten
alten Glasmalereireste ordnete, fanden sich
zwischen diesen unerwartet eine Reihe Frag-
mente, die zu dem hier abgebildeten Fenster
gehörend, es ermöglichten, selbes genau seinem
alten Zustande entsprechend zu ergänzen. —
Die innere nördliche Chorkapelle, in welcher
sich diese Fenster befinden, wurde gleich-
zeitig mit dem ersten Teile des Hochchores
erbaut und gegen 1300 vollendet. Dürften
diese Fenster freilich um diese Zeit noch nicht
entstanden sein, so möchte ich sie doch diesem
Jahrhundert und zwar der Mitte desselben zu-
weisen, da Zeichnung und Behandlung des
Figürlichen wie der Architektur ganz den Charak-
ter der Arbeiten um die Mitte des XIV. Jahrh.
aufweisen: In „Kunstdenkmäler der Rheinpro-
vinz" (Kreis Mors, S. 25) werden sie allerdings
dem XV. Jahrh. zugewiesen, doch waren damals
die Reste nicht im Zusammenhang verbleit und
in solcher Verfassung, daß sich ein sicheres Urteil
über ihre Entstehungszeit kaum abgeben ließ.