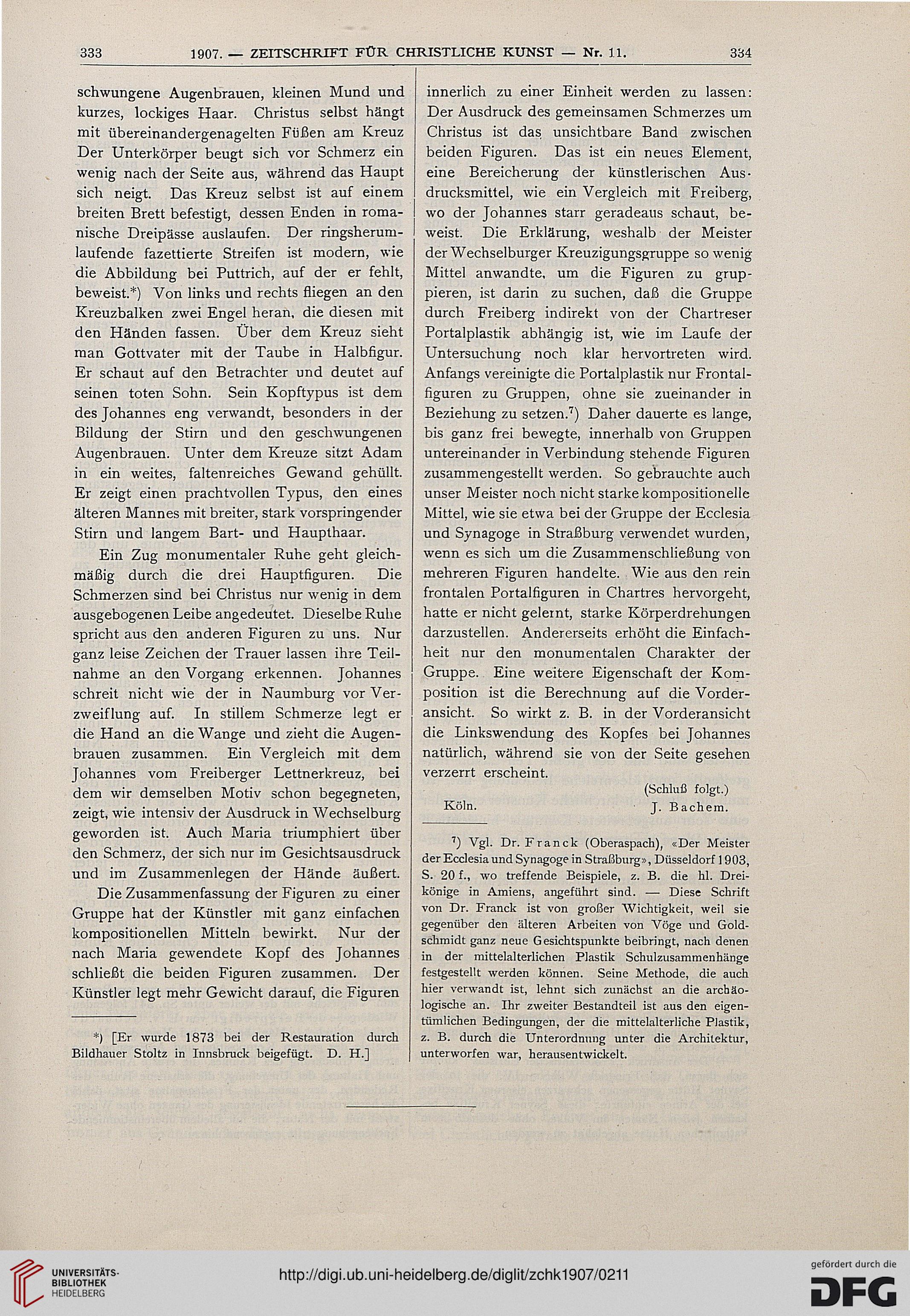333
1907. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.
334
schwungene Augenbrauen, kleinen Mund und
kurzes, lockiges Haar. Christus selbst hängt
mit übereinandergenagelten Füßen am Kreuz
Der Unterkörper beugt sich vor Schmerz ein
wenig nach der Seite aus, während das Haupt
sich neigt. Das Kreuz selbst ist auf einem
breiten Brett befestigt, dessen Enden in roma-
nische Dreipässe auslaufen. Der ringsherum-
laufende fazettierte Streifen ist modern, wie
die Abbildung bei Puttrich, auf der er fehlt,
beweist.*) Von links und rechts fliegen an den
Kreuzbalken zwei Engel heran, die diesen mit
den Händen fassen. Über dem Kreuz sieht
man Gottvater mit der Taube in Halbfigur.
Er schaut auf den Betrachter und deutet auf
seinen toten Sohn. Sein Kopftypus ist dem
des Johannes eng verwandt, besonders in der
Bildung der Stirn und den geschwungenen
Augenbrauen. Unter dem Kreuze sitzt Adam
in ein weites, faltenreiches Gewand gehüllt.
Er zeigt einen prachtvollen Typus, den eines
älteren Mannes mit breiter, stark vorspringender
Stirn und langem Bart- und Haupthaar.
Ein Zug monumentaler Ruhe geht gleich-
mäßig durch die drei Hauptfiguren. Die
Schmerzen sind bei Christus nur wenig in dem
ausgebogenen Leibe angedeutet. Dieselbe Ruhe
spricht aus den anderen Figuren zu uns. Nur
ganz leise Zeichen der Trauer lassen ihre Teil-
nahme an den Vorgang erkennen. Johannes
schreit nicht wie der in Naumburg vor Ver-
zweiflung auf. In stillem Schmerze legt er
die Hand an die Wange und zieht die Augen-
brauen zusammen. Ein Vergleich mit dem
Johannes vom Freiberger Lettnerkreuz, bei
dem wir demselben Motiv schon begegneten,
zeigt, wie intensiv der Ausdruck in Wechselburg
geworden ist. Auch Maria triumphiert über
den Schmerz, der sich nur im Gesichtsausdruck
und im Zusammenlegen der Hände äußert.
Die Zusammenfassung der Figuren zu einer
Gruppe hat der Künstler mit ganz einfachen
kompositionellen Mitteln bewirkt. Nur der
nach Maria gewendete Kopf des Johannes
schließt die beiden Figuren zusammen. Der
Künstler legt mehr Gewicht darauf, die Figuren
innerlich zu einer Einheit werden zu lassen:
Der Ausdruck des gemeinsamen Schmerzes um
Christus ist das unsichtbare Band zwischen
beiden Figuren. Das ist ein neues Element,
eine Bereicherung der künstlerischen Aus-
drucksmittel, wie ein Vergleich mit Freiberg,
wo der Johannes starr geradeaus schaut, be-
weist. Die Erklärung, weshalb der Meister
der Wechselburger Kreuzigungsgruppe so wenig
Mittel anwandte, um die Figuren zu grup-
pieren, ist darin zu suchen, daß die Gruppe
durch Freiberg indirekt von der Chartreser
Portalplastik abhängig ist, wie im Laufe der
Untersuchung noch klar hervortreten wird.
Anfangs vereinigte die Portalplastik nur Frontal-
figuren zu Gruppen, ohne sie zueinander in
Beziehung zu setzen.7) Daher dauerte es lange,
bis ganz frei bewegte, innerhalb von Gruppen
untereinander in Verbindung stehende Figuren
zusammengestellt werden. So gebrauchte auch
unser Meister noch nicht starke kompositioneile
Mittel, wie sie etwa bei der Gruppe der Ecclesia
und Synagoge in Straßburg verwendet wurden,
wenn es sich um die Zusammenschließung von
mehreren Figuren handelte. Wie aus den rein
frontalen Portalfiguren in Chartres hervorgeht,
hatte er nicht gelernt, starke Körperdrehungen
darzustellen. Andererseits erhöht die Einfach-
heit nur den monumentalen Charakter der
Gruppe. Eine weitere Eigenschaft der Kom-
position ist die Berechnung auf die Vorder-
ansicht. So wirkt z. B. in der Vorderansicht
die Linkswendung des Kopfes bei Johannes
natürlich, während sie von der Seite gesehen
verzerrt erscheint.
(Schluß folgt.)
Köln. J. Bachern.
*) [Er wurde 1873 bei der Restauration durch
Bildhauer Stoltz in Innsbruck beigefügt. D. H.]
7) Vgl. Dr. Franck (Oberaspach), «Der Meister
der Ecclesia und Synagoge in Straßburg», Düsseldorf 1903,
S. 20 f., wo treffende Beispiele, z. B. die hl. Drei-
könige in Amiens, angeführt sind. — Diese Schrift
von Dr. Franck ist von großer Wichtigkeit, weil sie
gegenüber den älteren Arbeiten von Vöge und Gold-
schmidt ganz neue Gesichtspunkte beibringt, nach denen
in der mittelalterlichen Plastik Schulzusammenhänge
festgestellt werden können. Seine Methode, die auch
hier verwandt ist, lehnt sich zunächst an die archäo-
logische an. Ihr zweiter Bestandteil ist aus den eigen-
tümlichen Bedingungen, der die mittelalterliche Plastik,
z. B. durch die Unterordnung unter die Architektur,
unterworfen war, herausentwickelt.
1907. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.
334
schwungene Augenbrauen, kleinen Mund und
kurzes, lockiges Haar. Christus selbst hängt
mit übereinandergenagelten Füßen am Kreuz
Der Unterkörper beugt sich vor Schmerz ein
wenig nach der Seite aus, während das Haupt
sich neigt. Das Kreuz selbst ist auf einem
breiten Brett befestigt, dessen Enden in roma-
nische Dreipässe auslaufen. Der ringsherum-
laufende fazettierte Streifen ist modern, wie
die Abbildung bei Puttrich, auf der er fehlt,
beweist.*) Von links und rechts fliegen an den
Kreuzbalken zwei Engel heran, die diesen mit
den Händen fassen. Über dem Kreuz sieht
man Gottvater mit der Taube in Halbfigur.
Er schaut auf den Betrachter und deutet auf
seinen toten Sohn. Sein Kopftypus ist dem
des Johannes eng verwandt, besonders in der
Bildung der Stirn und den geschwungenen
Augenbrauen. Unter dem Kreuze sitzt Adam
in ein weites, faltenreiches Gewand gehüllt.
Er zeigt einen prachtvollen Typus, den eines
älteren Mannes mit breiter, stark vorspringender
Stirn und langem Bart- und Haupthaar.
Ein Zug monumentaler Ruhe geht gleich-
mäßig durch die drei Hauptfiguren. Die
Schmerzen sind bei Christus nur wenig in dem
ausgebogenen Leibe angedeutet. Dieselbe Ruhe
spricht aus den anderen Figuren zu uns. Nur
ganz leise Zeichen der Trauer lassen ihre Teil-
nahme an den Vorgang erkennen. Johannes
schreit nicht wie der in Naumburg vor Ver-
zweiflung auf. In stillem Schmerze legt er
die Hand an die Wange und zieht die Augen-
brauen zusammen. Ein Vergleich mit dem
Johannes vom Freiberger Lettnerkreuz, bei
dem wir demselben Motiv schon begegneten,
zeigt, wie intensiv der Ausdruck in Wechselburg
geworden ist. Auch Maria triumphiert über
den Schmerz, der sich nur im Gesichtsausdruck
und im Zusammenlegen der Hände äußert.
Die Zusammenfassung der Figuren zu einer
Gruppe hat der Künstler mit ganz einfachen
kompositionellen Mitteln bewirkt. Nur der
nach Maria gewendete Kopf des Johannes
schließt die beiden Figuren zusammen. Der
Künstler legt mehr Gewicht darauf, die Figuren
innerlich zu einer Einheit werden zu lassen:
Der Ausdruck des gemeinsamen Schmerzes um
Christus ist das unsichtbare Band zwischen
beiden Figuren. Das ist ein neues Element,
eine Bereicherung der künstlerischen Aus-
drucksmittel, wie ein Vergleich mit Freiberg,
wo der Johannes starr geradeaus schaut, be-
weist. Die Erklärung, weshalb der Meister
der Wechselburger Kreuzigungsgruppe so wenig
Mittel anwandte, um die Figuren zu grup-
pieren, ist darin zu suchen, daß die Gruppe
durch Freiberg indirekt von der Chartreser
Portalplastik abhängig ist, wie im Laufe der
Untersuchung noch klar hervortreten wird.
Anfangs vereinigte die Portalplastik nur Frontal-
figuren zu Gruppen, ohne sie zueinander in
Beziehung zu setzen.7) Daher dauerte es lange,
bis ganz frei bewegte, innerhalb von Gruppen
untereinander in Verbindung stehende Figuren
zusammengestellt werden. So gebrauchte auch
unser Meister noch nicht starke kompositioneile
Mittel, wie sie etwa bei der Gruppe der Ecclesia
und Synagoge in Straßburg verwendet wurden,
wenn es sich um die Zusammenschließung von
mehreren Figuren handelte. Wie aus den rein
frontalen Portalfiguren in Chartres hervorgeht,
hatte er nicht gelernt, starke Körperdrehungen
darzustellen. Andererseits erhöht die Einfach-
heit nur den monumentalen Charakter der
Gruppe. Eine weitere Eigenschaft der Kom-
position ist die Berechnung auf die Vorder-
ansicht. So wirkt z. B. in der Vorderansicht
die Linkswendung des Kopfes bei Johannes
natürlich, während sie von der Seite gesehen
verzerrt erscheint.
(Schluß folgt.)
Köln. J. Bachern.
*) [Er wurde 1873 bei der Restauration durch
Bildhauer Stoltz in Innsbruck beigefügt. D. H.]
7) Vgl. Dr. Franck (Oberaspach), «Der Meister
der Ecclesia und Synagoge in Straßburg», Düsseldorf 1903,
S. 20 f., wo treffende Beispiele, z. B. die hl. Drei-
könige in Amiens, angeführt sind. — Diese Schrift
von Dr. Franck ist von großer Wichtigkeit, weil sie
gegenüber den älteren Arbeiten von Vöge und Gold-
schmidt ganz neue Gesichtspunkte beibringt, nach denen
in der mittelalterlichen Plastik Schulzusammenhänge
festgestellt werden können. Seine Methode, die auch
hier verwandt ist, lehnt sich zunächst an die archäo-
logische an. Ihr zweiter Bestandteil ist aus den eigen-
tümlichen Bedingungen, der die mittelalterliche Plastik,
z. B. durch die Unterordnung unter die Architektur,
unterworfen war, herausentwickelt.