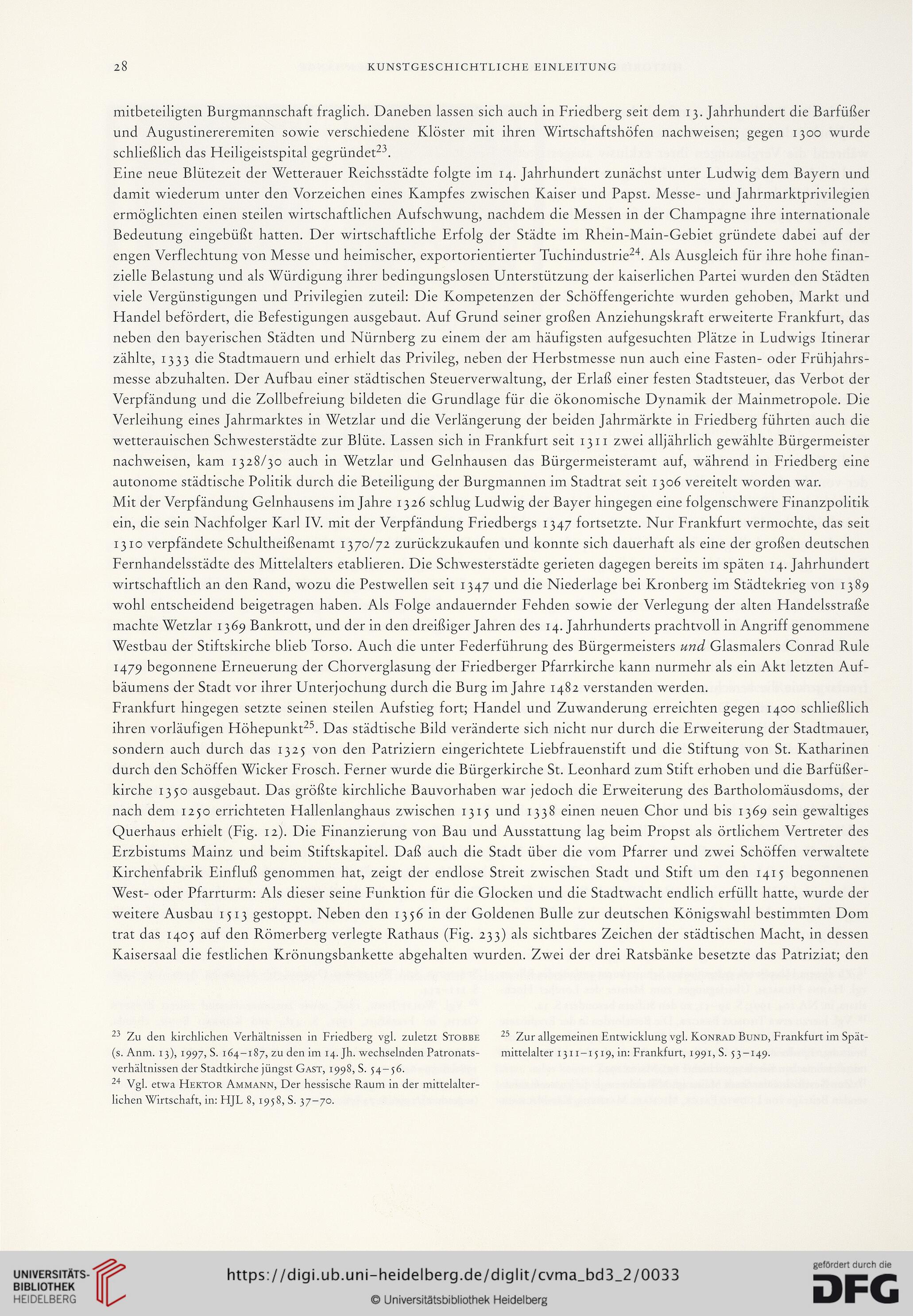28
KUNSTGESCHICHTLICHE EINLEITUNG
mitbeteiligten Burgmannschaft fraglich. Daneben lassen sich auch in Friedberg seit dem 13. Jahrhundert die Barfüßer
und Augustinereremiten sowie verschiedene Klöster mit ihren Wirtschaftshöfen nachweisen; gegen 1300 wurde
schließlich das Heiligeistspital gegründet23.
Eine neue Blütezeit der Wetterauer Reichsstädte folgte im 14. Jahrhundert zunächst unter Ludwig dem Bayern und
damit wiederum unter den Vorzeichen eines Kampfes zwischen Kaiser und Papst. Messe- und Jahrmarktprivilegien
ermöglichten einen steilen wirtschaftlichen Aufschwung, nachdem die Messen in der Champagne ihre internationale
Bedeutung eingebüßt hatten. Der wirtschaftliche Erfolg der Städte im Rhein-Main-Gebiet gründete dabei auf der
engen Verflechtung von Messe und heimischer, exportorientierter Tuchindustrie24. Als Ausgleich für ihre hohe finan-
zielle Belastung und als Würdigung ihrer bedingungslosen Unterstützung der kaiserlichen Partei wurden den Städten
viele Vergünstigungen und Privilegien zuteil: Die Kompetenzen der Schöffengerichte wurden gehoben, Markt und
Handel befördert, die Befestigungen ausgebaut. Auf Grund seiner großen Anziehungskraft erweiterte Frankfurt, das
neben den bayerischen Städten und Nürnberg zu einem der am häufigsten aufgesuchten Plätze in Ludwigs Itinerar
zählte, 1333 die Stadtmauern und erhielt das Privileg, neben der Herbstmesse nun auch eine Fasten- oder Frühjahrs-
messe abzuhalten. Der Aufbau einer städtischen Steuerverwaltung, der Erlaß einer festen Stadtsteuer, das Verbot der
Verpfändung und die Zollbefreiung bildeten die Grundlage für die ökonomische Dynamik der Mainmetropole. Die
Verleihung eines Jahrmarktes in Wetzlar und die Verlängerung der beiden Jahrmärkte in Friedberg führten auch die
wetterauischen Schwesterstädte zur Blüte. Lassen sich in Frankfurt seit 1311 zwei alljährlich gewählte Bürgermeister
nachweisen, kam 1328/30 auch in Wetzlar und Gelnhausen das Bürgermeisteramt auf, während in Friedberg eine
autonome städtische Politik durch die Beteiligung der Burgmannen im Stadtrat seit 1306 vereitelt worden war.
Mit der Verpfändung Gelnhausens im Jahre 1326 schlug Ludwig der Bayer hingegen eine folgenschwere Finanzpolitik
ein, die sein Nachfolger Karl IV. mit der Verpfändung Friedbergs 1347 fortsetzte. Nur Frankfurt vermochte, das seit
1310 verpfändete Schultheißenamt 1370/72 zurückzukaufen und konnte sich dauerhaft als eine der großen deutschen
Fernhandelsstädte des Mittelalters etablieren. Die Schwesterstädte gerieten dagegen bereits im späten 14. Jahrhundert
wirtschaftlich an den Rand, wozu die Pestwellen seit 1347 und die Niederlage bei Kronberg im Städtekrieg von 1389
wohl entscheidend beigetragen haben. Als Folge andauernder Fehden sowie der Verlegung der alten Handelsstraße
machte Wetzlar 1369 Bankrott, und der in den dreißiger Jahren des 14. Jahrhunderts prachtvoll in Angriff genommene
Westbau der Stiftskirche blieb Torso. Auch die unter Federführung des Bürgermeisters und Glasmalers Conrad Rule
1479 begonnene Erneuerung der Chorverglasung der Friedberger Pfarrkirche kann nurmehr als ein Akt letzten Auf-
bäumens der Stadt vor ihrer Unterjochung durch die Burg im Jahre 1482 verstanden werden.
Frankfurt hingegen setzte seinen steilen Aufstieg fort; Handel und Zuwanderung erreichten gegen 1400 schließlich
ihren vorläufigen Höhepunkt25. Das städtische Bild veränderte sich nicht nur durch die Erweiterung der Stadtmauer,
sondern auch durch das 1325 von den Patriziern eingerichtete Liebfrauenstift und die Stiftung von St. Katharinen
durch den Schöffen Wicker Frosch. Ferner wurde die Bürgerkirche St. Leonhard zum Stift erhoben und die Barfüßer-
kirche 1350 ausgebaut. Das größte kirchliche Bauvorhaben war jedoch die Erweiterung des Bartholomäusdoms, der
nach dem 1250 errichteten Hallenlanghaus zwischen 1315 und 1338 einen neuen Chor und bis 1369 sein gewaltiges
Querhaus erhielt (Fig. 12). Die Finanzierung von Bau und Ausstattung lag beim Propst als örtlichem Vertreter des
Erzbistums Mainz und beim Stiftskapitel. Daß auch die Stadt über die vom Pfarrer und zwei Schöffen verwaltete
Kirchenfabrik Einfluß genommen hat, zeigt der endlose Streit zwischen Stadt und Stift um den 1415 begonnenen
West- oder Pfarrturm: Als dieser seine Funktion für die Glocken und die Stadtwacht endlich erfüllt hatte, wurde der
weitere Ausbau 1513 gestoppt. Neben den 1356 in der Goldenen Bulle zur deutschen Königswahl bestimmten Dom
trat das 1405 auf den Römerberg verlegte Rathaus (Fig. 233) als sichtbares Zeichen der städtischen Macht, in dessen
Kaisersaal die festlichen Krönungsbankette abgehalten wurden. Zwei der drei Ratsbänke besetzte das Patriziat; den
23 Zu den kirchlichen Verhältnissen in Friedberg vgl. zuletzt Stobbe 25 Zur allgemeinen Entwicklung vgl. Konrad Bund, Frankfurt im Spät-
(s. Anm. 13), 1997, S. 164-187, zu den im 14. Jh. wechselnden Patronats- mittelalter 1311-1519, in: Frankfurt, 1991, S. 53-149.
Verhältnissen der Stadtkirche jüngst Gast, 1998, S. 54-56.
24 Vgl. etwa Hektor Ammann, Der hessische Raum in der mittelalter-
lichen Wirtschaft, in: HJL 8, 1958, S. 37-70.
KUNSTGESCHICHTLICHE EINLEITUNG
mitbeteiligten Burgmannschaft fraglich. Daneben lassen sich auch in Friedberg seit dem 13. Jahrhundert die Barfüßer
und Augustinereremiten sowie verschiedene Klöster mit ihren Wirtschaftshöfen nachweisen; gegen 1300 wurde
schließlich das Heiligeistspital gegründet23.
Eine neue Blütezeit der Wetterauer Reichsstädte folgte im 14. Jahrhundert zunächst unter Ludwig dem Bayern und
damit wiederum unter den Vorzeichen eines Kampfes zwischen Kaiser und Papst. Messe- und Jahrmarktprivilegien
ermöglichten einen steilen wirtschaftlichen Aufschwung, nachdem die Messen in der Champagne ihre internationale
Bedeutung eingebüßt hatten. Der wirtschaftliche Erfolg der Städte im Rhein-Main-Gebiet gründete dabei auf der
engen Verflechtung von Messe und heimischer, exportorientierter Tuchindustrie24. Als Ausgleich für ihre hohe finan-
zielle Belastung und als Würdigung ihrer bedingungslosen Unterstützung der kaiserlichen Partei wurden den Städten
viele Vergünstigungen und Privilegien zuteil: Die Kompetenzen der Schöffengerichte wurden gehoben, Markt und
Handel befördert, die Befestigungen ausgebaut. Auf Grund seiner großen Anziehungskraft erweiterte Frankfurt, das
neben den bayerischen Städten und Nürnberg zu einem der am häufigsten aufgesuchten Plätze in Ludwigs Itinerar
zählte, 1333 die Stadtmauern und erhielt das Privileg, neben der Herbstmesse nun auch eine Fasten- oder Frühjahrs-
messe abzuhalten. Der Aufbau einer städtischen Steuerverwaltung, der Erlaß einer festen Stadtsteuer, das Verbot der
Verpfändung und die Zollbefreiung bildeten die Grundlage für die ökonomische Dynamik der Mainmetropole. Die
Verleihung eines Jahrmarktes in Wetzlar und die Verlängerung der beiden Jahrmärkte in Friedberg führten auch die
wetterauischen Schwesterstädte zur Blüte. Lassen sich in Frankfurt seit 1311 zwei alljährlich gewählte Bürgermeister
nachweisen, kam 1328/30 auch in Wetzlar und Gelnhausen das Bürgermeisteramt auf, während in Friedberg eine
autonome städtische Politik durch die Beteiligung der Burgmannen im Stadtrat seit 1306 vereitelt worden war.
Mit der Verpfändung Gelnhausens im Jahre 1326 schlug Ludwig der Bayer hingegen eine folgenschwere Finanzpolitik
ein, die sein Nachfolger Karl IV. mit der Verpfändung Friedbergs 1347 fortsetzte. Nur Frankfurt vermochte, das seit
1310 verpfändete Schultheißenamt 1370/72 zurückzukaufen und konnte sich dauerhaft als eine der großen deutschen
Fernhandelsstädte des Mittelalters etablieren. Die Schwesterstädte gerieten dagegen bereits im späten 14. Jahrhundert
wirtschaftlich an den Rand, wozu die Pestwellen seit 1347 und die Niederlage bei Kronberg im Städtekrieg von 1389
wohl entscheidend beigetragen haben. Als Folge andauernder Fehden sowie der Verlegung der alten Handelsstraße
machte Wetzlar 1369 Bankrott, und der in den dreißiger Jahren des 14. Jahrhunderts prachtvoll in Angriff genommene
Westbau der Stiftskirche blieb Torso. Auch die unter Federführung des Bürgermeisters und Glasmalers Conrad Rule
1479 begonnene Erneuerung der Chorverglasung der Friedberger Pfarrkirche kann nurmehr als ein Akt letzten Auf-
bäumens der Stadt vor ihrer Unterjochung durch die Burg im Jahre 1482 verstanden werden.
Frankfurt hingegen setzte seinen steilen Aufstieg fort; Handel und Zuwanderung erreichten gegen 1400 schließlich
ihren vorläufigen Höhepunkt25. Das städtische Bild veränderte sich nicht nur durch die Erweiterung der Stadtmauer,
sondern auch durch das 1325 von den Patriziern eingerichtete Liebfrauenstift und die Stiftung von St. Katharinen
durch den Schöffen Wicker Frosch. Ferner wurde die Bürgerkirche St. Leonhard zum Stift erhoben und die Barfüßer-
kirche 1350 ausgebaut. Das größte kirchliche Bauvorhaben war jedoch die Erweiterung des Bartholomäusdoms, der
nach dem 1250 errichteten Hallenlanghaus zwischen 1315 und 1338 einen neuen Chor und bis 1369 sein gewaltiges
Querhaus erhielt (Fig. 12). Die Finanzierung von Bau und Ausstattung lag beim Propst als örtlichem Vertreter des
Erzbistums Mainz und beim Stiftskapitel. Daß auch die Stadt über die vom Pfarrer und zwei Schöffen verwaltete
Kirchenfabrik Einfluß genommen hat, zeigt der endlose Streit zwischen Stadt und Stift um den 1415 begonnenen
West- oder Pfarrturm: Als dieser seine Funktion für die Glocken und die Stadtwacht endlich erfüllt hatte, wurde der
weitere Ausbau 1513 gestoppt. Neben den 1356 in der Goldenen Bulle zur deutschen Königswahl bestimmten Dom
trat das 1405 auf den Römerberg verlegte Rathaus (Fig. 233) als sichtbares Zeichen der städtischen Macht, in dessen
Kaisersaal die festlichen Krönungsbankette abgehalten wurden. Zwei der drei Ratsbänke besetzte das Patriziat; den
23 Zu den kirchlichen Verhältnissen in Friedberg vgl. zuletzt Stobbe 25 Zur allgemeinen Entwicklung vgl. Konrad Bund, Frankfurt im Spät-
(s. Anm. 13), 1997, S. 164-187, zu den im 14. Jh. wechselnden Patronats- mittelalter 1311-1519, in: Frankfurt, 1991, S. 53-149.
Verhältnissen der Stadtkirche jüngst Gast, 1998, S. 54-56.
24 Vgl. etwa Hektor Ammann, Der hessische Raum in der mittelalter-
lichen Wirtschaft, in: HJL 8, 1958, S. 37-70.