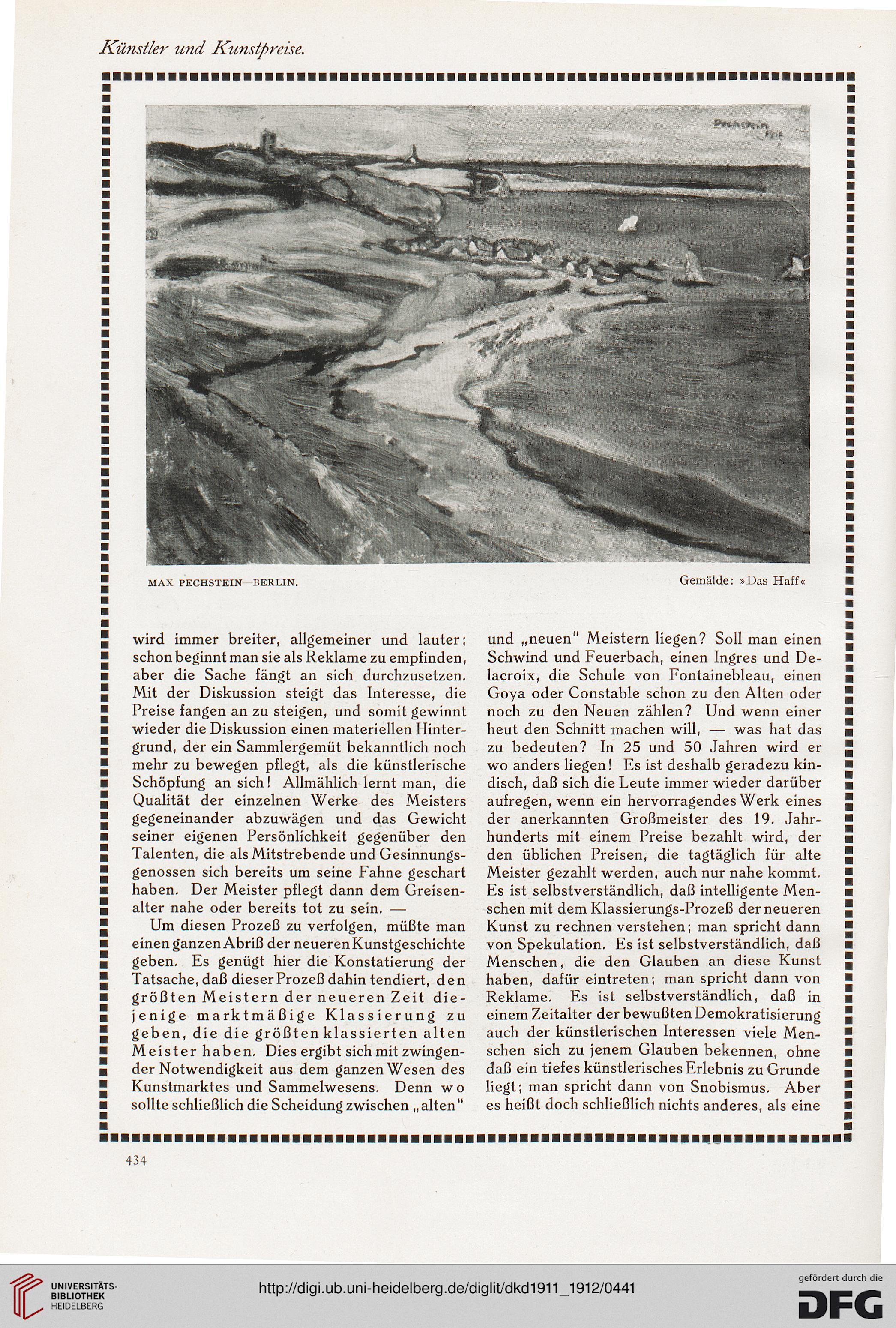Künstler und Kunstpreise.
MAX PECHSTEIN BERLIN.
Gemälde: »Das Haff«
wird immer breiter, allgemeiner und lauter;
schonbeginnt man sie als Reklame zu empfinden,
aber die Sache fängt an sich durchzusetzen.
Mit der Diskussion steigt das Interesse, die
Preise fangen an zu steigen, und somit gewinnt
wieder die Diskussion einen materiellen Hinter-
grund, der ein Sammlergemüt bekanntlich noch
mehr zu bewegen pflegt, als die künstlerische
Schöpfung an sich! Allmählich lernt man, die
Qualität der einzelnen Werke des Meisters
gegeneinander abzuwägen und das Gewicht
seiner eigenen Persönlichkeit gegenüber den
Talenten, die als Mitstrebende und Gesinnungs-
genossen sich bereits um seine Fahne geschart
haben. Der Meister pflegt dann dem Greisen-
alter nahe oder bereits tot zu sein. —
Um diesen Prozeß zu verfolgen, müßte man
einen ganzen Abriß der neueren Kunstgeschichte
geben. Es genügt hier die Konstatierung der
Tatsache, daß dieser Prozeß dahin tendiert, den
größten Meistern der neueren Zeit die-
jenige marktmäßige Klassierung zu
geben, die die größten klassierten alten
Meister haben. Dies ergibt sich mit zwingen-
der Notwendigkeit aus dem ganzen Wesen des
Kunstmarktes und Sammelwesens. Denn w o
sollte schließlich die Scheidung zwischen „ alten "
und „neuen" Meistern liegen? Soll man einen
Schwind und Feuerbach, einen Ingres und De-
lacroix, die Schule von Fontainebleau, einen
Goya oder Constable schon zu den Alten oder
noch zu den Neuen zählen? Und wenn einer
heut den Schnitt machen will, — was hat das
zu bedeuten? In 25 und 50 Jahren wird er
wo anders liegen! Es ist deshalb geradezu kin-
disch, daß sich die Leute immer wieder darüber
aufregen, wenn ein hervorragendes Werk eines
der anerkannten Großmeister des 19. Jahr-
hunderts mit einem Preise bezahlt wird, der
den üblichen Preisen, die tagtäglich für alte
Meister gezahlt werden, auch nur nahe kommt.
Es ist selbstverständlich, daß intelligente Men-
schen mit dem Klassierungs-Prozeß der neueren
Kunst zu rechnen verstehen; man spricht dann
von Spekulation. Es ist selbstverständlich, daß
Menschen, die den Glauben an diese Kunst
haben, dafür eintreten; man spricht dann von
Reklame. Es ist selbstverständlich, daß in
einem Zeitalter der bewuß ten Demokratisierung
auch der künstlerischen Interessen viele Men-
schen sich zu jenem Glauben bekennen, ohne
daß ein tiefes künstlerisches Erlebnis zu Grunde
liegt; man spricht dann von Snobismus. Aber
es heißt doch schließlich nichts anderes, als eine
434
MAX PECHSTEIN BERLIN.
Gemälde: »Das Haff«
wird immer breiter, allgemeiner und lauter;
schonbeginnt man sie als Reklame zu empfinden,
aber die Sache fängt an sich durchzusetzen.
Mit der Diskussion steigt das Interesse, die
Preise fangen an zu steigen, und somit gewinnt
wieder die Diskussion einen materiellen Hinter-
grund, der ein Sammlergemüt bekanntlich noch
mehr zu bewegen pflegt, als die künstlerische
Schöpfung an sich! Allmählich lernt man, die
Qualität der einzelnen Werke des Meisters
gegeneinander abzuwägen und das Gewicht
seiner eigenen Persönlichkeit gegenüber den
Talenten, die als Mitstrebende und Gesinnungs-
genossen sich bereits um seine Fahne geschart
haben. Der Meister pflegt dann dem Greisen-
alter nahe oder bereits tot zu sein. —
Um diesen Prozeß zu verfolgen, müßte man
einen ganzen Abriß der neueren Kunstgeschichte
geben. Es genügt hier die Konstatierung der
Tatsache, daß dieser Prozeß dahin tendiert, den
größten Meistern der neueren Zeit die-
jenige marktmäßige Klassierung zu
geben, die die größten klassierten alten
Meister haben. Dies ergibt sich mit zwingen-
der Notwendigkeit aus dem ganzen Wesen des
Kunstmarktes und Sammelwesens. Denn w o
sollte schließlich die Scheidung zwischen „ alten "
und „neuen" Meistern liegen? Soll man einen
Schwind und Feuerbach, einen Ingres und De-
lacroix, die Schule von Fontainebleau, einen
Goya oder Constable schon zu den Alten oder
noch zu den Neuen zählen? Und wenn einer
heut den Schnitt machen will, — was hat das
zu bedeuten? In 25 und 50 Jahren wird er
wo anders liegen! Es ist deshalb geradezu kin-
disch, daß sich die Leute immer wieder darüber
aufregen, wenn ein hervorragendes Werk eines
der anerkannten Großmeister des 19. Jahr-
hunderts mit einem Preise bezahlt wird, der
den üblichen Preisen, die tagtäglich für alte
Meister gezahlt werden, auch nur nahe kommt.
Es ist selbstverständlich, daß intelligente Men-
schen mit dem Klassierungs-Prozeß der neueren
Kunst zu rechnen verstehen; man spricht dann
von Spekulation. Es ist selbstverständlich, daß
Menschen, die den Glauben an diese Kunst
haben, dafür eintreten; man spricht dann von
Reklame. Es ist selbstverständlich, daß in
einem Zeitalter der bewuß ten Demokratisierung
auch der künstlerischen Interessen viele Men-
schen sich zu jenem Glauben bekennen, ohne
daß ein tiefes künstlerisches Erlebnis zu Grunde
liegt; man spricht dann von Snobismus. Aber
es heißt doch schließlich nichts anderes, als eine
434