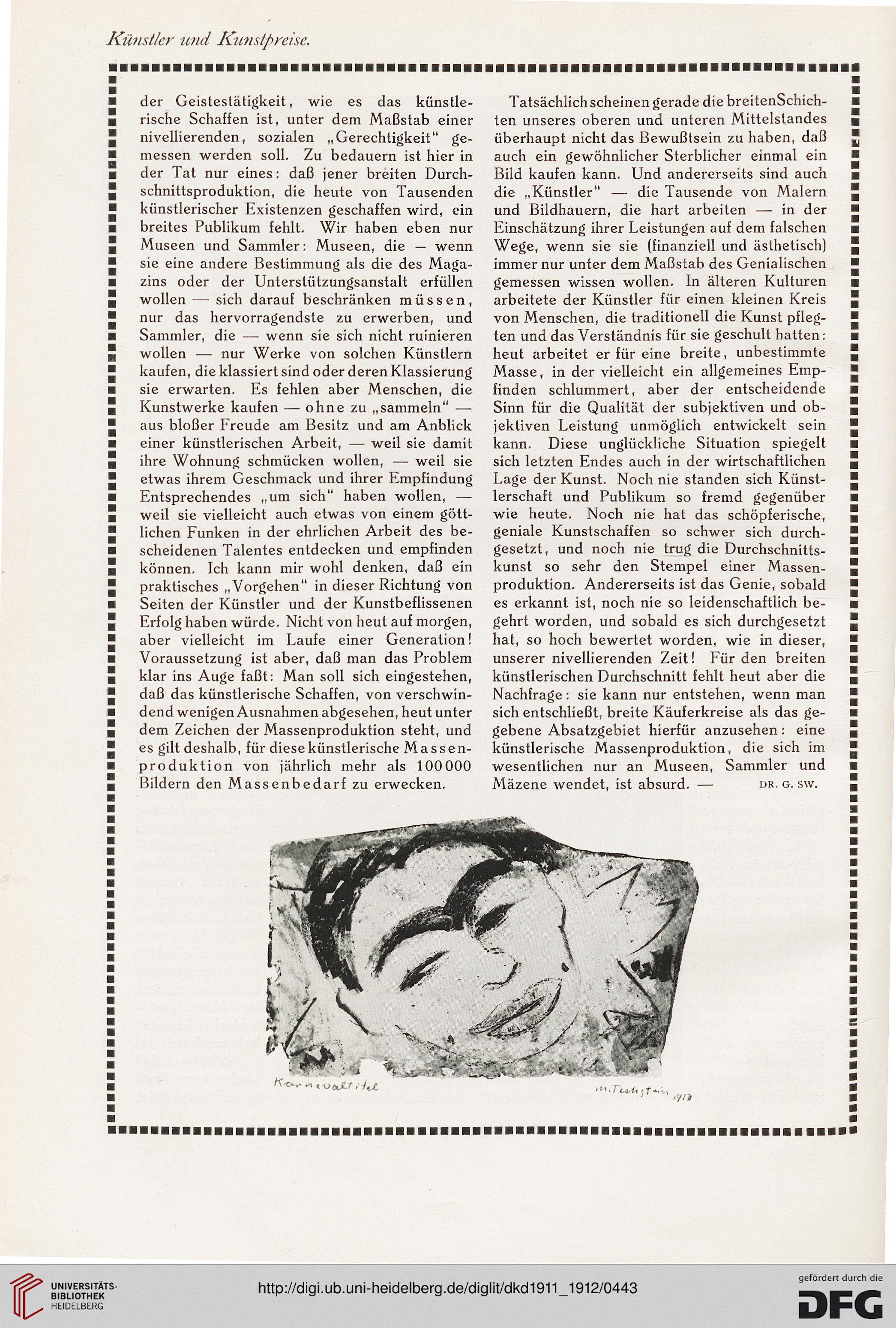Künstler und Kunstpreise.
der Geistestätigkeit, wie es das künstle-
rische Schaffen ist, unter dem Maßstab einer
nivellierenden, sozialen „Gerechtigkeit" ge-
messen werden soll. Zu bedauern ist hier in
der Tat nur eines: daß jener breiten Durch-
schnittsproduktion, die heute von Tausenden
künstlerischer Existenzen geschaffen wird, ein
breites Publikum fehlt. Wir haben eben nur
Museen und Sammler: Museen, die — wenn
sie eine andere Bestimmung als die des Maga-
zins oder der Unterstützungsanstalt erfüllen
wollen — sich darauf beschränken müssen,
nur das hervorragendste zu erwerben, und
Sammler, die — wenn sie sich nicht ruinieren
wollen — nur Werke von solchen Künstlern
kaufen, die klassiert sind oder deren Klassierung
sie erwarten. Es fehlen aber Menschen, die
Kunstwerke kaufen — ohne zu „sammeln" —
aus bloßer Freude am Besitz und am Anblick
einer künstlerischen Arbeit, — weil sie damit
ihre Wohnung schmücken wollen, — weil sie
etwas ihrem Geschmack und ihrer Empfindung
Entsprechendes „um sich" haben wollen, —
weil sie vielleicht auch etwas von einem gött-
lichen Funken in der ehrlichen Arbeit des be-
scheidenen Talentes entdecken und empfinden
können. Ich kann mir wohl denken, daß ein
praktisches „Vorgehen" in dieser Richtung von
Seiten der Künstler und der Kunstbeflissenen
Erfolg haben würde. Nicht von heut auf morgen,
aber vielleicht im Laufe einer Generation \
Voraussetzung ist aber, daß man das Problem
klar ins Auge faßt: Man soll sich eingestehen,
daß das künstlerische Schaffen, von verschwin-
dend wenigen Ausnahmen abgesehen, heut unter
dem Zeichen der Massenproduktion steht, und
es gilt deshalb, für diese künstlerische Massen-
produktion von jährlich mehr als 100000
Bildern den Massenbedarf zu erwecken.
Tatsächlich scheinen gerade die breitenSchich-
ten unseres oberen und unteren Mittelstandes
überhaupt nicht das Bewußtsein zu haben, daß
auch ein gewöhnlicher Sterblicher einmal ein
Bild kaufen kann. Und andererseits sind auch
die „Künstler" — die Tausende von Malern
und Bildhauern, die hart arbeiten — in der
Einschätzung ihrer Leistungen auf dem falschen
Wege, wenn sie sie (finanziell und ästhetisch)
immer nur unter dem Maßstab des Genialischen
gemessen wissen wollen. In älteren Kulturen
arbeitete der Künstler für einen kleinen Kreis
von Menschen, die traditionell die Kunst pfleg-
ten und das Verständnis für sie geschult hatten:
heut arbeitet er für eine breite, unbestimmte
Masse, in der vielleicht ein allgemeines Emp-
finden schlummert, aber der entscheidende
Sinn für die Qualität der subjektiven und ob-
jektiven Leistung unmöglich entwickelt sein
kann. Diese unglückliche Situation spiegelt
sich letzten Endes auch in der wirtschaftlichen
Lage der Kunst. Noch nie standen sich Künst-
lerschaft und Publikum so fremd gegenüber
wie heute. Noch nie hat das schöpferische,
geniale Kunstschaffen so schwer sich durch-
gesetzt, und noch nie trug die Durchschnitts-
kunst so sehr den Stempel einer Massen-
produktion. Andererseits ist das Genie, sobald
es erkannt ist, noch nie so leidenschaftlich be-
gehrt worden, und sobald es sich durchgesetzt
hat, so hoch bewertet worden, wie in dieser,
unserer nivellierenden Zeit! Für den breiten
künstlerischen Durchschnitt fehlt heut aber die
Nachfrage: sie kann nur entstehen, wenn man
sich entschließt, breite Käuferkreise als das ge-
gebene Absatzgebiet hierfür anzusehen: eine
künstlerische Massenproduktion, die sich im
wesentlichen nur an Museen, Sammler und
Mäzene wendet, ist absurd. — ur- g. sw.
der Geistestätigkeit, wie es das künstle-
rische Schaffen ist, unter dem Maßstab einer
nivellierenden, sozialen „Gerechtigkeit" ge-
messen werden soll. Zu bedauern ist hier in
der Tat nur eines: daß jener breiten Durch-
schnittsproduktion, die heute von Tausenden
künstlerischer Existenzen geschaffen wird, ein
breites Publikum fehlt. Wir haben eben nur
Museen und Sammler: Museen, die — wenn
sie eine andere Bestimmung als die des Maga-
zins oder der Unterstützungsanstalt erfüllen
wollen — sich darauf beschränken müssen,
nur das hervorragendste zu erwerben, und
Sammler, die — wenn sie sich nicht ruinieren
wollen — nur Werke von solchen Künstlern
kaufen, die klassiert sind oder deren Klassierung
sie erwarten. Es fehlen aber Menschen, die
Kunstwerke kaufen — ohne zu „sammeln" —
aus bloßer Freude am Besitz und am Anblick
einer künstlerischen Arbeit, — weil sie damit
ihre Wohnung schmücken wollen, — weil sie
etwas ihrem Geschmack und ihrer Empfindung
Entsprechendes „um sich" haben wollen, —
weil sie vielleicht auch etwas von einem gött-
lichen Funken in der ehrlichen Arbeit des be-
scheidenen Talentes entdecken und empfinden
können. Ich kann mir wohl denken, daß ein
praktisches „Vorgehen" in dieser Richtung von
Seiten der Künstler und der Kunstbeflissenen
Erfolg haben würde. Nicht von heut auf morgen,
aber vielleicht im Laufe einer Generation \
Voraussetzung ist aber, daß man das Problem
klar ins Auge faßt: Man soll sich eingestehen,
daß das künstlerische Schaffen, von verschwin-
dend wenigen Ausnahmen abgesehen, heut unter
dem Zeichen der Massenproduktion steht, und
es gilt deshalb, für diese künstlerische Massen-
produktion von jährlich mehr als 100000
Bildern den Massenbedarf zu erwecken.
Tatsächlich scheinen gerade die breitenSchich-
ten unseres oberen und unteren Mittelstandes
überhaupt nicht das Bewußtsein zu haben, daß
auch ein gewöhnlicher Sterblicher einmal ein
Bild kaufen kann. Und andererseits sind auch
die „Künstler" — die Tausende von Malern
und Bildhauern, die hart arbeiten — in der
Einschätzung ihrer Leistungen auf dem falschen
Wege, wenn sie sie (finanziell und ästhetisch)
immer nur unter dem Maßstab des Genialischen
gemessen wissen wollen. In älteren Kulturen
arbeitete der Künstler für einen kleinen Kreis
von Menschen, die traditionell die Kunst pfleg-
ten und das Verständnis für sie geschult hatten:
heut arbeitet er für eine breite, unbestimmte
Masse, in der vielleicht ein allgemeines Emp-
finden schlummert, aber der entscheidende
Sinn für die Qualität der subjektiven und ob-
jektiven Leistung unmöglich entwickelt sein
kann. Diese unglückliche Situation spiegelt
sich letzten Endes auch in der wirtschaftlichen
Lage der Kunst. Noch nie standen sich Künst-
lerschaft und Publikum so fremd gegenüber
wie heute. Noch nie hat das schöpferische,
geniale Kunstschaffen so schwer sich durch-
gesetzt, und noch nie trug die Durchschnitts-
kunst so sehr den Stempel einer Massen-
produktion. Andererseits ist das Genie, sobald
es erkannt ist, noch nie so leidenschaftlich be-
gehrt worden, und sobald es sich durchgesetzt
hat, so hoch bewertet worden, wie in dieser,
unserer nivellierenden Zeit! Für den breiten
künstlerischen Durchschnitt fehlt heut aber die
Nachfrage: sie kann nur entstehen, wenn man
sich entschließt, breite Käuferkreise als das ge-
gebene Absatzgebiet hierfür anzusehen: eine
künstlerische Massenproduktion, die sich im
wesentlichen nur an Museen, Sammler und
Mäzene wendet, ist absurd. — ur- g. sw.