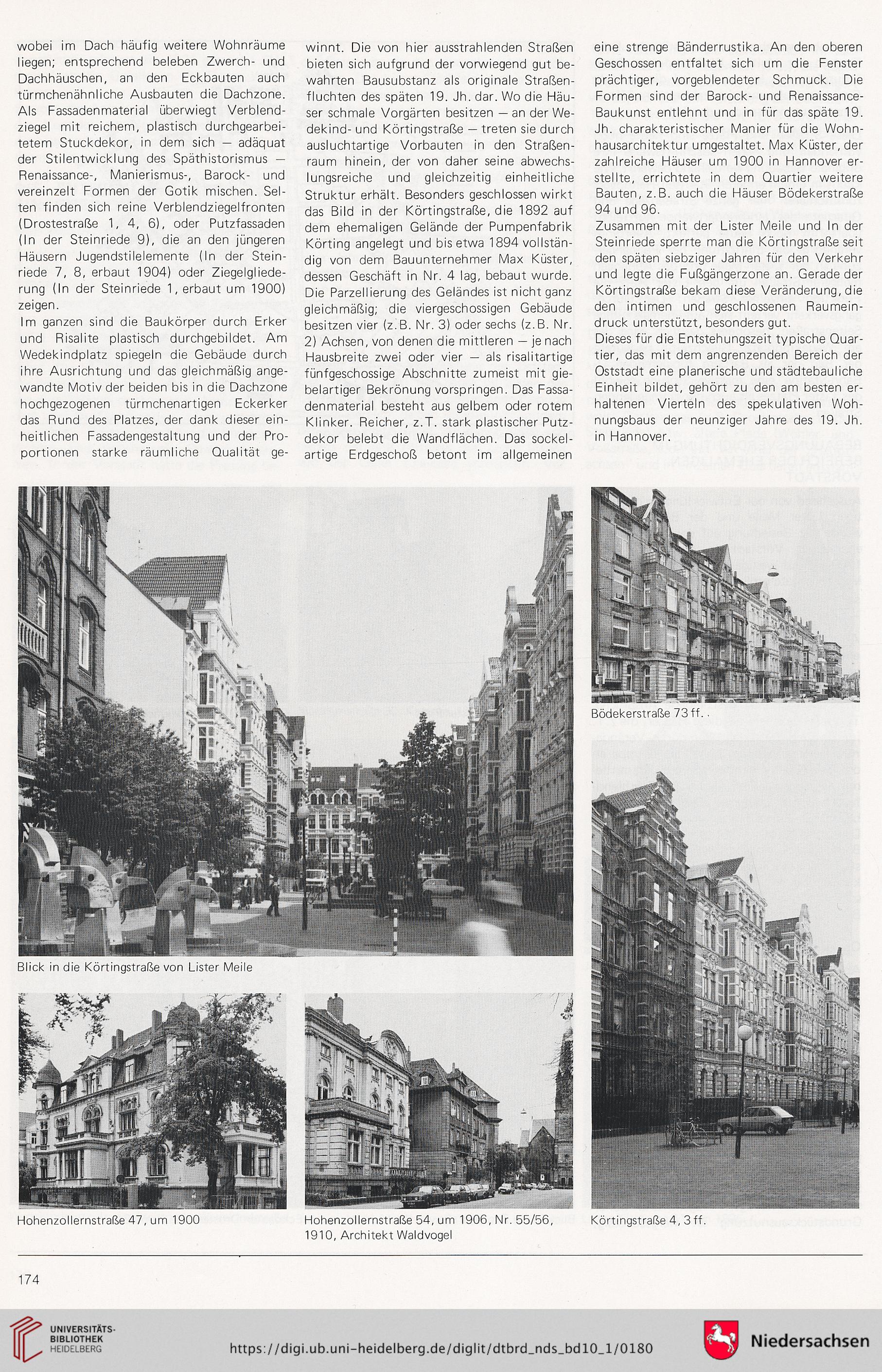wobei im Dach häufig weitere Wohnräume
liegen; entsprechend beleben Zwerch- und
Dachhäuschen, an den Eckbauten auch
türmchenähnliche Ausbauten die Dachzone.
Als Fassadenmaterial überwiegt Verblend-
ziegel mit reichem, plastisch durchgearbei-
tetem Stuckdekor, in dem sich — adäquat
der Stilentwicklung des Späthistorismus —
Renaissance-, Manierismus-, Barock- und
vereinzelt Formen der Gotik mischen. Sel-
ten finden sich reine Verblendziegelfronten
(Drostestraße 1, 4, 6), oder Putzfassaden
(In der Steinriede 9), die an den jüngeren
Häusern Jugendstilelemente (In der Stein-
riede 7, 8, erbaut 1904) oder Ziegelgliede-
rung (In der Steinriede 1, erbaut um 1900)
zeigen.
Im ganzen sind die Baukörper durch Erker
und Risalite plastisch durchgebildet. Am
Wedekindplatz spiegeln die Gebäude durch
ihre Ausrichtung und das gleichmäßig ange-
wandte Motiv der beiden bis in die Dachzone
hochgezogenen türmchenartigen Eckerker
das Rund des Platzes, der dank dieser ein-
heitlichen Fassadengestaltung und der Pro-
portionen starke räumliche Qualität ge-
winnt. Die von hier ausstrahlenden Straßen
bieten sich aufgrund der vorwiegend gut be-
wahrten Bausubstanz als originale Straßen-
fluchten des späten 19. Jh. dar. Wo die Häu-
ser schmale Vorgärten besitzen — an der We-
dekind- und Körtingstraße — treten sie durch
ausluchtartige Vorbauten in den Straßen-
raum hinein, der von daher seine abwechs-
lungsreiche und gleichzeitig einheitliche
Struktur erhält. Besonders geschlossen wirkt
das Bild in der Körtingstraße, die 1892 auf
dem ehemaligen Gelände der Pumpenfabrik
Körting angelegt und bis etwa 1894 vollstän-
dig von dem Bauunternehmer Max Küster,
dessen Geschäft in Nr. 4 lag, bebaut wurde.
Die Parzellierung des Geländes ist nicht ganz
gleichmäßig; die viergeschossigen Gebäude
besitzen vier (z.B. Nr. 3) oder sechs (z.B. Nr.
2) Achsen, von denen die mittleren - je nach
Hausbreite zwei oder vier — als risalitartige
fünfgeschossige Abschnitte zumeist mit gie-
belartiger Bekrönung vorspringen. Das Fassa-
denmaterial besteht aus gelbem oder rotem
Klinker. Reicher, z.T. stark plastischer Putz-
dekor belebt die Wandflächen. Das sockel-
artige Erdgeschoß betont im allgemeinen
Blick in die Körtingstraße von L
Hohenzollernstraße 47, um 1900
Hohenzollernstraße 54, um 1900
1910, Architekt Waldvogel
eine strenge Bänderrustika. An den oberen
Geschossen entfaltet sich um die Fenster
prächtiger, vorgeblendeter Schmuck. Die
Formen sind der Barock- und Renaissance-
Baukunst entlehnt und in für das späte 19.
Jh. charakteristischer Manier für die Wohn-
hausarchitekturumgestaltet. Max Küster, der
zahlreiche Häuser um 1900 in Hannover er-
stellte, errichtete in dem Quartier weitere
Bauten, z.B. auch die Häuser Bödekerstraße
94 und 96.
Zusammen mit der Lister Meile und In der
Steinriede sperrte man die Körtingstraße seit
den späten siebziger Jahren für den Verkehr
und legte die Fußgängerzone an. Gerade der
Körtingstraße bekam diese Veränderung, die
den intimen und geschlossenen Raumein-
druck unterstützt, besonders gut.
Dieses für die Entstehungszeit typische Quar-
tier, das mit dem angrenzenden Bereich der
Oststadt eine planerische und städtebauliche
Einheit bildet, gehört zu den am besten er-
haltenen Vierteln des spekulativen Woh-
nungsbaus der neunziger Jahre des 19. Jh.
in Hannover.
Körtingstraße 4, 3 ff.
174
liegen; entsprechend beleben Zwerch- und
Dachhäuschen, an den Eckbauten auch
türmchenähnliche Ausbauten die Dachzone.
Als Fassadenmaterial überwiegt Verblend-
ziegel mit reichem, plastisch durchgearbei-
tetem Stuckdekor, in dem sich — adäquat
der Stilentwicklung des Späthistorismus —
Renaissance-, Manierismus-, Barock- und
vereinzelt Formen der Gotik mischen. Sel-
ten finden sich reine Verblendziegelfronten
(Drostestraße 1, 4, 6), oder Putzfassaden
(In der Steinriede 9), die an den jüngeren
Häusern Jugendstilelemente (In der Stein-
riede 7, 8, erbaut 1904) oder Ziegelgliede-
rung (In der Steinriede 1, erbaut um 1900)
zeigen.
Im ganzen sind die Baukörper durch Erker
und Risalite plastisch durchgebildet. Am
Wedekindplatz spiegeln die Gebäude durch
ihre Ausrichtung und das gleichmäßig ange-
wandte Motiv der beiden bis in die Dachzone
hochgezogenen türmchenartigen Eckerker
das Rund des Platzes, der dank dieser ein-
heitlichen Fassadengestaltung und der Pro-
portionen starke räumliche Qualität ge-
winnt. Die von hier ausstrahlenden Straßen
bieten sich aufgrund der vorwiegend gut be-
wahrten Bausubstanz als originale Straßen-
fluchten des späten 19. Jh. dar. Wo die Häu-
ser schmale Vorgärten besitzen — an der We-
dekind- und Körtingstraße — treten sie durch
ausluchtartige Vorbauten in den Straßen-
raum hinein, der von daher seine abwechs-
lungsreiche und gleichzeitig einheitliche
Struktur erhält. Besonders geschlossen wirkt
das Bild in der Körtingstraße, die 1892 auf
dem ehemaligen Gelände der Pumpenfabrik
Körting angelegt und bis etwa 1894 vollstän-
dig von dem Bauunternehmer Max Küster,
dessen Geschäft in Nr. 4 lag, bebaut wurde.
Die Parzellierung des Geländes ist nicht ganz
gleichmäßig; die viergeschossigen Gebäude
besitzen vier (z.B. Nr. 3) oder sechs (z.B. Nr.
2) Achsen, von denen die mittleren - je nach
Hausbreite zwei oder vier — als risalitartige
fünfgeschossige Abschnitte zumeist mit gie-
belartiger Bekrönung vorspringen. Das Fassa-
denmaterial besteht aus gelbem oder rotem
Klinker. Reicher, z.T. stark plastischer Putz-
dekor belebt die Wandflächen. Das sockel-
artige Erdgeschoß betont im allgemeinen
Blick in die Körtingstraße von L
Hohenzollernstraße 47, um 1900
Hohenzollernstraße 54, um 1900
1910, Architekt Waldvogel
eine strenge Bänderrustika. An den oberen
Geschossen entfaltet sich um die Fenster
prächtiger, vorgeblendeter Schmuck. Die
Formen sind der Barock- und Renaissance-
Baukunst entlehnt und in für das späte 19.
Jh. charakteristischer Manier für die Wohn-
hausarchitekturumgestaltet. Max Küster, der
zahlreiche Häuser um 1900 in Hannover er-
stellte, errichtete in dem Quartier weitere
Bauten, z.B. auch die Häuser Bödekerstraße
94 und 96.
Zusammen mit der Lister Meile und In der
Steinriede sperrte man die Körtingstraße seit
den späten siebziger Jahren für den Verkehr
und legte die Fußgängerzone an. Gerade der
Körtingstraße bekam diese Veränderung, die
den intimen und geschlossenen Raumein-
druck unterstützt, besonders gut.
Dieses für die Entstehungszeit typische Quar-
tier, das mit dem angrenzenden Bereich der
Oststadt eine planerische und städtebauliche
Einheit bildet, gehört zu den am besten er-
haltenen Vierteln des spekulativen Woh-
nungsbaus der neunziger Jahre des 19. Jh.
in Hannover.
Körtingstraße 4, 3 ff.
174