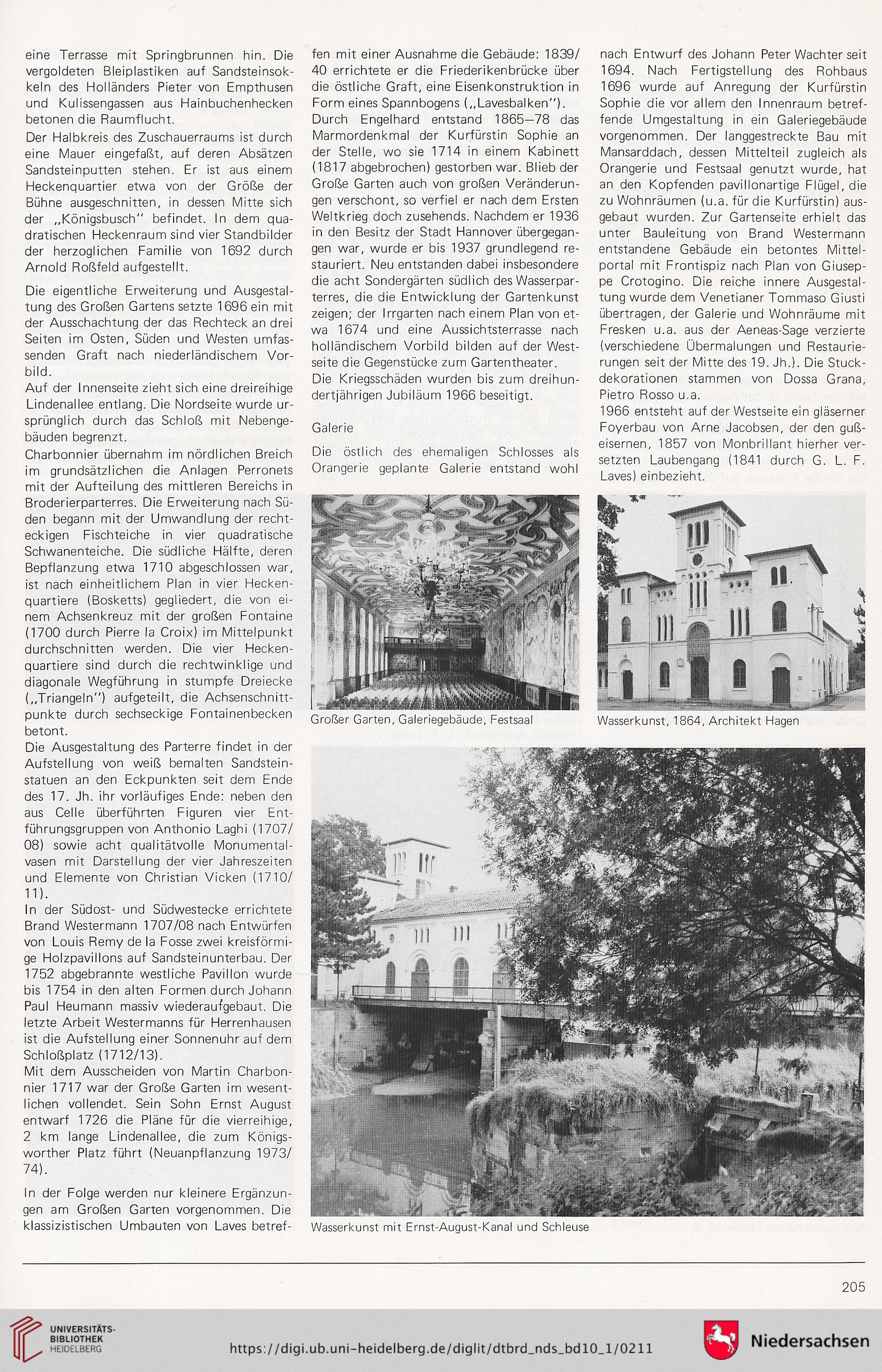eine Terrasse mit Springbrunnen hin. Die
vergoldeten Bleiplastiken auf Sandsteinsok-
keln des Holländers Pieter von Empthusen
und Kulissengassen aus Hainbuchenhecken
betonen die Raumflucht.
Der Halbkreis des Zuschauerraums ist durch
eine Mauer eingefaßt, auf deren Absätzen
Sandsteinputten stehen. Er ist aus einem
Heckenquartier etwa von der Größe der
Bühne ausgeschnitten, in dessen Mitte sich
der „Königsbusch" befindet. In dem qua-
dratischen Heckenraum sind vier Standbilder
der herzoglichen Familie von 1692 durch
Arnold Roßfeld aufgestellt.
Die eigentliche Erweiterung und Ausgestal-
tung des Großen Gartens setzte 1696 ein mit
der Ausschachtung der das Rechteck an drei
Seiten im Osten, Süden und Westen umfas-
senden Graft nach niederländischem Vor-
bild.
Auf der Innenseite zieht sich eine dreireihige
Lindenallee entlang. Die Nordseite wurde ur-
sprünglich durch das Schloß mit Nebenge-
bäuden begrenzt.
Charbonnier übernahm im nördlichen Breich
im grundsätzlichen die Anlagen Perronets
mit der Aufteilung des mittleren Bereichs in
Broderierparterres. Die Erweiterung nach Sü-
den begann mit der Umwandlung der recht-
eckigen Fischteiche in vier quadratische
Schwanenteiche. Die südliche Hälfte, deren
Bepflanzung etwa 1710 abgeschlossen war,
ist nach einheitlichem Plan in vier Hecken-
quartiere (Bosketts) gegliedert, die von ei-
nem Achsenkreuz mit der großen Fontaine
(1700 durch Pierre la Croix) im Mittelpunkt
durchschnitten werden. Die vier Hecken-
quartiere sind durch die rechtwinklige und
diagonale Wegführung in stumpfe Dreiecke
(„Triangeln") aufgeteilt, die Achsenschnitt-
punkte durch sechseckige Fontainenbecken
betont.
Die Ausgestaltung des Parterre findet in der
Aufstellung von weiß bemalten Sandstein-
statuen an den Eckpunkten seit dem Ende
des 17. Jh. ihr vorläufiges Ende: neben den
aus Celle überführten Figuren vier Ent-
führungsgruppen von Anthonio Laghi (1707/
08) sowie acht qualitätvolle Monumental-
vasen mit Darstellung der vier Jahreszeiten
und Elemente von Christian Vicken (1710/
11).
In der Südost- und Südwestecke errichtete
Brand Westermann 1707/08 nach Entwürfen
von Louis Remy de la Fosse zwei kreisförmi-
ge Holzpavillons auf Sandsteinunterbau. Der
1752 abgebrannte westliche Pavillon wurde
bis 1754 in den alten Formen durch Johann
Paul Heumann massiv wiederau-fgebaut. Die
letzte Arbeit Westermanns für Herrenhausen
ist die Aufstellung einer Sonnenuhr auf dem
Schloßplatz (1712/13).
Mit dem Ausscheiden von Martin Charbon-
nier 1717 war der Große Garten im wesent-
lichen vollendet. Sein Sohn Ernst August
entwarf 1726 die Pläne für die vierreihige,
2 km lange Lindenallee, die zum Königs-
worther Platz führt (Neuanpflanzung 1973/
74).
In der Folge werden nur kleinere Ergänzun-
gen am Großen Garten vorgenommen. Die
klassizistischen Umbauten von Laves betref-
fen mit einer Ausnahme die Gebäude: 1839/
40 errichtete er die Friederikenbrücke über
die östliche Graft, eine Eisenkonstruktion in
Form eines Spannbogens („Lavesbalken").
Durch Engelhard entstand 1865—78 das
Marmordenkmal der Kurfürstin Sophie an
der Stelle, wo sie 1714 in einem Kabinett
(1817 abgebrochen) gestorben war. Blieb der
Große Garten auch von großen Veränderun-
gen verschont, so verfiel er nach dem Ersten
Weltkrieg doch zusehends. Nachdem er 1936
in den Besitz der Stadt Hannover übergegan-
gen war, wurde er bis 1937 grundlegend re-
stauriert. Neu entstanden dabei insbesondere
die acht Sondergärten südlich des Wasserpar-
terres, die die Entwicklung der Gartenkunst
zeigen; der Irrgarten nach einem Plan von et-
wa 1674 und eine Aussichtsterrasse nach
holländischem Vorbild bilden auf der West-
seite die Gegenstücke zum Gartentheater.
Die Kriegsschäden wurden bis zum dreihun-
dertjährigen Jubiläum 1966 beseitigt.
Galerie
Die östlich des ehemaligen Schlosses als
Orangerie geplante Galerie entstand wohl
nach Entwurf des Johann Peter Wachter seit
1694. Nach Fertigstellung des Rohbaus
1696 wurde auf Anregung der Kurfürstin
Sophie die vor allem den Innenraum betref-
fende Umgestaltung in ein Galeriegebäude
vorgenommen. Der langgestreckte Bau mit
Mansarddach, dessen Mittelteil zugleich als
Orangerie und Festsaal genutzt wurde, hat
an den Kopfenden pavillonartige Flügel, die
zu Wohnräumen (u.a. für die Kurfürstin) aus-
gebaut wurden. Zur Gartenseite erhielt das
unter Bauleitung von Brand Westermann
entstandene Gebäude ein betontes Mittel-
portal mit Frontispiz nach Plan von Giusep-
pe Crotogino. Die reiche innere Ausgestal-
tung wurde dem Venetianer Tommaso Giusti
übertragen, der Galerie und Wohnräume mit
Fresken u.a. aus der Aeneas-Sage verzierte
(verschiedene Übermalungen und Restaurie-
rungen seit der Mitte des 19. Jh.). Die Stuck-
dekorationen stammen von Dossa Grana,
Pietro Rosso u.a.
1966 entsteht auf der Westseite ein gläserner
Foyerbau von Arne Jacobsen, der den guß-
eisernen, 1857 von Monbrillant hierher ver-
setzten Laubengang (1841 durch G. L. F.
Laves) einbezieht.
Wasserkunst mit Ernst-August-Kanal und Schleuse
205
vergoldeten Bleiplastiken auf Sandsteinsok-
keln des Holländers Pieter von Empthusen
und Kulissengassen aus Hainbuchenhecken
betonen die Raumflucht.
Der Halbkreis des Zuschauerraums ist durch
eine Mauer eingefaßt, auf deren Absätzen
Sandsteinputten stehen. Er ist aus einem
Heckenquartier etwa von der Größe der
Bühne ausgeschnitten, in dessen Mitte sich
der „Königsbusch" befindet. In dem qua-
dratischen Heckenraum sind vier Standbilder
der herzoglichen Familie von 1692 durch
Arnold Roßfeld aufgestellt.
Die eigentliche Erweiterung und Ausgestal-
tung des Großen Gartens setzte 1696 ein mit
der Ausschachtung der das Rechteck an drei
Seiten im Osten, Süden und Westen umfas-
senden Graft nach niederländischem Vor-
bild.
Auf der Innenseite zieht sich eine dreireihige
Lindenallee entlang. Die Nordseite wurde ur-
sprünglich durch das Schloß mit Nebenge-
bäuden begrenzt.
Charbonnier übernahm im nördlichen Breich
im grundsätzlichen die Anlagen Perronets
mit der Aufteilung des mittleren Bereichs in
Broderierparterres. Die Erweiterung nach Sü-
den begann mit der Umwandlung der recht-
eckigen Fischteiche in vier quadratische
Schwanenteiche. Die südliche Hälfte, deren
Bepflanzung etwa 1710 abgeschlossen war,
ist nach einheitlichem Plan in vier Hecken-
quartiere (Bosketts) gegliedert, die von ei-
nem Achsenkreuz mit der großen Fontaine
(1700 durch Pierre la Croix) im Mittelpunkt
durchschnitten werden. Die vier Hecken-
quartiere sind durch die rechtwinklige und
diagonale Wegführung in stumpfe Dreiecke
(„Triangeln") aufgeteilt, die Achsenschnitt-
punkte durch sechseckige Fontainenbecken
betont.
Die Ausgestaltung des Parterre findet in der
Aufstellung von weiß bemalten Sandstein-
statuen an den Eckpunkten seit dem Ende
des 17. Jh. ihr vorläufiges Ende: neben den
aus Celle überführten Figuren vier Ent-
führungsgruppen von Anthonio Laghi (1707/
08) sowie acht qualitätvolle Monumental-
vasen mit Darstellung der vier Jahreszeiten
und Elemente von Christian Vicken (1710/
11).
In der Südost- und Südwestecke errichtete
Brand Westermann 1707/08 nach Entwürfen
von Louis Remy de la Fosse zwei kreisförmi-
ge Holzpavillons auf Sandsteinunterbau. Der
1752 abgebrannte westliche Pavillon wurde
bis 1754 in den alten Formen durch Johann
Paul Heumann massiv wiederau-fgebaut. Die
letzte Arbeit Westermanns für Herrenhausen
ist die Aufstellung einer Sonnenuhr auf dem
Schloßplatz (1712/13).
Mit dem Ausscheiden von Martin Charbon-
nier 1717 war der Große Garten im wesent-
lichen vollendet. Sein Sohn Ernst August
entwarf 1726 die Pläne für die vierreihige,
2 km lange Lindenallee, die zum Königs-
worther Platz führt (Neuanpflanzung 1973/
74).
In der Folge werden nur kleinere Ergänzun-
gen am Großen Garten vorgenommen. Die
klassizistischen Umbauten von Laves betref-
fen mit einer Ausnahme die Gebäude: 1839/
40 errichtete er die Friederikenbrücke über
die östliche Graft, eine Eisenkonstruktion in
Form eines Spannbogens („Lavesbalken").
Durch Engelhard entstand 1865—78 das
Marmordenkmal der Kurfürstin Sophie an
der Stelle, wo sie 1714 in einem Kabinett
(1817 abgebrochen) gestorben war. Blieb der
Große Garten auch von großen Veränderun-
gen verschont, so verfiel er nach dem Ersten
Weltkrieg doch zusehends. Nachdem er 1936
in den Besitz der Stadt Hannover übergegan-
gen war, wurde er bis 1937 grundlegend re-
stauriert. Neu entstanden dabei insbesondere
die acht Sondergärten südlich des Wasserpar-
terres, die die Entwicklung der Gartenkunst
zeigen; der Irrgarten nach einem Plan von et-
wa 1674 und eine Aussichtsterrasse nach
holländischem Vorbild bilden auf der West-
seite die Gegenstücke zum Gartentheater.
Die Kriegsschäden wurden bis zum dreihun-
dertjährigen Jubiläum 1966 beseitigt.
Galerie
Die östlich des ehemaligen Schlosses als
Orangerie geplante Galerie entstand wohl
nach Entwurf des Johann Peter Wachter seit
1694. Nach Fertigstellung des Rohbaus
1696 wurde auf Anregung der Kurfürstin
Sophie die vor allem den Innenraum betref-
fende Umgestaltung in ein Galeriegebäude
vorgenommen. Der langgestreckte Bau mit
Mansarddach, dessen Mittelteil zugleich als
Orangerie und Festsaal genutzt wurde, hat
an den Kopfenden pavillonartige Flügel, die
zu Wohnräumen (u.a. für die Kurfürstin) aus-
gebaut wurden. Zur Gartenseite erhielt das
unter Bauleitung von Brand Westermann
entstandene Gebäude ein betontes Mittel-
portal mit Frontispiz nach Plan von Giusep-
pe Crotogino. Die reiche innere Ausgestal-
tung wurde dem Venetianer Tommaso Giusti
übertragen, der Galerie und Wohnräume mit
Fresken u.a. aus der Aeneas-Sage verzierte
(verschiedene Übermalungen und Restaurie-
rungen seit der Mitte des 19. Jh.). Die Stuck-
dekorationen stammen von Dossa Grana,
Pietro Rosso u.a.
1966 entsteht auf der Westseite ein gläserner
Foyerbau von Arne Jacobsen, der den guß-
eisernen, 1857 von Monbrillant hierher ver-
setzten Laubengang (1841 durch G. L. F.
Laves) einbezieht.
Wasserkunst mit Ernst-August-Kanal und Schleuse
205