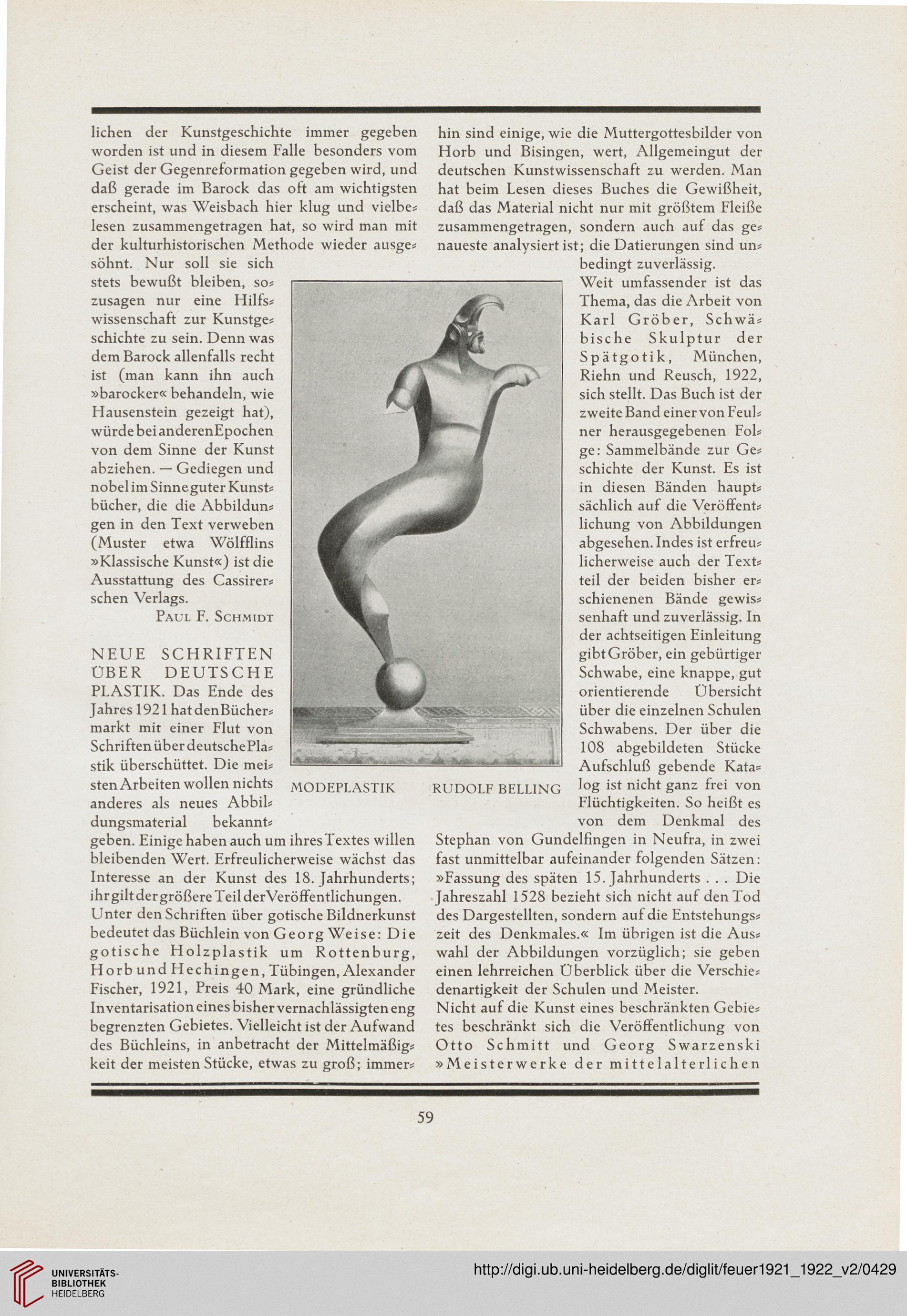liehen der Kunstgeschichte immer gegeben
worden ist und in diesem Falle besonders vom
Geist der Gegenreformation gegeben wird, und
daß gerade im Barock das oft am wichtigsten
erscheint, was Weisbach hier klug und vielbe«
lesen zusammengetragen hat, so wird man mit
der kulturhistorischen Methode wieder ausge«
söhnt. Nur soll sie sich
stets bewußt bleiben, so«
zusagen nur eine Hilfs«
Wissenschaft zur Kunstge«
schichte zu sein. Denn was
dem Barock allenfalls recht
ist (man kann ihn auch
»barocker« behandeln, wie
Hausenstein gezeigt hat),
würde bei anderenEpochen
von dem Sinne der Kunst
abziehen. — Gediegen und
nobel im Sinneguter Kunst«
bücher, die die Abbildun«
gen in den Text verweben
(Muster etwa Wölfflins
»Klassische Kunst«) ist die
Ausstattung des Cassirer«
sehen Verlags.
Paul F. Schmidt
NEUE SCHRIFTEN
ÜBER DEUTSCHE
PLASTIK. Das Ende des
J ahres 1921 hat denBücher«
markt mit einer Flut von
Schriften über deutschePla«
stik überschüttet. Die mei«
sten Arbeiten wollen nichts
anderes als neues Abbil«
dungsmaterial bekannt«
geben. Einige haben auch um ihresTextes willen
bleibenden Wert. Erfreulicherweise wächst das
Interesse an der Kunst des 18. Jahrhunderts;
ihr gilt der größere Teil derVeröffentlichungen.
Unter den Schriften über gotische Bildnerkunst
bedeutet das Büchlein von GeorgWeise: Die
gotische Holzplastik um Rottenburg,
Horb und Hechingen, Tübingen, Alexander
Fischer, 1921, Preis 40 Mark, eine gründliche
Inventarisation eines bisher vernachlässigten eng
begrenzten Gebietes. Vielleicht ist der Aufwand
des Büchleins, in anbetracht der Mittelmäßig«
keit der meisten Stücke, etwas zu groß; immer«
hin sind einige, wie die Muttergottesbilder von
Horb und Bisingen, wert, Allgemeingut der
deutschen Kunstwissenschaft zu werden. Man
hat beim Lesen dieses Buches die Gewißheit,
daß das Material nicht nur mit größtem Fleiße
zusammengetragen, sondern auch auf das ge«
naueste analysiert ist; die Datierungen sind un«
bedingt zuverlässig.
Weit umfassender ist das
Thema, das die Arbeit von
Karl Gröber, Schwä«
bische Skulptur der
Spätgotik, München,
Riehn und Reusch, 1922,
sich stellt. Das Buch ist der
zweite Band einer von Feul«
ner herausgegebenen Fol«
ge: Sammelbände zur Ge«
schichte der Kunst. Es ist
in diesen Bänden haupt«
sächlich auf die Veröffent«
lichung von Abbildungen
abgesehen. Indes ist erfreu«
licherweise auch der Text«
teil der beiden bisher er«
schienenen Bände gewis«
senhaft und zuverlässig. In
der achtseitigen Einleitung
gibt Gröber, ein gebürtiger
Schwabe, eine knappe, gut
orientierende Übersicht
über die einzelnen Schulen
Schwabens. Der über die
108 abgebildeten Stücke
Aufschluß gebende Kata-
log ist nicht ganz frei von
Flüchtigkeiten. So heißt es
von dem Denkmal des
Stephan von Gundelfingen in Neufra, in zwei
fast unmittelbar aufeinander folgenden Sätzen:
»Fassung des späten 15. Jahrhunderts . . . Die
Jahreszahl 1528 bezieht sich nicht auf den Tod
des Dargestellten, sondern auf die Entstehungs«
zeit des Denkmales.« Im übrigen ist die Aus«
wähl der Abbildungen vorzüglich; sie geben
einen lehrreichen Überblick über die Verschie«
denartigkeit der Schulen und Meister.
Nicht auf die Kunst eines beschränkten Gebie«
tes beschränkt sich die Veröffentlichung von
Otto Schmitt und Georg Swarzenski
»Meisterwerke der mittelalterlichen
MODEPLASTIK RUDOLF BELLING
59
worden ist und in diesem Falle besonders vom
Geist der Gegenreformation gegeben wird, und
daß gerade im Barock das oft am wichtigsten
erscheint, was Weisbach hier klug und vielbe«
lesen zusammengetragen hat, so wird man mit
der kulturhistorischen Methode wieder ausge«
söhnt. Nur soll sie sich
stets bewußt bleiben, so«
zusagen nur eine Hilfs«
Wissenschaft zur Kunstge«
schichte zu sein. Denn was
dem Barock allenfalls recht
ist (man kann ihn auch
»barocker« behandeln, wie
Hausenstein gezeigt hat),
würde bei anderenEpochen
von dem Sinne der Kunst
abziehen. — Gediegen und
nobel im Sinneguter Kunst«
bücher, die die Abbildun«
gen in den Text verweben
(Muster etwa Wölfflins
»Klassische Kunst«) ist die
Ausstattung des Cassirer«
sehen Verlags.
Paul F. Schmidt
NEUE SCHRIFTEN
ÜBER DEUTSCHE
PLASTIK. Das Ende des
J ahres 1921 hat denBücher«
markt mit einer Flut von
Schriften über deutschePla«
stik überschüttet. Die mei«
sten Arbeiten wollen nichts
anderes als neues Abbil«
dungsmaterial bekannt«
geben. Einige haben auch um ihresTextes willen
bleibenden Wert. Erfreulicherweise wächst das
Interesse an der Kunst des 18. Jahrhunderts;
ihr gilt der größere Teil derVeröffentlichungen.
Unter den Schriften über gotische Bildnerkunst
bedeutet das Büchlein von GeorgWeise: Die
gotische Holzplastik um Rottenburg,
Horb und Hechingen, Tübingen, Alexander
Fischer, 1921, Preis 40 Mark, eine gründliche
Inventarisation eines bisher vernachlässigten eng
begrenzten Gebietes. Vielleicht ist der Aufwand
des Büchleins, in anbetracht der Mittelmäßig«
keit der meisten Stücke, etwas zu groß; immer«
hin sind einige, wie die Muttergottesbilder von
Horb und Bisingen, wert, Allgemeingut der
deutschen Kunstwissenschaft zu werden. Man
hat beim Lesen dieses Buches die Gewißheit,
daß das Material nicht nur mit größtem Fleiße
zusammengetragen, sondern auch auf das ge«
naueste analysiert ist; die Datierungen sind un«
bedingt zuverlässig.
Weit umfassender ist das
Thema, das die Arbeit von
Karl Gröber, Schwä«
bische Skulptur der
Spätgotik, München,
Riehn und Reusch, 1922,
sich stellt. Das Buch ist der
zweite Band einer von Feul«
ner herausgegebenen Fol«
ge: Sammelbände zur Ge«
schichte der Kunst. Es ist
in diesen Bänden haupt«
sächlich auf die Veröffent«
lichung von Abbildungen
abgesehen. Indes ist erfreu«
licherweise auch der Text«
teil der beiden bisher er«
schienenen Bände gewis«
senhaft und zuverlässig. In
der achtseitigen Einleitung
gibt Gröber, ein gebürtiger
Schwabe, eine knappe, gut
orientierende Übersicht
über die einzelnen Schulen
Schwabens. Der über die
108 abgebildeten Stücke
Aufschluß gebende Kata-
log ist nicht ganz frei von
Flüchtigkeiten. So heißt es
von dem Denkmal des
Stephan von Gundelfingen in Neufra, in zwei
fast unmittelbar aufeinander folgenden Sätzen:
»Fassung des späten 15. Jahrhunderts . . . Die
Jahreszahl 1528 bezieht sich nicht auf den Tod
des Dargestellten, sondern auf die Entstehungs«
zeit des Denkmales.« Im übrigen ist die Aus«
wähl der Abbildungen vorzüglich; sie geben
einen lehrreichen Überblick über die Verschie«
denartigkeit der Schulen und Meister.
Nicht auf die Kunst eines beschränkten Gebie«
tes beschränkt sich die Veröffentlichung von
Otto Schmitt und Georg Swarzenski
»Meisterwerke der mittelalterlichen
MODEPLASTIK RUDOLF BELLING
59