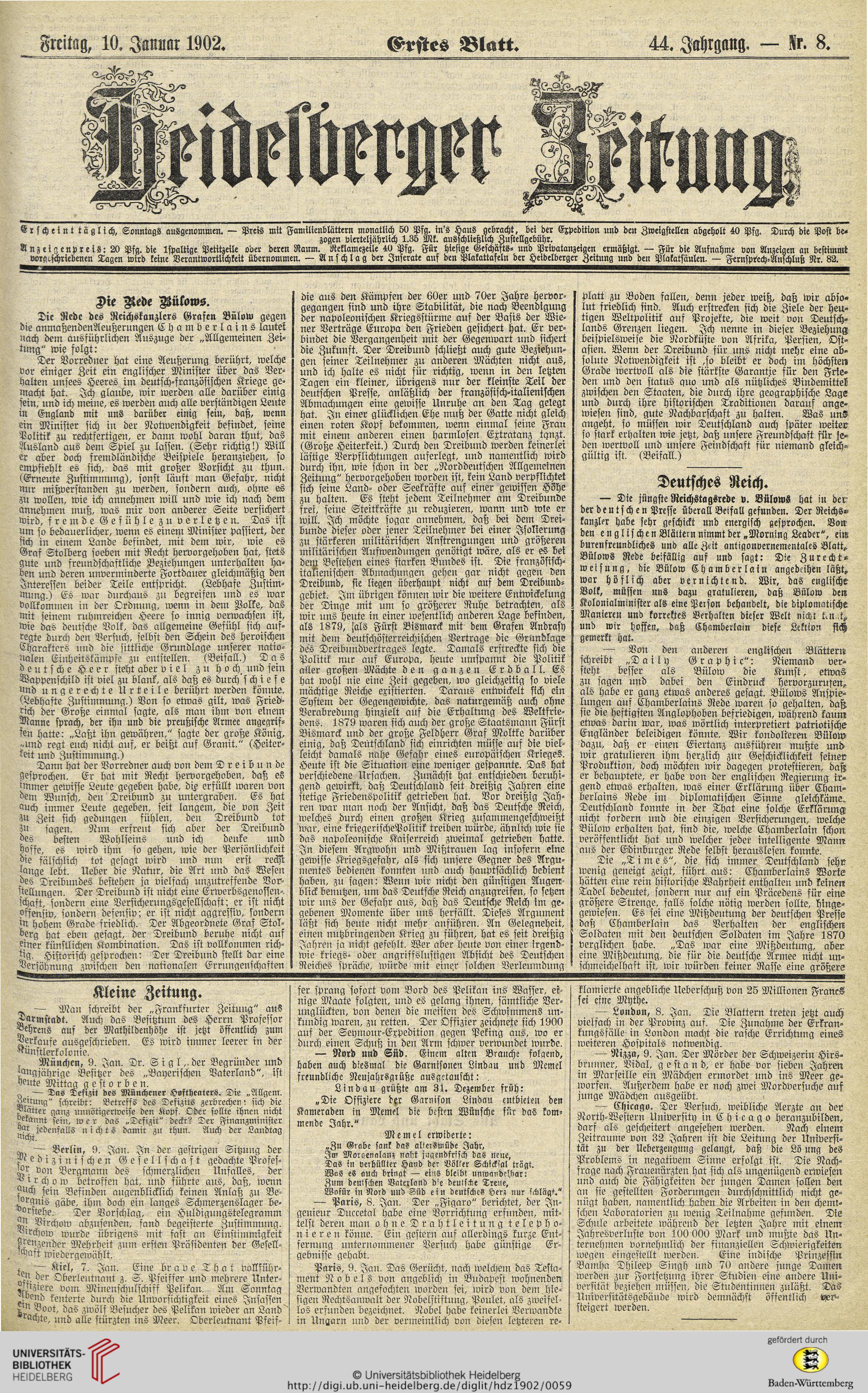Zrcitag, 10. Jammi 1902.
Grstes Blatt.
44. Jahrgallg. — Hr. 8.
Erschcint täglich, Sonntags ausgenommen. — Preis mit Familienblättern monatlich 50 Pfg. in's Haus aebracht, bei der Expedition und den Zweigstellen abgeholt 40 Pfg. Durch die Post be-
zogen vierteljährlich 1.35 Mk. ausschließlich Zustellgebühr.
Anzeigcnpreis: 20 Pfg. die Ispaltige Petitzeile ooer deren Raum. Reklamezeile 40 Pfg. Für hiesige Geschäfts- und Privatanzeigen ermäßigt. — Für die Aufnahme von Anzeigen an bestimmt
vorgeschriebenen Tagen wird keine Verantwortlichkeit übernommen. — Anschlag der Jnserate auf den Plakattafeln der Heidelberger Zcitung und den Plakatsäulen- — Fernsprech-Anschluß Nr. 82.
Aie Wede ZSütows.
Die Rcdc des Rcichskanzlcrs Grafen Bülow gegen
die cmmaßendenAeußerungen Chamberlains lautei
nach dem ausführlichen Auszuge der „Allgemeinen Zei-
tung" wie folgt:
Der Vorredner hat eine Aeußerung berührt, welche
vor einiger Zeit ein englischer Minister über das Ver-
halten unsees Heeres im deutsch-französischen Kriege ge-
rnacht hat. Jch glaube, wir werden alle darüber einig
sein, und ich meine, es werden auch alle verständigen Leute
in England mit uns darüber einig sein, daß, wenn
ein Minister sich in der Notwendigkeit befindet, seine
Politik zu rechtfertigen, er dann wohl daran thut, das
Ausland aus dem Spiel zu lassen. (Sehr richtig!) Will
er aber doch fremdländische Beispiele heranziehen, so
empfiehlt es sich, das mit großer Vorsicht zu thun.
(Erneute Zustimmung), sonst läuft man Gefahr, nicht
nur mißverstanden zu werden, sondern auch, ohne es
zu wollen, wie ich annehmen will und wie ich nach dem
annehmen muß, was mir von anderer Seite versichert
wird, fremde Gefühle zu verletzen. Das ist
um so bedauerlicher, wenn es einenr Minister passiert, der
sich in einem Lande befindet, mit dem wir, wie es
Graf Stolberg soeben mit Recht hervorgehoben hat, stets
gute und freundschaftliche Beziehungen unterhalten ha-
ben und deren unverminderte Fortdauer gleichmäßig den
Jnteressen beider Teile entspricht. (Lebhafe Zusüm-
wung.) Es war durchaus zu begreifen und es war
dollkommen in der Ordnung, wenn in dem Volke, das
Mit seinem ruhmreichen Heere so innig verwachsen ist,
Wie das deutsche Volk, das allgemeine Gefühl sich auf-
regte durch den Versuch, selbst den L>chein des heroischen
CharakterS und die sittliche Grundlage unserer natio-
ualen Cinheitst'ämpsc zu entstellen. (Beifall.) D a s
deutsche Heer stcht aber viel zn hoch und sein
Wappenfchild ist viel zu blank, als daß es durch schiefe
und ungerechte Urteile berührt werden könnte.
(Lebhaste Zustimmung.) Von so etwas gilt, was Fried-
rich der Große einmal sagte, als man ihm von elnem
Raime sprach, der ihn und die preußische Armee angegrif-
fen hatte: „Laßt ihn gewähren," sagte der große König,
"Und regt euch nichi auf, er beitzt auf Granit." (Heiter-
keit und Zustimmung.)
Dann hat der Vorredner auch von dem Dreibunde
gesprochen. Er hat mit Recht hervorgehoben, daß es
iwmer gewisse Leute gegeben habe, dis erfüllt waren von
dem Wunsch, den Dreibund zu untergraben. Es hat
auch immer Leute gegeben, seit langem, die von Zeit
äu Zeit sich gedungen fühlen, den Dreibund tot
Zu sagen. Nun erfreut sich aber der Dreibund
des besten Wohlseins und ich denke und
hoffe, es wird ihm so gehen, wie der Persönlichkeit
die fälschlich tot gesagt wird und nun erst rechr
lange lebt. Ileber die Natur, die Art und das Wesen
des Dreibundes bestehen ja vielfach unzutreffende Vov-
itellungen. Der Dreibund ist nicht eine Erwerbsgenossen-.
l'chaft, sondern eine Versicherungsgesellschast: er ist nicht
offensiv, sondern defensiv; er ist nicht aggressiv, sondern
iu hohem Grade friedlich. Der Abgeordnete Graf Stol-
derg hat eben gesagt, der Dreibund beruhe nicht auf
Aner künstlichen Kombination. Das ist vollkommen rich-
Cg. Hiftorisch gesprochen: Der Dreibund stellt dar eine
Persöhnung zNnschen den nationalen Errungenschaften
Lie aus den Kämpfen der 60er und 70er Jahre hervor-
gegangen sind und ihre Stabilität, die nach Beendigung
der napoleonischen Kriegsstürme auf der Basis der Wie-
ner Verträge Europa den Frieden gesichert hat. Er ver-
biudet die Vergangenheit mit der Gegenwart und stchert
die Zukunft. Der Dreibund schließt auch gute Beziehun-
gen seiner Teilnehmer zu anderen Mächten nicht aus,
und ich halte es nicht für richtig, wenn in den letzten
Tagen ein kleiner, übrigens nur der kleinste Teil der
deutschen Presse, anläßlich der französisch-italienischen
Abmachungen eine gewisse Unruhe an den Tag gelegt
hat. Jn einer glücklichen Ehe muß der Gaüe nicht gleich
einen roten Kopf bekommen, wenn einmal seine Frau
mit einein anderen einen harmlosen Extratanz tgnzt.
(Große Heiterkeit.) Durch den Dreibund werden keinerlei
lästige Verpflichtungen auferlegt, und namentlich wird
durch ihn, wie fchon in der „Norddeutschen Allgemeinen
Zeitung" hervorgehoben worden ist, kein Land verpflichtet
sich feine Land- oder Seekräfte auf einer gewissen Höhe
zu halten. Es steht jedem Teilnehmer am Dreibunde
frei, feine Steitkräfte zu reduzieren, wann und wle er
will. Jch möchte sogar annehmen, daß bei dem Drei-
bunde dieser oder jener Teilnehmer bei einer Jsolierung
zu stärkeren militärischen Anstrengungen und größeren
militärischen Aufwendungen genötigt wäre, als er ^ bei
dem Beftehen eines starken Bundes ist. Die. französisch-
italienischen Abmachungen gehen gar nicht gegen den
Drcibund, sie liegen überhaupt nicht auf dem Dreibund-
gebiet. Jm übrigen können wir die weitere Entwickelung
der Dinge mit um so größerer Ruhe betrachten, als
wir uns heute in einer wesentlich anderen Lage befinden,
als 1879, sals Fürst Bismarck mit dem Grafen Andrasy
mit dem deutschösterreichischen Vertrage die Grundlage
des Dreibundvertrages legte. Damals erstreckte sich die
Politik nur auf Europa, heute umspannt die Politik
aller großen Mächte den ganzen E r d b a l I. Es
hat wohl nie eine Zeit gegeben, wo gleichzeitig so viele
mächtige Reiche existierten. Daraus entwickelt sich ein
System der Gegengewichte, das naturgemäß auch ohne
Verabredung hinzielt auf die Erhalttmg des Weltfrie-
dens. 1879' waren sich auch der große Staatsmann Fürst
Bismarck und der große Feldherr Graf Moltke darüber
einig, daß Deütschland sich einrichten mirsse auf die viel-
leicht damals nahe Gefahr eines europäischen Krieges.
Heute ist dis Situation eine weniger gefpannte. Das hat
verschiedene Ursachen. Zunächst hat entschieden beruhi-
gend gewirkt, daß Deutschland seit dreißig Jahren eine
stetige Friedenspolitik getrieben hat. Vor dreißig Jah-
ren war man noch der Ansicht, daß das Deutsche Reich,
welches durch einen großen Krieg zusammengeschweißt
war, eine kriegerischePolitik treiben würde, ähnlich wie ste
das napoleonische Kaiserreich zweimal getrieben hatte.
Jn diesem Argwohn und Mißtrauen lag insofern eine
gewisse Kriegsgefahr, als sich unsere Gegner des Argu-
mentes bedienen konnten nnd auch hauptsächlich bedient
haben, zu sagen: Wenn wir nicht den günstigen Augerr-
blick benutzen, um das Deutsche Reich anzugreifen, so setzen
wir uns der Gefahr aus, daß das Deutsche Reich im ge-
gebenen Momente über uns herfällt. Dieses Argument
läßt sich heute nicht mehr anführen. An Gelegneheit,
einen nutzbringenden Krieg zu führen, hat es seit dreißig
Iahren ja nicht gefehlt. Wer aber heute von einer irgend-
wio kriegs- oder angriffslusttgen Absicht des Deutschen
Reiches spräche, würde mit einer solchen Verleumdung
platt zu Boden fallen, denn jeder weiß, daß wir abso--
lut friedlich sind. Auch erstrecken sich die Ziele der heu-
tigen Weltpolitik auf Projekte, die weit von Deutsch-
lands Grenzen liegen. Jch nenne in dieser Beziehung
beispielsweise die Nordküste von Afrika, Persien, Ost-
asien. Wenn der Dreibund für uns nicht mehr eine ab-
solute Notwendigkeit ist ,so bleibt er doch im höchsten
Grade wertvoll als die stärkste Garantie für den Frle-
den und den status quo und als nützliches Bindemittek
zwischen den Staaten, die durch ihre geographische Lage
und durch ihre historischen Traditionen darauf ange-
wiesen sind, gute Nachbarschaft zu halten. Was unS
angeht, so müssen wir Deutschland auch später weitee
so stark erhalten wie jetzt, daß unsere Freundschaft für je-
den wertvoll und unfere Feindschaft für niemand gleich»
gültig ist. (Beifall.)
Deutfches Reich.
— Die jüngste Reichstagsrede v. Bülows hat in der
derdeutschen Presse überall Beifall gefunden. Der Reichs--
kanzlcr habe sehr geschickt und energisch gesprochen. Von
den englischen Bläiternnimmtder „Morning Leadcr", eim
burenfreundliches und alle Zeit antigouvernementales Blatst
Bülows Rede beifällig auf und sagt: Die Zurecht-
weisung, die Bülow Chamberlain angedeihen läßt»
wor höflich aber vernichtend. Wir, das englische
Volk, müssen uns dazu gratulieren, daß Bülow den
Kolonialminister als eine Peison behandelt, die diplomatische
Manieren und korrcktes Verhalten dieser Welt nichl ttmE
und wir hoffen, daß Chomberlain diese Leklion stch
gemerkt hat.
— Von deu anderen englischeu Blättern
schreibt „Daily Graphic": Niemand ver-
steht besser als Bülow die Kunst, etwns
zu sagen und dabei den Eindruck hervorzurufen,
als habe er ganz etwas anderes gesagt. Bülows Anspie-
lungen auf Chamberlains Nede waren so gehalten, daß
sie die hestigsten Anglophoben befriedigen, während kaum
etwas darin war, was wörtlich interpretiert patriotische
Engländer beleidigen könnte. Wir kondolieren Bülow
dazu, daß er einen Eiertanz ausführeil mußte unst
wir gratulieren ihm herzlich zur Gefchicklichkeit seinev
Prodnktion, doch möchten wir dagegen protestteren, datz
er behauptete, er habe von der englischen Regierung ir»
gend etwas erhalten, was einer Erklärung über Cham-
berlains Rede im diplomatischen Sinne gleichkäms.
Deutschland konnte in der That eine solche Erklärung-
nicht fordern und die einzigen Versicherungen, welche
Bülow erhalten hat, sind die, welche Chamberlain schorr
veröffentlicht hat und welcher jeder intelligente Marm
aus der Edinburger Rede selbst herauslesen konnte.
Die „Times", die fich immer Deutschland sehv
wenig geneigt zeigt, führt aus: Ehamberlains Worte
hätten eine rein historische Wahrheit enthalten und keinen
Tadel bedeutet, sondern nur anf ein Präcedens für eins
größere Strenge, falls solche nötig werden sollte, hinge-
gewiesen. Es sei eine Mißdentung der deutschen Presse
daß Chamberlain das Verhalten der englischen
Soldaten mit deu deutschen Soldaten im Jahre 1870
verglichen habe. „Das war eine Mißdeutung, aber
eine Mißdeutnng, die für die deutsche Armee nicht un-
schmeichelhaft ist, wir würden keiner Rasse eine größers
Kleine Zeitung.
. — Man schreibt der „Frankfurter Zeitung" auS
Larmsiadt. Auch das Besitztum des Herrn Professor
^chrens auf der Mathildenhöhe ist jetzt öffentlich zum
^erkaufe ausgeschrieben. Es wird immer leerer in der
Künstlerkolonie.
München, 9. Jan. Dr. Sigl,. der Begründer und
wngjährige Besitzer des „Bayerischen Vaterland", ist
heute Mittag aestorben.
— Das Destzit des Münchcner Hoftheaters. Die „Allgcm.
ttchwng" fchreibt: Betreffs des Defizits zerbrechen i sich dic
^uüter ganz unnötigerweise den Kopf. Oder sollte ihncn nicht
^eiannt sein, w e r das „Defizit" deckt? Der Finanzminister
pat jedentalls nichts damit zn thun. Auch der Landtag
aicht.
n, — Bcrlin, 9. Jan. Jn der gestrigen Sitzung der
c edizinischen Gefellschaft gedachte Profes-
von Bergmann des schmerzlichen Unfalles, der
^lrchow betroffen hat, und führte aus, daß, wenn
auch Befinden augenblicklich keinen Anlaß zu Bb-
^vrgnis gäbe, ihm doch ein langes Schmerzenslager be-
^vrstehe. Der Vorschlag, ein Huldigungstelegramm
A Virchow abzusenden, fand begeisterte Zusümmung.
^rchow wurde übrigens nttt fast an Einstinimigkeit
dfenzender Mehrheit zum ersten Präsidenten der Gesell-
'chaft wiedergewählt.
E — Kiel, 7. Jan. Eine br a v e That vollführ-
e>i dex Oberleutnant z. L>. Pfeiffer und mehrere Unter-
»nziere vom Minenschulschiff Pelikan. Am Sonntag
»i^vd kenterte durch die Unvorsichtigkeit eines Jnsassen
^ " Vvot, das zwölf Besucher des Pelikan wieder an Land
^achte, nnd alle stürzten ins Meer. Qberleutnant Pfeif-
fer sprang sosort vom Bord des Pelikan ins Wasser, ei-
nige Maate folgten, und es gelang ihnen, sämtliche Ver-
unglückten, von denen die meisten des Schwimmens un-
kundig waren, zu retten. Der Offizier zeichnete sich 1900
auf der Seymour-Expedition gegen Peking aus, wo er
durch einen Schuß in den Arm schwer verwundet wurde.
— Nord und Süd. Eincm alten Brauche folgend,
habcn auch diesmal die Garnisonen Lind-iu und Memel
freundliche Neujahrsgrüße ausgetauscht: .
Lindau grüßte am 31. Dezember fröh:
„Die Offiziere dxr Garnison Lindan cntbieten den
Kameraden in Memel die bcstcn Wünsche für daS kom-
mende Jahr."
Memel erwiderte:
„Zu Grobe sank das alterswüde Jahr,
Jm Moraenalanz naht jagendfrlsch das neue,
Das in verhüllter Hand der Völker Schickial trägt.
Was es auch bringt — eins bleibt unwandel.bar:
Zum deutschen Vaterland d°e deutschc Treue,
Wofür in Nord uild Süd ein deutschcs Herz nur schlägt."
— Paris, 8. Jau. Der „Figaro" berichtet, der Jn-
genieur Duccetal habe eine Vorrichtung erfundeu, mit-
telst deren man ohne Drahtleitung telepho-
nieren könne. Ein gestern auf allerdings kurze Ent-.
fernnng unternommensr Versuch habe günsttge Er-
gebnisse gehabt.
Paris, 9. Jan. Das Gerücht, nach welchem das Testa-
ment Nobels von angeblich in Budapest wohnenden
Verwandten angefochten worden sei, wird von dem hie-
sigen Rechtsanwalt der Nobelstiftung, Poulet, als zweifel-
los erfunden bezeichnet. Nobel habe keinerlei Verwandte
in ttngarn nnd der vermeintlich von diesen letzteren re°
klamierte angebliche Neberschuß von 23 Millionen FrancZ
sei eine Mythe.
London, 8. Zan. Die Blattern treten jetzt auch
vielfach in der Provinz auf. Die Zunahme der Erkran-
kiingsfälle in London macht die rasche Errichtung eines
weiteren Hospitals notwendig.
— Nizza, 9. Jan. Der Mörder der Schweizerin Hirs-
bruuner, Vidal, gestand, er habe vor sieben Jahrerr
in Marseille ein Mädchen ermordet und ins Meer ge-
worfen. Außerdem habe er noch zwei Mordverfuche auf
junge Mädchen ausgeübt.
— Chicago. Der Versuch, weibliche Aerzte an der
North-Western University in Chicago hcranzubilden,
darf als gescheitert angesehen werden. Nach einem
Zeitraume von 32 Jahren ist die Leitung der Universi-
tät zu der Ueberzeugung gelangt, daß die Lö ung des
Problems in negativem Sinne erfolgt ist. Die Nach-
srage nach Frauenärzten hat sich als ungenügend erwiefen
und anch die Fähigkeiten der jungen Damen sollen den
an sie gestellten Forderungen dnrchschnittlich nicht ge-
nügt haben, namentlich haben die Arbeiten in den cheml-
schen Laboratorien zu wenig Teilnahme gefunden. Die
Schule arbeitete während der letzten Jahre mit einem
Jahresverluste von 100 000 Mark und mußte das Un-
ternehmen vornehmlich der finanziellen Schwierigkeiten
wegen eingestellt werden. Eine indische Prinzesstn
Bamha Dhileep Singh und 70 andere jnnge Damen
werden zur Fortsetzung ihrer Studien eine andere Uni-
versität beziehen müssen, die Stndentinnen zuläßt. Das
Universitätsgebäude wird demnächst öffentlich yew
steigert werden.
Grstes Blatt.
44. Jahrgallg. — Hr. 8.
Erschcint täglich, Sonntags ausgenommen. — Preis mit Familienblättern monatlich 50 Pfg. in's Haus aebracht, bei der Expedition und den Zweigstellen abgeholt 40 Pfg. Durch die Post be-
zogen vierteljährlich 1.35 Mk. ausschließlich Zustellgebühr.
Anzeigcnpreis: 20 Pfg. die Ispaltige Petitzeile ooer deren Raum. Reklamezeile 40 Pfg. Für hiesige Geschäfts- und Privatanzeigen ermäßigt. — Für die Aufnahme von Anzeigen an bestimmt
vorgeschriebenen Tagen wird keine Verantwortlichkeit übernommen. — Anschlag der Jnserate auf den Plakattafeln der Heidelberger Zcitung und den Plakatsäulen- — Fernsprech-Anschluß Nr. 82.
Aie Wede ZSütows.
Die Rcdc des Rcichskanzlcrs Grafen Bülow gegen
die cmmaßendenAeußerungen Chamberlains lautei
nach dem ausführlichen Auszuge der „Allgemeinen Zei-
tung" wie folgt:
Der Vorredner hat eine Aeußerung berührt, welche
vor einiger Zeit ein englischer Minister über das Ver-
halten unsees Heeres im deutsch-französischen Kriege ge-
rnacht hat. Jch glaube, wir werden alle darüber einig
sein, und ich meine, es werden auch alle verständigen Leute
in England mit uns darüber einig sein, daß, wenn
ein Minister sich in der Notwendigkeit befindet, seine
Politik zu rechtfertigen, er dann wohl daran thut, das
Ausland aus dem Spiel zu lassen. (Sehr richtig!) Will
er aber doch fremdländische Beispiele heranziehen, so
empfiehlt es sich, das mit großer Vorsicht zu thun.
(Erneute Zustimmung), sonst läuft man Gefahr, nicht
nur mißverstanden zu werden, sondern auch, ohne es
zu wollen, wie ich annehmen will und wie ich nach dem
annehmen muß, was mir von anderer Seite versichert
wird, fremde Gefühle zu verletzen. Das ist
um so bedauerlicher, wenn es einenr Minister passiert, der
sich in einem Lande befindet, mit dem wir, wie es
Graf Stolberg soeben mit Recht hervorgehoben hat, stets
gute und freundschaftliche Beziehungen unterhalten ha-
ben und deren unverminderte Fortdauer gleichmäßig den
Jnteressen beider Teile entspricht. (Lebhafe Zusüm-
wung.) Es war durchaus zu begreifen und es war
dollkommen in der Ordnung, wenn in dem Volke, das
Mit seinem ruhmreichen Heere so innig verwachsen ist,
Wie das deutsche Volk, das allgemeine Gefühl sich auf-
regte durch den Versuch, selbst den L>chein des heroischen
CharakterS und die sittliche Grundlage unserer natio-
ualen Cinheitst'ämpsc zu entstellen. (Beifall.) D a s
deutsche Heer stcht aber viel zn hoch und sein
Wappenfchild ist viel zu blank, als daß es durch schiefe
und ungerechte Urteile berührt werden könnte.
(Lebhaste Zustimmung.) Von so etwas gilt, was Fried-
rich der Große einmal sagte, als man ihm von elnem
Raime sprach, der ihn und die preußische Armee angegrif-
fen hatte: „Laßt ihn gewähren," sagte der große König,
"Und regt euch nichi auf, er beitzt auf Granit." (Heiter-
keit und Zustimmung.)
Dann hat der Vorredner auch von dem Dreibunde
gesprochen. Er hat mit Recht hervorgehoben, daß es
iwmer gewisse Leute gegeben habe, dis erfüllt waren von
dem Wunsch, den Dreibund zu untergraben. Es hat
auch immer Leute gegeben, seit langem, die von Zeit
äu Zeit sich gedungen fühlen, den Dreibund tot
Zu sagen. Nun erfreut sich aber der Dreibund
des besten Wohlseins und ich denke und
hoffe, es wird ihm so gehen, wie der Persönlichkeit
die fälschlich tot gesagt wird und nun erst rechr
lange lebt. Ileber die Natur, die Art und das Wesen
des Dreibundes bestehen ja vielfach unzutreffende Vov-
itellungen. Der Dreibund ist nicht eine Erwerbsgenossen-.
l'chaft, sondern eine Versicherungsgesellschast: er ist nicht
offensiv, sondern defensiv; er ist nicht aggressiv, sondern
iu hohem Grade friedlich. Der Abgeordnete Graf Stol-
derg hat eben gesagt, der Dreibund beruhe nicht auf
Aner künstlichen Kombination. Das ist vollkommen rich-
Cg. Hiftorisch gesprochen: Der Dreibund stellt dar eine
Persöhnung zNnschen den nationalen Errungenschaften
Lie aus den Kämpfen der 60er und 70er Jahre hervor-
gegangen sind und ihre Stabilität, die nach Beendigung
der napoleonischen Kriegsstürme auf der Basis der Wie-
ner Verträge Europa den Frieden gesichert hat. Er ver-
biudet die Vergangenheit mit der Gegenwart und stchert
die Zukunft. Der Dreibund schließt auch gute Beziehun-
gen seiner Teilnehmer zu anderen Mächten nicht aus,
und ich halte es nicht für richtig, wenn in den letzten
Tagen ein kleiner, übrigens nur der kleinste Teil der
deutschen Presse, anläßlich der französisch-italienischen
Abmachungen eine gewisse Unruhe an den Tag gelegt
hat. Jn einer glücklichen Ehe muß der Gaüe nicht gleich
einen roten Kopf bekommen, wenn einmal seine Frau
mit einein anderen einen harmlosen Extratanz tgnzt.
(Große Heiterkeit.) Durch den Dreibund werden keinerlei
lästige Verpflichtungen auferlegt, und namentlich wird
durch ihn, wie fchon in der „Norddeutschen Allgemeinen
Zeitung" hervorgehoben worden ist, kein Land verpflichtet
sich feine Land- oder Seekräfte auf einer gewissen Höhe
zu halten. Es steht jedem Teilnehmer am Dreibunde
frei, feine Steitkräfte zu reduzieren, wann und wle er
will. Jch möchte sogar annehmen, daß bei dem Drei-
bunde dieser oder jener Teilnehmer bei einer Jsolierung
zu stärkeren militärischen Anstrengungen und größeren
militärischen Aufwendungen genötigt wäre, als er ^ bei
dem Beftehen eines starken Bundes ist. Die. französisch-
italienischen Abmachungen gehen gar nicht gegen den
Drcibund, sie liegen überhaupt nicht auf dem Dreibund-
gebiet. Jm übrigen können wir die weitere Entwickelung
der Dinge mit um so größerer Ruhe betrachten, als
wir uns heute in einer wesentlich anderen Lage befinden,
als 1879, sals Fürst Bismarck mit dem Grafen Andrasy
mit dem deutschösterreichischen Vertrage die Grundlage
des Dreibundvertrages legte. Damals erstreckte sich die
Politik nur auf Europa, heute umspannt die Politik
aller großen Mächte den ganzen E r d b a l I. Es
hat wohl nie eine Zeit gegeben, wo gleichzeitig so viele
mächtige Reiche existierten. Daraus entwickelt sich ein
System der Gegengewichte, das naturgemäß auch ohne
Verabredung hinzielt auf die Erhalttmg des Weltfrie-
dens. 1879' waren sich auch der große Staatsmann Fürst
Bismarck und der große Feldherr Graf Moltke darüber
einig, daß Deütschland sich einrichten mirsse auf die viel-
leicht damals nahe Gefahr eines europäischen Krieges.
Heute ist dis Situation eine weniger gefpannte. Das hat
verschiedene Ursachen. Zunächst hat entschieden beruhi-
gend gewirkt, daß Deutschland seit dreißig Jahren eine
stetige Friedenspolitik getrieben hat. Vor dreißig Jah-
ren war man noch der Ansicht, daß das Deutsche Reich,
welches durch einen großen Krieg zusammengeschweißt
war, eine kriegerischePolitik treiben würde, ähnlich wie ste
das napoleonische Kaiserreich zweimal getrieben hatte.
Jn diesem Argwohn und Mißtrauen lag insofern eine
gewisse Kriegsgefahr, als sich unsere Gegner des Argu-
mentes bedienen konnten nnd auch hauptsächlich bedient
haben, zu sagen: Wenn wir nicht den günstigen Augerr-
blick benutzen, um das Deutsche Reich anzugreifen, so setzen
wir uns der Gefahr aus, daß das Deutsche Reich im ge-
gebenen Momente über uns herfällt. Dieses Argument
läßt sich heute nicht mehr anführen. An Gelegneheit,
einen nutzbringenden Krieg zu führen, hat es seit dreißig
Iahren ja nicht gefehlt. Wer aber heute von einer irgend-
wio kriegs- oder angriffslusttgen Absicht des Deutschen
Reiches spräche, würde mit einer solchen Verleumdung
platt zu Boden fallen, denn jeder weiß, daß wir abso--
lut friedlich sind. Auch erstrecken sich die Ziele der heu-
tigen Weltpolitik auf Projekte, die weit von Deutsch-
lands Grenzen liegen. Jch nenne in dieser Beziehung
beispielsweise die Nordküste von Afrika, Persien, Ost-
asien. Wenn der Dreibund für uns nicht mehr eine ab-
solute Notwendigkeit ist ,so bleibt er doch im höchsten
Grade wertvoll als die stärkste Garantie für den Frle-
den und den status quo und als nützliches Bindemittek
zwischen den Staaten, die durch ihre geographische Lage
und durch ihre historischen Traditionen darauf ange-
wiesen sind, gute Nachbarschaft zu halten. Was unS
angeht, so müssen wir Deutschland auch später weitee
so stark erhalten wie jetzt, daß unsere Freundschaft für je-
den wertvoll und unfere Feindschaft für niemand gleich»
gültig ist. (Beifall.)
Deutfches Reich.
— Die jüngste Reichstagsrede v. Bülows hat in der
derdeutschen Presse überall Beifall gefunden. Der Reichs--
kanzlcr habe sehr geschickt und energisch gesprochen. Von
den englischen Bläiternnimmtder „Morning Leadcr", eim
burenfreundliches und alle Zeit antigouvernementales Blatst
Bülows Rede beifällig auf und sagt: Die Zurecht-
weisung, die Bülow Chamberlain angedeihen läßt»
wor höflich aber vernichtend. Wir, das englische
Volk, müssen uns dazu gratulieren, daß Bülow den
Kolonialminister als eine Peison behandelt, die diplomatische
Manieren und korrcktes Verhalten dieser Welt nichl ttmE
und wir hoffen, daß Chomberlain diese Leklion stch
gemerkt hat.
— Von deu anderen englischeu Blättern
schreibt „Daily Graphic": Niemand ver-
steht besser als Bülow die Kunst, etwns
zu sagen und dabei den Eindruck hervorzurufen,
als habe er ganz etwas anderes gesagt. Bülows Anspie-
lungen auf Chamberlains Nede waren so gehalten, daß
sie die hestigsten Anglophoben befriedigen, während kaum
etwas darin war, was wörtlich interpretiert patriotische
Engländer beleidigen könnte. Wir kondolieren Bülow
dazu, daß er einen Eiertanz ausführeil mußte unst
wir gratulieren ihm herzlich zur Gefchicklichkeit seinev
Prodnktion, doch möchten wir dagegen protestteren, datz
er behauptete, er habe von der englischen Regierung ir»
gend etwas erhalten, was einer Erklärung über Cham-
berlains Rede im diplomatischen Sinne gleichkäms.
Deutschland konnte in der That eine solche Erklärung-
nicht fordern und die einzigen Versicherungen, welche
Bülow erhalten hat, sind die, welche Chamberlain schorr
veröffentlicht hat und welcher jeder intelligente Marm
aus der Edinburger Rede selbst herauslesen konnte.
Die „Times", die fich immer Deutschland sehv
wenig geneigt zeigt, führt aus: Ehamberlains Worte
hätten eine rein historische Wahrheit enthalten und keinen
Tadel bedeutet, sondern nur anf ein Präcedens für eins
größere Strenge, falls solche nötig werden sollte, hinge-
gewiesen. Es sei eine Mißdentung der deutschen Presse
daß Chamberlain das Verhalten der englischen
Soldaten mit deu deutschen Soldaten im Jahre 1870
verglichen habe. „Das war eine Mißdeutung, aber
eine Mißdeutnng, die für die deutsche Armee nicht un-
schmeichelhaft ist, wir würden keiner Rasse eine größers
Kleine Zeitung.
. — Man schreibt der „Frankfurter Zeitung" auS
Larmsiadt. Auch das Besitztum des Herrn Professor
^chrens auf der Mathildenhöhe ist jetzt öffentlich zum
^erkaufe ausgeschrieben. Es wird immer leerer in der
Künstlerkolonie.
München, 9. Jan. Dr. Sigl,. der Begründer und
wngjährige Besitzer des „Bayerischen Vaterland", ist
heute Mittag aestorben.
— Das Destzit des Münchcner Hoftheaters. Die „Allgcm.
ttchwng" fchreibt: Betreffs des Defizits zerbrechen i sich dic
^uüter ganz unnötigerweise den Kopf. Oder sollte ihncn nicht
^eiannt sein, w e r das „Defizit" deckt? Der Finanzminister
pat jedentalls nichts damit zn thun. Auch der Landtag
aicht.
n, — Bcrlin, 9. Jan. Jn der gestrigen Sitzung der
c edizinischen Gefellschaft gedachte Profes-
von Bergmann des schmerzlichen Unfalles, der
^lrchow betroffen hat, und führte aus, daß, wenn
auch Befinden augenblicklich keinen Anlaß zu Bb-
^vrgnis gäbe, ihm doch ein langes Schmerzenslager be-
^vrstehe. Der Vorschlag, ein Huldigungstelegramm
A Virchow abzusenden, fand begeisterte Zusümmung.
^rchow wurde übrigens nttt fast an Einstinimigkeit
dfenzender Mehrheit zum ersten Präsidenten der Gesell-
'chaft wiedergewählt.
E — Kiel, 7. Jan. Eine br a v e That vollführ-
e>i dex Oberleutnant z. L>. Pfeiffer und mehrere Unter-
»nziere vom Minenschulschiff Pelikan. Am Sonntag
»i^vd kenterte durch die Unvorsichtigkeit eines Jnsassen
^ " Vvot, das zwölf Besucher des Pelikan wieder an Land
^achte, nnd alle stürzten ins Meer. Qberleutnant Pfeif-
fer sprang sosort vom Bord des Pelikan ins Wasser, ei-
nige Maate folgten, und es gelang ihnen, sämtliche Ver-
unglückten, von denen die meisten des Schwimmens un-
kundig waren, zu retten. Der Offizier zeichnete sich 1900
auf der Seymour-Expedition gegen Peking aus, wo er
durch einen Schuß in den Arm schwer verwundet wurde.
— Nord und Süd. Eincm alten Brauche folgend,
habcn auch diesmal die Garnisonen Lind-iu und Memel
freundliche Neujahrsgrüße ausgetauscht: .
Lindau grüßte am 31. Dezember fröh:
„Die Offiziere dxr Garnison Lindan cntbieten den
Kameraden in Memel die bcstcn Wünsche für daS kom-
mende Jahr."
Memel erwiderte:
„Zu Grobe sank das alterswüde Jahr,
Jm Moraenalanz naht jagendfrlsch das neue,
Das in verhüllter Hand der Völker Schickial trägt.
Was es auch bringt — eins bleibt unwandel.bar:
Zum deutschen Vaterland d°e deutschc Treue,
Wofür in Nord uild Süd ein deutschcs Herz nur schlägt."
— Paris, 8. Jau. Der „Figaro" berichtet, der Jn-
genieur Duccetal habe eine Vorrichtung erfundeu, mit-
telst deren man ohne Drahtleitung telepho-
nieren könne. Ein gestern auf allerdings kurze Ent-.
fernnng unternommensr Versuch habe günsttge Er-
gebnisse gehabt.
Paris, 9. Jan. Das Gerücht, nach welchem das Testa-
ment Nobels von angeblich in Budapest wohnenden
Verwandten angefochten worden sei, wird von dem hie-
sigen Rechtsanwalt der Nobelstiftung, Poulet, als zweifel-
los erfunden bezeichnet. Nobel habe keinerlei Verwandte
in ttngarn nnd der vermeintlich von diesen letzteren re°
klamierte angebliche Neberschuß von 23 Millionen FrancZ
sei eine Mythe.
London, 8. Zan. Die Blattern treten jetzt auch
vielfach in der Provinz auf. Die Zunahme der Erkran-
kiingsfälle in London macht die rasche Errichtung eines
weiteren Hospitals notwendig.
— Nizza, 9. Jan. Der Mörder der Schweizerin Hirs-
bruuner, Vidal, gestand, er habe vor sieben Jahrerr
in Marseille ein Mädchen ermordet und ins Meer ge-
worfen. Außerdem habe er noch zwei Mordverfuche auf
junge Mädchen ausgeübt.
— Chicago. Der Versuch, weibliche Aerzte an der
North-Western University in Chicago hcranzubilden,
darf als gescheitert angesehen werden. Nach einem
Zeitraume von 32 Jahren ist die Leitung der Universi-
tät zu der Ueberzeugung gelangt, daß die Lö ung des
Problems in negativem Sinne erfolgt ist. Die Nach-
srage nach Frauenärzten hat sich als ungenügend erwiefen
und anch die Fähigkeiten der jungen Damen sollen den
an sie gestellten Forderungen dnrchschnittlich nicht ge-
nügt haben, namentlich haben die Arbeiten in den cheml-
schen Laboratorien zu wenig Teilnahme gefunden. Die
Schule arbeitete während der letzten Jahre mit einem
Jahresverluste von 100 000 Mark und mußte das Un-
ternehmen vornehmlich der finanziellen Schwierigkeiten
wegen eingestellt werden. Eine indische Prinzesstn
Bamha Dhileep Singh und 70 andere jnnge Damen
werden zur Fortsetzung ihrer Studien eine andere Uni-
versität beziehen müssen, die Stndentinnen zuläßt. Das
Universitätsgebäude wird demnächst öffentlich yew
steigert werden.