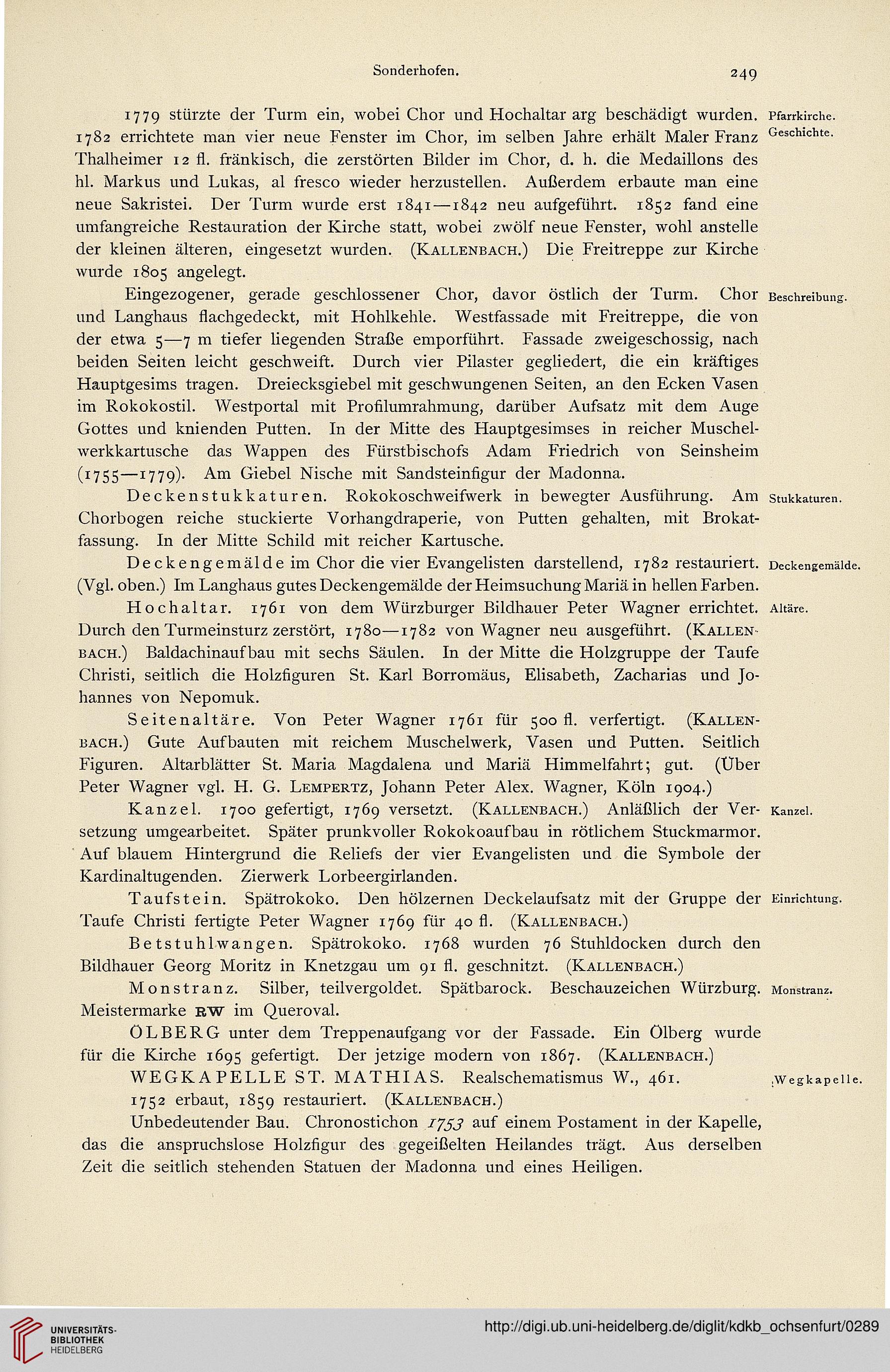Sonderhofen.
249
1779 stürzte der Turm ein, wobei Chor und Hochaltar arg beschädigt wurden.
1782 errichtete man vier neue Fenster im Chor, im selben Jahre erhält Maler Franz
Thalheimer 12 h. fränkisch, die zerstörten Bilder im Chor, d. h. die Medaillons des
hl. Markus und Lukas, al fresco wieder herzustellen. Außerdem erbaute man eine
neue Sakristei. Der Turm wurde erst 1841 —1842 neu aufgeführt. 1852 fand eine
umfangreiche Restauration der Kirche statt, wobei zwölf neue Fenster, wohl anstelle
der kleinen älteren, eingesetzt wurden. (KALLENBACH.) Die Freitreppe zur Kirche
wurde 180g angelegt.
Eingezogener, gerade geschlossener Chor, davor östlich der Turm. Chor
und Langhaus flachgedeckt, mit Hohlkehle. Westfassade mit Freitreppe, die von
der etwa 5—7 m tiefer liegenden Straße emporführt. Fassade zweigeschossig, nach
beiden Seiten leicht geschweift. Durch vier Pilaster gegliedert, die ein kräftiges
Hauptgesims tragen. Dreiecksgiebel mit geschwungenen Seiten, an den Ecken Vasen
im Rokokostil. Westportal mit Profilumrahmung, darüber Aufsatz mit dem Auge
Gottes und knienden Putten. In der Mitte des Hauptgesimses in reicher Muschel-
werkkartusche das Wappen des Fürstbischofs Adam Friedrich von Seinsheim
(175g—1779)- Am Giebel Nische mit Sandsteinfigur der Madonna.
Deckenstukkaturen. Rokokoschweifwerk in bewegter Ausführung. Am
Chorbogen reiche stuckierte Vorhangdraperie, von Putten gehalten, mit Brokat-
fassung. In der Mitte Schild mit reicher Kartusche.
Deckengemälde im Chor die vier Evangelisten darstellend, 1782 restauriert.
(Vgl. oben.) Im Langhaus gutes Deckengemälde der Heimsuchung Mariä in hellen Farben.
Hochaltar. 1761 von dem Würzburger Bildhauer Peter Wagner errichtet.
Durch den Turmeinsturz zerstört, 1780—1782 von Wagner neu ausgeführt. (KALLEN
BACH.) Baldachinaufbau mit sechs Säulen. In der Mitte die Holzgruppe der Taufe
Christi, seitlich die Holzfiguren St. Karl Borromäus, Elisabeth, Zacharias und Jo-
hannes von Nepomuk.
Seitenaltäre. Von Peter Wagner 1761 für goofl. verfertigt. (KALLEN-
BACH.) Gute Aufbauten mit reichem Muschelwerk, Vasen und Putten. Seitlich
Figuren. Altarblätter St. Maria Magdalena und Mariä Himmelfahrt; gut. (Uber
Peter Wagner vgl. H. G. LEMPERTz, Johann Peter Alex. Wagner, Köln 1904.)
Kanzel. 1700 gefertigt, 1769 versetzt. (KALLENBACH.) Anläßlich der Ver-
setzung umgearbeitet. Später prunkvoller Rokokoaufbau in rötlichem Stuckmarmor.
Auf blauem Hintergrund die Reliefs der vier Evangelisten und die Symbole der
Kardinaltugenden. Zierwerk Lorbeergirlanden.
Taufstein. Spätrokoko. Den hölzernen Deckelaufsatz mit der Gruppe der
Taufe Christi fertigte Peter Wagner 1769 für 40 fl. (KALLENBACH.)
Betstuhlwangen. Spätrokoko. 1768 wurden 76 Stuhldocken durch den
Bildhauer Georg Moritz in Knetzgau um 91 fl. geschnitzt. (KALLENBACH.)
Monstranz. Silber, teilvergoldet. Spätbarock. Beschauzeichen Würzburg.
Meistermarke RW im Queroval.
OL BERG unter dem Treppenaufgang vor der Fassade. Ein Olberg wurde
für die Kirche 1695 gefertigt. Der jetzige modern von 1867. (KALLENBACH.)
WEGKAPELLE ST. MATHIAS. Realschematismus W., 461.
1752 erbaut, 1859 restauriert. (KALLENBACH.)
Unbedeutender Bau. Chronostichon ^7757? auf einem Postament in der Kapelle,
das die anspruchslose Holzfigur des gegeißelten Heilandes trägt. Aus derselben
Zeit die seitlich stehenden Statuen der Madonna und eines Heiligen.
249
1779 stürzte der Turm ein, wobei Chor und Hochaltar arg beschädigt wurden.
1782 errichtete man vier neue Fenster im Chor, im selben Jahre erhält Maler Franz
Thalheimer 12 h. fränkisch, die zerstörten Bilder im Chor, d. h. die Medaillons des
hl. Markus und Lukas, al fresco wieder herzustellen. Außerdem erbaute man eine
neue Sakristei. Der Turm wurde erst 1841 —1842 neu aufgeführt. 1852 fand eine
umfangreiche Restauration der Kirche statt, wobei zwölf neue Fenster, wohl anstelle
der kleinen älteren, eingesetzt wurden. (KALLENBACH.) Die Freitreppe zur Kirche
wurde 180g angelegt.
Eingezogener, gerade geschlossener Chor, davor östlich der Turm. Chor
und Langhaus flachgedeckt, mit Hohlkehle. Westfassade mit Freitreppe, die von
der etwa 5—7 m tiefer liegenden Straße emporführt. Fassade zweigeschossig, nach
beiden Seiten leicht geschweift. Durch vier Pilaster gegliedert, die ein kräftiges
Hauptgesims tragen. Dreiecksgiebel mit geschwungenen Seiten, an den Ecken Vasen
im Rokokostil. Westportal mit Profilumrahmung, darüber Aufsatz mit dem Auge
Gottes und knienden Putten. In der Mitte des Hauptgesimses in reicher Muschel-
werkkartusche das Wappen des Fürstbischofs Adam Friedrich von Seinsheim
(175g—1779)- Am Giebel Nische mit Sandsteinfigur der Madonna.
Deckenstukkaturen. Rokokoschweifwerk in bewegter Ausführung. Am
Chorbogen reiche stuckierte Vorhangdraperie, von Putten gehalten, mit Brokat-
fassung. In der Mitte Schild mit reicher Kartusche.
Deckengemälde im Chor die vier Evangelisten darstellend, 1782 restauriert.
(Vgl. oben.) Im Langhaus gutes Deckengemälde der Heimsuchung Mariä in hellen Farben.
Hochaltar. 1761 von dem Würzburger Bildhauer Peter Wagner errichtet.
Durch den Turmeinsturz zerstört, 1780—1782 von Wagner neu ausgeführt. (KALLEN
BACH.) Baldachinaufbau mit sechs Säulen. In der Mitte die Holzgruppe der Taufe
Christi, seitlich die Holzfiguren St. Karl Borromäus, Elisabeth, Zacharias und Jo-
hannes von Nepomuk.
Seitenaltäre. Von Peter Wagner 1761 für goofl. verfertigt. (KALLEN-
BACH.) Gute Aufbauten mit reichem Muschelwerk, Vasen und Putten. Seitlich
Figuren. Altarblätter St. Maria Magdalena und Mariä Himmelfahrt; gut. (Uber
Peter Wagner vgl. H. G. LEMPERTz, Johann Peter Alex. Wagner, Köln 1904.)
Kanzel. 1700 gefertigt, 1769 versetzt. (KALLENBACH.) Anläßlich der Ver-
setzung umgearbeitet. Später prunkvoller Rokokoaufbau in rötlichem Stuckmarmor.
Auf blauem Hintergrund die Reliefs der vier Evangelisten und die Symbole der
Kardinaltugenden. Zierwerk Lorbeergirlanden.
Taufstein. Spätrokoko. Den hölzernen Deckelaufsatz mit der Gruppe der
Taufe Christi fertigte Peter Wagner 1769 für 40 fl. (KALLENBACH.)
Betstuhlwangen. Spätrokoko. 1768 wurden 76 Stuhldocken durch den
Bildhauer Georg Moritz in Knetzgau um 91 fl. geschnitzt. (KALLENBACH.)
Monstranz. Silber, teilvergoldet. Spätbarock. Beschauzeichen Würzburg.
Meistermarke RW im Queroval.
OL BERG unter dem Treppenaufgang vor der Fassade. Ein Olberg wurde
für die Kirche 1695 gefertigt. Der jetzige modern von 1867. (KALLENBACH.)
WEGKAPELLE ST. MATHIAS. Realschematismus W., 461.
1752 erbaut, 1859 restauriert. (KALLENBACH.)
Unbedeutender Bau. Chronostichon ^7757? auf einem Postament in der Kapelle,
das die anspruchslose Holzfigur des gegeißelten Heilandes trägt. Aus derselben
Zeit die seitlich stehenden Statuen der Madonna und eines Heiligen.