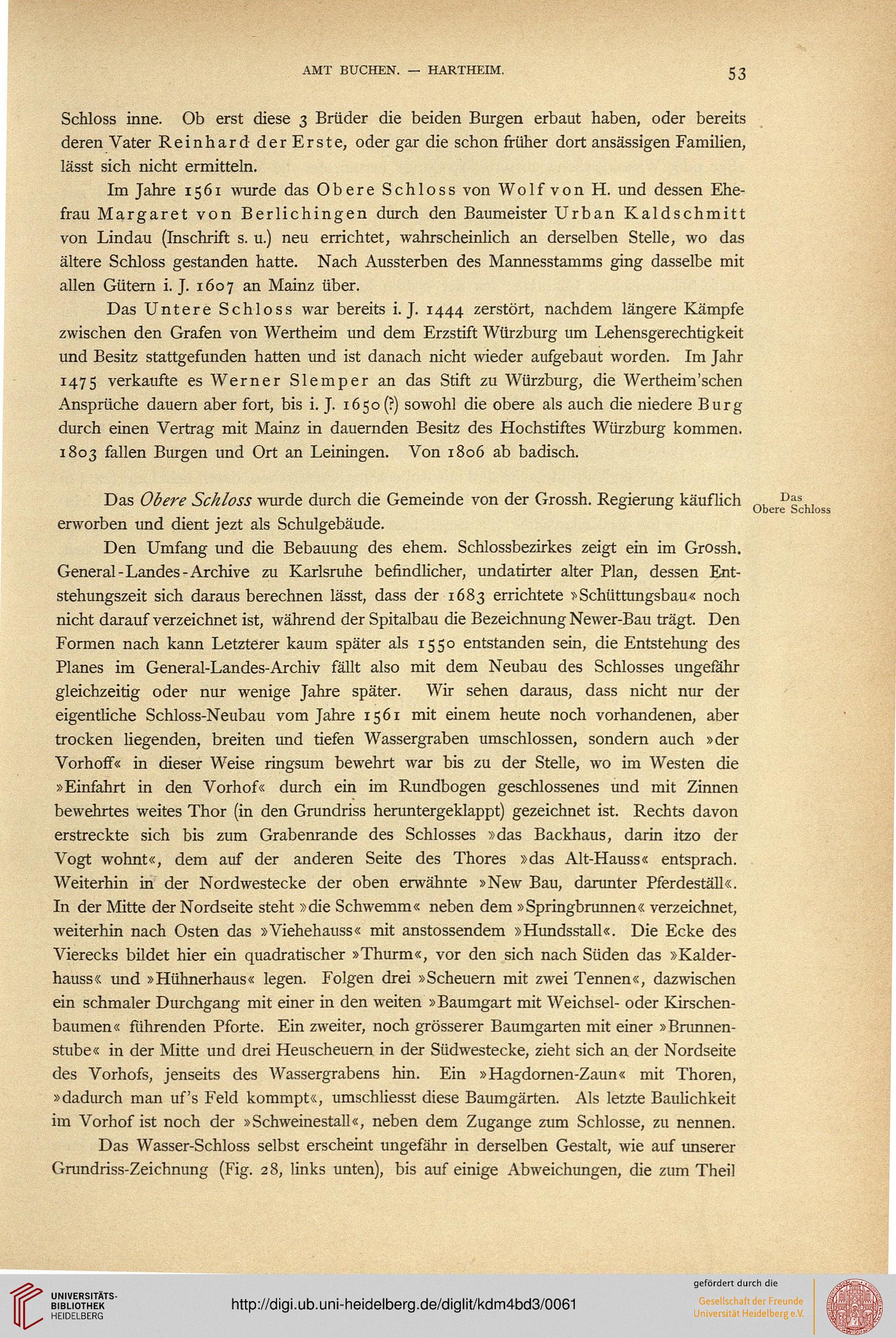AMT BUCHEN. — HARTHEIM. 53
Schloss inne. Ob erst diese 3 Brüder die beiden Burgen erbaut haben, oder bereits
deren Vater Reinhard der Erste, oder gar die schon früher dort ansässigen Familien,
lässt sich nicht ermitteln.
Im Jahre 1561 wurde das Obere Schloss von Wolf von H. und dessen Ehe-
frau Margaret von Berlichingen durch den Baumeister Urban Kaldschmitt
von Lindau (Inschrift s. u.) neu errichtet, wahrscheinlich an derselben Stelle, wo das
ältere Schloss gestanden hatte. Nach Aussterben des Mannesstamms ging dasselbe mit
allen Gütern i. J. 1607 an Mainz über.
Das Untere Schloss war bereits i. J. 1444 zerstört, nachdem längere Kämpfe
zwischen den Grafen von Wertheim und dem Erzstift Würzburg um Lehensgerechtigkeit
und Besitz stattgefunden hatten und ist danach nicht wieder aufgebaut worden. Im Jahr
1475 verkaufte es Werner Slemper an das Stift zu Würzburg, die Wertheim'sehen
Ansprüche dauern aber fort, bis i. J. 1650 (?) sowohl die obere als auch die niedere Burg
durch einen Vertrag mit Mainz in dauernden Besitz des Hochstiftes Würzburg kommen.
1803 fallen Burgen und Ort an Leiningen. Von 1806 ab badisch.
Das Obere Schloss wurde durch die Gemeinde von der Grossh. Regierung käuflich _. Df?..
0 ° Obere Schloss
erworben und dient jezt als Schulgebäude.
Den Umfang und die Bebauung des ehem. Schlossbezirkes zeigt ein im Grossh.
General-Landes-Archive zu Karlsruhe befindlicher, undatirter alter Plan, dessen Ent-
stehungszeit sich daraus berechnen lässt, dass der 1683 errichtete »Schüttungsbau« noch
nicht darauf verzeichnet ist, während der Spitalbau die Bezeichnung Newer-Bau trägt. Den
Formen nach kann Letzterer kaum später als 1550 entstanden sein, die Entstehung des
Planes im General-Landes-Archiv fällt also mit dem Neubau des Schlosses ungefähr
gleichzeitig oder nur wenige Jahre später. Wir sehen daraus, dass nicht nur der
eigentliche Schloss-Neubau vom Jahre 1561 mit einem heute noch vorhandenen, aber
trocken liegenden, breiten und tiefen Wassergraben umschlossen, sondern auch »der
Vorhoff« in dieser Weise ringsum bewehrt war bis zu der Stelle, wo im Westen die
»Einfahrt in den Vorhof« durch ein im Rundbogen geschlossenes und mit Zinnen
bewehrtes weites Thor (in den Grundriss heruntergeklappt) gezeichnet ist. Rechts davon
erstreckte sich bis zum Grabenrande des Schlosses »das Backhaus, darin itzo der
Vogt wohnt«, dem auf der anderen Seite des Thores »das Alt-Hauss« entsprach.
Weiterhin in der Nordwestecke der oben erwähnte »New Bau, darunter Pferdestall«.
In der Mitte der Nordseite steht »die Schwemm« neben dem »Springbrunnen« verzeichnet,
weiterhin nach Osten das »Viehehauss« mit anstossendem »Hundsstall«. Die Ecke des
Vierecks bildet hier ein quadratischer »Thurm«, vor den sich nach Süden das »Kalder-
hauss« und »Hühnerhaus« legen. Folgen drei »Scheuern mit zwei Tennen«, dazwischen
ein schmaler Durchgang mit einer in den weiten »Baumgart mit Weichsel- oder Kirschen-
baumen« fuhrenden Pforte. Ein zweiter, noch grösserer Baumgarten mit einer »Brunnen-
stube« in der Mitte und drei Heuscheuern in der Südwestecke, zieht sich an der Nordseite
des Vorhofs, jenseits des Wassergrabens hin. Ein »Hagdornen-Zaun« mit Thoren,
»dadurch man uf's Feld kommpt«, umschliesst diese Baumgärten. Als letzte Baulichkeit
im Vorhof ist noch der »Schweinestall«, neben dem Zugange zum Schlosse, zu nennen.
Das Wasser-Schloss selbst erscheint ungefähr in derselben Gestalt, wie auf unserer
Grundriss-Zeichnung (Fig. 28, links unten), bis auf einige Abweichungen, die zum Theil
Schloss inne. Ob erst diese 3 Brüder die beiden Burgen erbaut haben, oder bereits
deren Vater Reinhard der Erste, oder gar die schon früher dort ansässigen Familien,
lässt sich nicht ermitteln.
Im Jahre 1561 wurde das Obere Schloss von Wolf von H. und dessen Ehe-
frau Margaret von Berlichingen durch den Baumeister Urban Kaldschmitt
von Lindau (Inschrift s. u.) neu errichtet, wahrscheinlich an derselben Stelle, wo das
ältere Schloss gestanden hatte. Nach Aussterben des Mannesstamms ging dasselbe mit
allen Gütern i. J. 1607 an Mainz über.
Das Untere Schloss war bereits i. J. 1444 zerstört, nachdem längere Kämpfe
zwischen den Grafen von Wertheim und dem Erzstift Würzburg um Lehensgerechtigkeit
und Besitz stattgefunden hatten und ist danach nicht wieder aufgebaut worden. Im Jahr
1475 verkaufte es Werner Slemper an das Stift zu Würzburg, die Wertheim'sehen
Ansprüche dauern aber fort, bis i. J. 1650 (?) sowohl die obere als auch die niedere Burg
durch einen Vertrag mit Mainz in dauernden Besitz des Hochstiftes Würzburg kommen.
1803 fallen Burgen und Ort an Leiningen. Von 1806 ab badisch.
Das Obere Schloss wurde durch die Gemeinde von der Grossh. Regierung käuflich _. Df?..
0 ° Obere Schloss
erworben und dient jezt als Schulgebäude.
Den Umfang und die Bebauung des ehem. Schlossbezirkes zeigt ein im Grossh.
General-Landes-Archive zu Karlsruhe befindlicher, undatirter alter Plan, dessen Ent-
stehungszeit sich daraus berechnen lässt, dass der 1683 errichtete »Schüttungsbau« noch
nicht darauf verzeichnet ist, während der Spitalbau die Bezeichnung Newer-Bau trägt. Den
Formen nach kann Letzterer kaum später als 1550 entstanden sein, die Entstehung des
Planes im General-Landes-Archiv fällt also mit dem Neubau des Schlosses ungefähr
gleichzeitig oder nur wenige Jahre später. Wir sehen daraus, dass nicht nur der
eigentliche Schloss-Neubau vom Jahre 1561 mit einem heute noch vorhandenen, aber
trocken liegenden, breiten und tiefen Wassergraben umschlossen, sondern auch »der
Vorhoff« in dieser Weise ringsum bewehrt war bis zu der Stelle, wo im Westen die
»Einfahrt in den Vorhof« durch ein im Rundbogen geschlossenes und mit Zinnen
bewehrtes weites Thor (in den Grundriss heruntergeklappt) gezeichnet ist. Rechts davon
erstreckte sich bis zum Grabenrande des Schlosses »das Backhaus, darin itzo der
Vogt wohnt«, dem auf der anderen Seite des Thores »das Alt-Hauss« entsprach.
Weiterhin in der Nordwestecke der oben erwähnte »New Bau, darunter Pferdestall«.
In der Mitte der Nordseite steht »die Schwemm« neben dem »Springbrunnen« verzeichnet,
weiterhin nach Osten das »Viehehauss« mit anstossendem »Hundsstall«. Die Ecke des
Vierecks bildet hier ein quadratischer »Thurm«, vor den sich nach Süden das »Kalder-
hauss« und »Hühnerhaus« legen. Folgen drei »Scheuern mit zwei Tennen«, dazwischen
ein schmaler Durchgang mit einer in den weiten »Baumgart mit Weichsel- oder Kirschen-
baumen« fuhrenden Pforte. Ein zweiter, noch grösserer Baumgarten mit einer »Brunnen-
stube« in der Mitte und drei Heuscheuern in der Südwestecke, zieht sich an der Nordseite
des Vorhofs, jenseits des Wassergrabens hin. Ein »Hagdornen-Zaun« mit Thoren,
»dadurch man uf's Feld kommpt«, umschliesst diese Baumgärten. Als letzte Baulichkeit
im Vorhof ist noch der »Schweinestall«, neben dem Zugange zum Schlosse, zu nennen.
Das Wasser-Schloss selbst erscheint ungefähr in derselben Gestalt, wie auf unserer
Grundriss-Zeichnung (Fig. 28, links unten), bis auf einige Abweichungen, die zum Theil