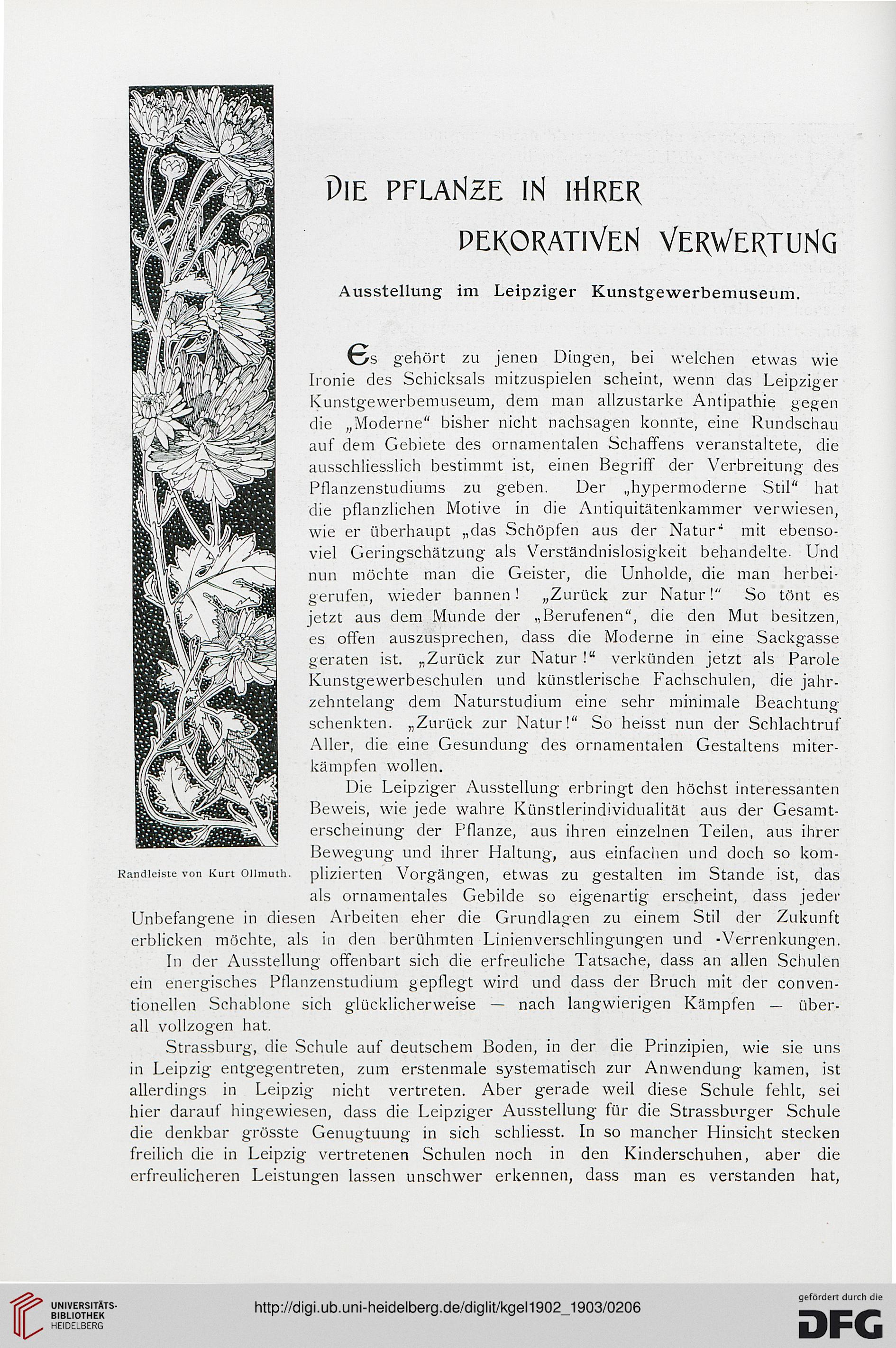H
i %7\
ple pflanze in iürer
pejorativen Verwertung
Ausstellung im Leipziger Kunstgewerbemuseum.
6s gehört zu jenen Dingen, bei welchen etwas wie
Ironie des Schicksals mitzuspielen scheint, wenn das Leipziger
Kunstgewerbemuseum, dem man allzustarke Antipathie gegen
die „Moderne" bisher nicht nachsagen konnte, eine Rundschau
auf dem Gebiete des ornamentalen Schaffens veranstaltete, die
ausschliesslich bestimmt ist, einen Begriff der Verbreitung des
Pflanzenstudiums zu geben. Der „hypermoderne Stil" hat
die pflanzlichen Motive in die Antiquitätenkammer verwiesen,
wie er überhaupt „das Schöpfen aus der Natur" mit ebenso-
viel Geringschätzung als Verständnislosigkeit behandelte. Und
nun möchte man die Geister, die Unholde, die man herbei-
gerufen, wieder bannen! „Zurück zur Natur!" So tönt es
jetzt aus dem Munde der „Berufenen", die den Mut besitzen,
es offen auszusprechen, dass die Moderne in eine Sackgasse
geraten ist. „Zurück zur Natur !" verkünden jetzt als Parole
Kunstgewerbeschulen und künstlerische Fachschulen, die jahr-
zehntelang dem Naturstudium eine sehr minimale Beachtung
schenkten. „Zurück zur Natur!" So heisst nun der Schlachtruf
Aller, die eine Gesundung des ornamentalen Gestaltens miter-
kämpfen wollen.
Die Leipziger Ausstellung erbringt den höchst interessanten
Beweis, wie jede wahre Künstlerindividualität aus der Gesamt-
erscheinung der Pflanze, aus ihren einzelnen Teilen, aus ihrer
Bewegung und ihrer Haltung, aus einfachen und doch so kom-
Randieiste von Kurt Ollmuth, plizierten Vorgängen, etwas zu gestalten im Stande ist, das
als ornamentales Gebilde so eigenartig erscheint, dass jeder
Unbefangene in diesen Arbeiten eher die Grundlagen zu einem Stil der Zukunft
erblicken möchte, als in den berühmten Linienverschlingungen und -Verrenkungen.
In der Ausstellung offenbart sich die erfreuliche Tatsache, dass an allen Schulen
ein energisches Pflanzenstudium gepflegt wird und dass der Bruch mit der conven-
tioneilen Schablone sich glücklicherweise — nach langwierigen Kämpfen — über-
all vollzogen hat.
Strassburg, die Schule auf deutschem Boden, in der die Prinzipien, wie sie uns
in Leipzig entgegentreten, zum erstenmale systematisch zur Anwendung kamen, ist
allerdings in Leipzig nicht vertreten. Aber gerade weil diese Schule fehlt, sei
hier darauf hingewiesen, dass die Leipziger Ausstellung für die Strassburger Schule
die denkbar grösste Genugtuung in sich schliesst. In so mancher Hinsicht stecken
freilich die in Leipzig vertretenen Schulen noch in den Kinderschuhen, aber die
erfreulicheren Leistungen lassen unschwer erkennen, dass man es verstanden hat,
2^
i %7\
ple pflanze in iürer
pejorativen Verwertung
Ausstellung im Leipziger Kunstgewerbemuseum.
6s gehört zu jenen Dingen, bei welchen etwas wie
Ironie des Schicksals mitzuspielen scheint, wenn das Leipziger
Kunstgewerbemuseum, dem man allzustarke Antipathie gegen
die „Moderne" bisher nicht nachsagen konnte, eine Rundschau
auf dem Gebiete des ornamentalen Schaffens veranstaltete, die
ausschliesslich bestimmt ist, einen Begriff der Verbreitung des
Pflanzenstudiums zu geben. Der „hypermoderne Stil" hat
die pflanzlichen Motive in die Antiquitätenkammer verwiesen,
wie er überhaupt „das Schöpfen aus der Natur" mit ebenso-
viel Geringschätzung als Verständnislosigkeit behandelte. Und
nun möchte man die Geister, die Unholde, die man herbei-
gerufen, wieder bannen! „Zurück zur Natur!" So tönt es
jetzt aus dem Munde der „Berufenen", die den Mut besitzen,
es offen auszusprechen, dass die Moderne in eine Sackgasse
geraten ist. „Zurück zur Natur !" verkünden jetzt als Parole
Kunstgewerbeschulen und künstlerische Fachschulen, die jahr-
zehntelang dem Naturstudium eine sehr minimale Beachtung
schenkten. „Zurück zur Natur!" So heisst nun der Schlachtruf
Aller, die eine Gesundung des ornamentalen Gestaltens miter-
kämpfen wollen.
Die Leipziger Ausstellung erbringt den höchst interessanten
Beweis, wie jede wahre Künstlerindividualität aus der Gesamt-
erscheinung der Pflanze, aus ihren einzelnen Teilen, aus ihrer
Bewegung und ihrer Haltung, aus einfachen und doch so kom-
Randieiste von Kurt Ollmuth, plizierten Vorgängen, etwas zu gestalten im Stande ist, das
als ornamentales Gebilde so eigenartig erscheint, dass jeder
Unbefangene in diesen Arbeiten eher die Grundlagen zu einem Stil der Zukunft
erblicken möchte, als in den berühmten Linienverschlingungen und -Verrenkungen.
In der Ausstellung offenbart sich die erfreuliche Tatsache, dass an allen Schulen
ein energisches Pflanzenstudium gepflegt wird und dass der Bruch mit der conven-
tioneilen Schablone sich glücklicherweise — nach langwierigen Kämpfen — über-
all vollzogen hat.
Strassburg, die Schule auf deutschem Boden, in der die Prinzipien, wie sie uns
in Leipzig entgegentreten, zum erstenmale systematisch zur Anwendung kamen, ist
allerdings in Leipzig nicht vertreten. Aber gerade weil diese Schule fehlt, sei
hier darauf hingewiesen, dass die Leipziger Ausstellung für die Strassburger Schule
die denkbar grösste Genugtuung in sich schliesst. In so mancher Hinsicht stecken
freilich die in Leipzig vertretenen Schulen noch in den Kinderschuhen, aber die
erfreulicheren Leistungen lassen unschwer erkennen, dass man es verstanden hat,
2^