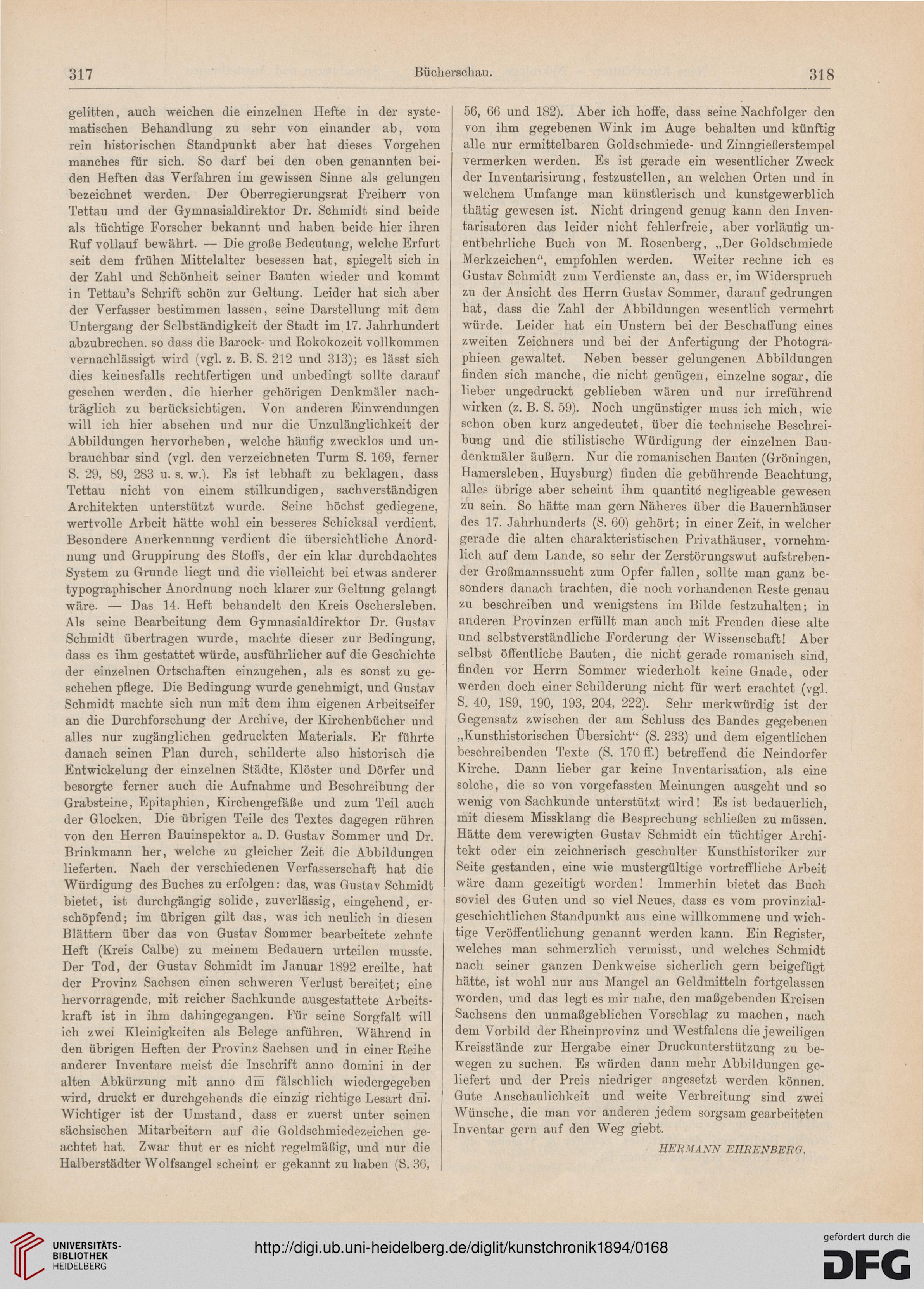317
Bückerschau.
318
gelitten, auch weichen die einzelnen Hefte in der syste-
matischen Behandlung zu sehr von einander ah, vom
rein historischen Standpunkt aber hat dieses Vorgehen
manches für sich. So darf bei den oben genannten bei-
den Heften das Verfahren im gewissen Sinne als gelungen
bezeichnet werden. Der Oberregierungsrat Freiherr von
Tettau und der Gymnasialdirektor Dr. Schmidt sind beide
als tüchtige Forscher bekannt und haben beide hier ihren
Ruf vollauf bewährt. — Die große Bedeutung, welche Erfurt
seit dem frühen Mittelalter besessen hat, spiegelt sich in
der Zahl und Schönheit seiner Bauten wieder und kommt
in Tettau's Schrift schön zur Geltung. Leider hat sich aber
der Verfasser bestimmen lassen, seine Darstellung mit dem
Untergang der Selbständigkeit der Stadt im 17. Jahrhundert
abzubrechen, so dass die Barock- und Rokokozeit vollkommen
vernachlässigt wird (vgl. z. B. S. 212 und 313); es lässt sich
dies keinesfalls rechtfertigen und unbedingt sollte darauf
gesehen werden, die hierher gehörigen Denkmäler nach-
träglich zu berücksichtigen. Von anderen Einwendungen
will ich hier absehen und nur die Unzulänglichkeit der
Abbildungen hervorheben, welche häufig zwecklos und un-
brauchbar sind (vgl. den verzeichneten Turm S. 109, ferner
S. 29, 89, 283 u. s. w.). Es ist lebhaft zu beklagen, dass
Tettau nicht von einem stilkundigen, sachverständigen
Architekten unterstützt wurde. Seine höchst gediegene,
wertvolle Arbeit hätte wohl ein besseres Schicksal verdient.
Besondere Anerkennung verdient die übersichtliche Anord-
nung und Gruppirung des Stoffs, der ein klar durchdachtes
System zu Grunde liegt und die vielleicht bei etwas anderer
typographischer Anordnung noch klarer zur Geltung gelangt
wäre. — Das 14. Heft behandelt den Kreis Oschersleben.
Als seine Bearbeitung dem Gymnasialdirektor Dr. Gustav
Schmidt übertragen wurde, machte dieser zur Bedingung,
dass es ihm gestattet würde, ausführlicher auf die Geschichte
der einzelnen Ortschaften einzugehen, als es sonst zu ge-
schehen pflege. Die Bedingung wurde genehmigt, und Gustav
Schmidt machte sich nun mit dem ihm eigenen Arbeitseifer
an die Durchforschung der Archive, der Kirchenbücher und
alles nur zugänglichen gedruckten Materials. Er führte
danach seinen Plan durch, schilderte also historisch die
Entwickelung der einzelnen Städte, Klöster und Dörfer und
besorgte ferner auch die Aufnahme und Beschreibung der
Grabsteine, Epitaphien, Kirchengefäße und zum Teil auch
der Glocken. Die übrigen Teile des Textes dagegen rühren
von den Herren Bauinspektor a. D. Gustav Sommer und Dr.
Brinkmann her, welche zu gleicher Zeit die Abbildungen
lieferten. Nach der verschiedenen Verfasserschaft hat die
Würdigung des Buches zu erfolgen: das, was Gustav Schmidt
bietet, ist durchgängig solide, zuverlässig, eingehend, er-
schöpfend; im übrigen gilt das, was ich neulich in diesen
Blättern über das von Gustav Sommer bearbeitete zehnte
Heft (Kreis Calbe) zu meinem Bedauern urteilen musste.
Der Tod, der Gustav Schmidt im Januar 1892 ereilte, hat
der Provinz Sachsen einen schweren Verlust bereitet; eine
hervorragende, mit reicher Sachkunde ausgestattete Arbeits-
kraft ist in ihm dahingegangen. Für seine Sorgfalt will
ich zwei Kleinigkeiten als Belege anführen. Während in
den übrigen Heften der Provinz Sachsen und in einer Reihe
anderer Inventare meist die Inschrift anno domini in der
alten Abkürzung mit anno dm fälschlich wiedergegeben
wird, druckt er durchgehends die einzig richtige Lesart dül.
Wichtiger ist der Umstand, dass er zuerst unter seinen
sächsischen Mitarbeitern auf die Goldschmiedezeichen ge-
achtet hat. Zwar thut er es nicht regelmäßig, und nur die
Halberstädter Wolfsangel scheint er gekannt zu haben (S. 3ü, |
56, 06 und 182). Aber ich hoffe, dass seine Nachfolger den
von ihm gegebenen Wink im Auge behalten und künftig
alle nur ermittelbaren Goldschmiede- und Zinngießerstempel
vermerken werden. Es ist gerade ein wesentlicher Zweck
der Inventarisirung, festzustellen, an welchen Orten und in
welchem Umfange man künstlerisch und kunstgewerblich
thätig gewesen ist. Nicht dringend genug kann den Inven-
tarisatoren das leider nicht fehlerfreie, aber vorläufig un-
entbehrliche Buch von M. Rosenberg, „Der Goldschmiede
Merkzeichen", empfohlen werden. Weiter rechne ich es
Gustav Schmidt zum Verdienste an, dass er, im Widerspruch
zu der Ansicht des Herrn Gustav Sommer, darauf gedrungen
hat, dass die Zahl der Abbildungen wesentlich vermehrt
würde. Leider hat ein Unstern bei der Beschaffung eines
zweiten Zeichners und bei der Anfertigung der Photogra-
phieen gewaltet. Neben besser gelungenen Abbildungen
finden sich manche, die nicht genügen, einzelne sogar, die
lieber ungedruckt geblieben wären und nur irreführend
wirken (z. B. S. 59). Noch ungünstiger muss ich mich, wie
schon oben kurz angedeutet, über die technische Beschrei-
bung und die stilistische Würdigung der einzelnen Bau-
denkmäler äußern. Nur die romanischen Bauten (Groningen,
Hamersleben, Huysburg) finden die gebührende Beachtung,
alles übrige aber scheint ihm quantite negligeable gewesen
zu sein. So hätte man gern Näheres über die Bauernhäuser
des 17. Jahrhunderts (S. 00) gehört; in einer Zeit, in welcher
gerade die alten charakteristischen Privathäuser, vornehm-
lich auf dem Lande, so sehr der Zerstörungswut aufstreben-
der Großmannssucht zum Opfer fallen, sollte man ganz be-
sonders danach trachten, die noch vorhandenen Reste genau
zu beschreiben und wenigstens im Bilde festzuhalten; in
anderen Provinzen erfüllt man auch mit Freuden diese alte
und selbstverständliche Forderung der Wissenschaft! Aber
selbst öffentliche Bauten, die nicht gerade romanisch sind,
finden vor Herrn Sommer wiederholt keine Gnade, oder
werden doch einer Schilderung nicht für wert erachtet (vgl.
S. 40, 189, 190, 193, 204, 222). Sehr merkwürdig ist der
Gegensatz zwischen der am Schluss des Bandes gegebenen
„Kunsthistorischen Übersicht" (S. 233) und dem eigentlichen
beschreibenden Texte (S. 170 ff.) betreffend die Neindorfer
Kirche. Dann lieber gar keine Inventarisation, als eine
solche, die so von vorgefassten Meinungen ausgeht und so
wenig von Sachkunde unterstützt wird! Es ist bedauerlich,
mit diesem Missklang die Besprechung schließen zu müssen.
Hätte dem verewigten Gustav Schmidt ein tüchtiger Archi-
tekt oder ein zeichnerisch geschulter Kunsthistoriker zur
Seite gestanden, eine wie mustergültige vortreffliche Arbeit
wäre dann gezeitigt worden! Immerhin bietet das Buch
soviel des Guten und so viel Neues, dass es vom provinzial-
geschichtlichen Standpunkt aus eine willkommene und wich-
tige Veröffentlichung genannt werden kann. Ein Register,
welches man schmerzlich vermisst, und welches Schmidt
nach seiner ganzen Denkweise sicherlich gern beigefügt
hätte, ist wohl nur aus Mangel an Geldmitteln fortgelassen
worden, und das legt es mir nahe, den maßgehenden Kreisen
Sachsens den unmaßgeblichen Vorschlag zu machen, nach
dem Vorbild der Rheinprovinz und Westfalens die jeweiligen
Kreisstände zur Hergabe einer Druckunterstützung zu be-
wegen zu suchen. Es würden dann mehr Abbildungen ge-
liefert und der Preis niedriger angesetzt werden können.
Gute Anschaulichkeit und weite Verbreitung sind zwei
Wünsche, die man vor anderen jedem sorgsam gearbeiteten
Inventar gern auf den Weg giebt.
HERMANN EHl! KKBKU> ■
Bückerschau.
318
gelitten, auch weichen die einzelnen Hefte in der syste-
matischen Behandlung zu sehr von einander ah, vom
rein historischen Standpunkt aber hat dieses Vorgehen
manches für sich. So darf bei den oben genannten bei-
den Heften das Verfahren im gewissen Sinne als gelungen
bezeichnet werden. Der Oberregierungsrat Freiherr von
Tettau und der Gymnasialdirektor Dr. Schmidt sind beide
als tüchtige Forscher bekannt und haben beide hier ihren
Ruf vollauf bewährt. — Die große Bedeutung, welche Erfurt
seit dem frühen Mittelalter besessen hat, spiegelt sich in
der Zahl und Schönheit seiner Bauten wieder und kommt
in Tettau's Schrift schön zur Geltung. Leider hat sich aber
der Verfasser bestimmen lassen, seine Darstellung mit dem
Untergang der Selbständigkeit der Stadt im 17. Jahrhundert
abzubrechen, so dass die Barock- und Rokokozeit vollkommen
vernachlässigt wird (vgl. z. B. S. 212 und 313); es lässt sich
dies keinesfalls rechtfertigen und unbedingt sollte darauf
gesehen werden, die hierher gehörigen Denkmäler nach-
träglich zu berücksichtigen. Von anderen Einwendungen
will ich hier absehen und nur die Unzulänglichkeit der
Abbildungen hervorheben, welche häufig zwecklos und un-
brauchbar sind (vgl. den verzeichneten Turm S. 109, ferner
S. 29, 89, 283 u. s. w.). Es ist lebhaft zu beklagen, dass
Tettau nicht von einem stilkundigen, sachverständigen
Architekten unterstützt wurde. Seine höchst gediegene,
wertvolle Arbeit hätte wohl ein besseres Schicksal verdient.
Besondere Anerkennung verdient die übersichtliche Anord-
nung und Gruppirung des Stoffs, der ein klar durchdachtes
System zu Grunde liegt und die vielleicht bei etwas anderer
typographischer Anordnung noch klarer zur Geltung gelangt
wäre. — Das 14. Heft behandelt den Kreis Oschersleben.
Als seine Bearbeitung dem Gymnasialdirektor Dr. Gustav
Schmidt übertragen wurde, machte dieser zur Bedingung,
dass es ihm gestattet würde, ausführlicher auf die Geschichte
der einzelnen Ortschaften einzugehen, als es sonst zu ge-
schehen pflege. Die Bedingung wurde genehmigt, und Gustav
Schmidt machte sich nun mit dem ihm eigenen Arbeitseifer
an die Durchforschung der Archive, der Kirchenbücher und
alles nur zugänglichen gedruckten Materials. Er führte
danach seinen Plan durch, schilderte also historisch die
Entwickelung der einzelnen Städte, Klöster und Dörfer und
besorgte ferner auch die Aufnahme und Beschreibung der
Grabsteine, Epitaphien, Kirchengefäße und zum Teil auch
der Glocken. Die übrigen Teile des Textes dagegen rühren
von den Herren Bauinspektor a. D. Gustav Sommer und Dr.
Brinkmann her, welche zu gleicher Zeit die Abbildungen
lieferten. Nach der verschiedenen Verfasserschaft hat die
Würdigung des Buches zu erfolgen: das, was Gustav Schmidt
bietet, ist durchgängig solide, zuverlässig, eingehend, er-
schöpfend; im übrigen gilt das, was ich neulich in diesen
Blättern über das von Gustav Sommer bearbeitete zehnte
Heft (Kreis Calbe) zu meinem Bedauern urteilen musste.
Der Tod, der Gustav Schmidt im Januar 1892 ereilte, hat
der Provinz Sachsen einen schweren Verlust bereitet; eine
hervorragende, mit reicher Sachkunde ausgestattete Arbeits-
kraft ist in ihm dahingegangen. Für seine Sorgfalt will
ich zwei Kleinigkeiten als Belege anführen. Während in
den übrigen Heften der Provinz Sachsen und in einer Reihe
anderer Inventare meist die Inschrift anno domini in der
alten Abkürzung mit anno dm fälschlich wiedergegeben
wird, druckt er durchgehends die einzig richtige Lesart dül.
Wichtiger ist der Umstand, dass er zuerst unter seinen
sächsischen Mitarbeitern auf die Goldschmiedezeichen ge-
achtet hat. Zwar thut er es nicht regelmäßig, und nur die
Halberstädter Wolfsangel scheint er gekannt zu haben (S. 3ü, |
56, 06 und 182). Aber ich hoffe, dass seine Nachfolger den
von ihm gegebenen Wink im Auge behalten und künftig
alle nur ermittelbaren Goldschmiede- und Zinngießerstempel
vermerken werden. Es ist gerade ein wesentlicher Zweck
der Inventarisirung, festzustellen, an welchen Orten und in
welchem Umfange man künstlerisch und kunstgewerblich
thätig gewesen ist. Nicht dringend genug kann den Inven-
tarisatoren das leider nicht fehlerfreie, aber vorläufig un-
entbehrliche Buch von M. Rosenberg, „Der Goldschmiede
Merkzeichen", empfohlen werden. Weiter rechne ich es
Gustav Schmidt zum Verdienste an, dass er, im Widerspruch
zu der Ansicht des Herrn Gustav Sommer, darauf gedrungen
hat, dass die Zahl der Abbildungen wesentlich vermehrt
würde. Leider hat ein Unstern bei der Beschaffung eines
zweiten Zeichners und bei der Anfertigung der Photogra-
phieen gewaltet. Neben besser gelungenen Abbildungen
finden sich manche, die nicht genügen, einzelne sogar, die
lieber ungedruckt geblieben wären und nur irreführend
wirken (z. B. S. 59). Noch ungünstiger muss ich mich, wie
schon oben kurz angedeutet, über die technische Beschrei-
bung und die stilistische Würdigung der einzelnen Bau-
denkmäler äußern. Nur die romanischen Bauten (Groningen,
Hamersleben, Huysburg) finden die gebührende Beachtung,
alles übrige aber scheint ihm quantite negligeable gewesen
zu sein. So hätte man gern Näheres über die Bauernhäuser
des 17. Jahrhunderts (S. 00) gehört; in einer Zeit, in welcher
gerade die alten charakteristischen Privathäuser, vornehm-
lich auf dem Lande, so sehr der Zerstörungswut aufstreben-
der Großmannssucht zum Opfer fallen, sollte man ganz be-
sonders danach trachten, die noch vorhandenen Reste genau
zu beschreiben und wenigstens im Bilde festzuhalten; in
anderen Provinzen erfüllt man auch mit Freuden diese alte
und selbstverständliche Forderung der Wissenschaft! Aber
selbst öffentliche Bauten, die nicht gerade romanisch sind,
finden vor Herrn Sommer wiederholt keine Gnade, oder
werden doch einer Schilderung nicht für wert erachtet (vgl.
S. 40, 189, 190, 193, 204, 222). Sehr merkwürdig ist der
Gegensatz zwischen der am Schluss des Bandes gegebenen
„Kunsthistorischen Übersicht" (S. 233) und dem eigentlichen
beschreibenden Texte (S. 170 ff.) betreffend die Neindorfer
Kirche. Dann lieber gar keine Inventarisation, als eine
solche, die so von vorgefassten Meinungen ausgeht und so
wenig von Sachkunde unterstützt wird! Es ist bedauerlich,
mit diesem Missklang die Besprechung schließen zu müssen.
Hätte dem verewigten Gustav Schmidt ein tüchtiger Archi-
tekt oder ein zeichnerisch geschulter Kunsthistoriker zur
Seite gestanden, eine wie mustergültige vortreffliche Arbeit
wäre dann gezeitigt worden! Immerhin bietet das Buch
soviel des Guten und so viel Neues, dass es vom provinzial-
geschichtlichen Standpunkt aus eine willkommene und wich-
tige Veröffentlichung genannt werden kann. Ein Register,
welches man schmerzlich vermisst, und welches Schmidt
nach seiner ganzen Denkweise sicherlich gern beigefügt
hätte, ist wohl nur aus Mangel an Geldmitteln fortgelassen
worden, und das legt es mir nahe, den maßgehenden Kreisen
Sachsens den unmaßgeblichen Vorschlag zu machen, nach
dem Vorbild der Rheinprovinz und Westfalens die jeweiligen
Kreisstände zur Hergabe einer Druckunterstützung zu be-
wegen zu suchen. Es würden dann mehr Abbildungen ge-
liefert und der Preis niedriger angesetzt werden können.
Gute Anschaulichkeit und weite Verbreitung sind zwei
Wünsche, die man vor anderen jedem sorgsam gearbeiteten
Inventar gern auf den Weg giebt.
HERMANN EHl! KKBKU> ■