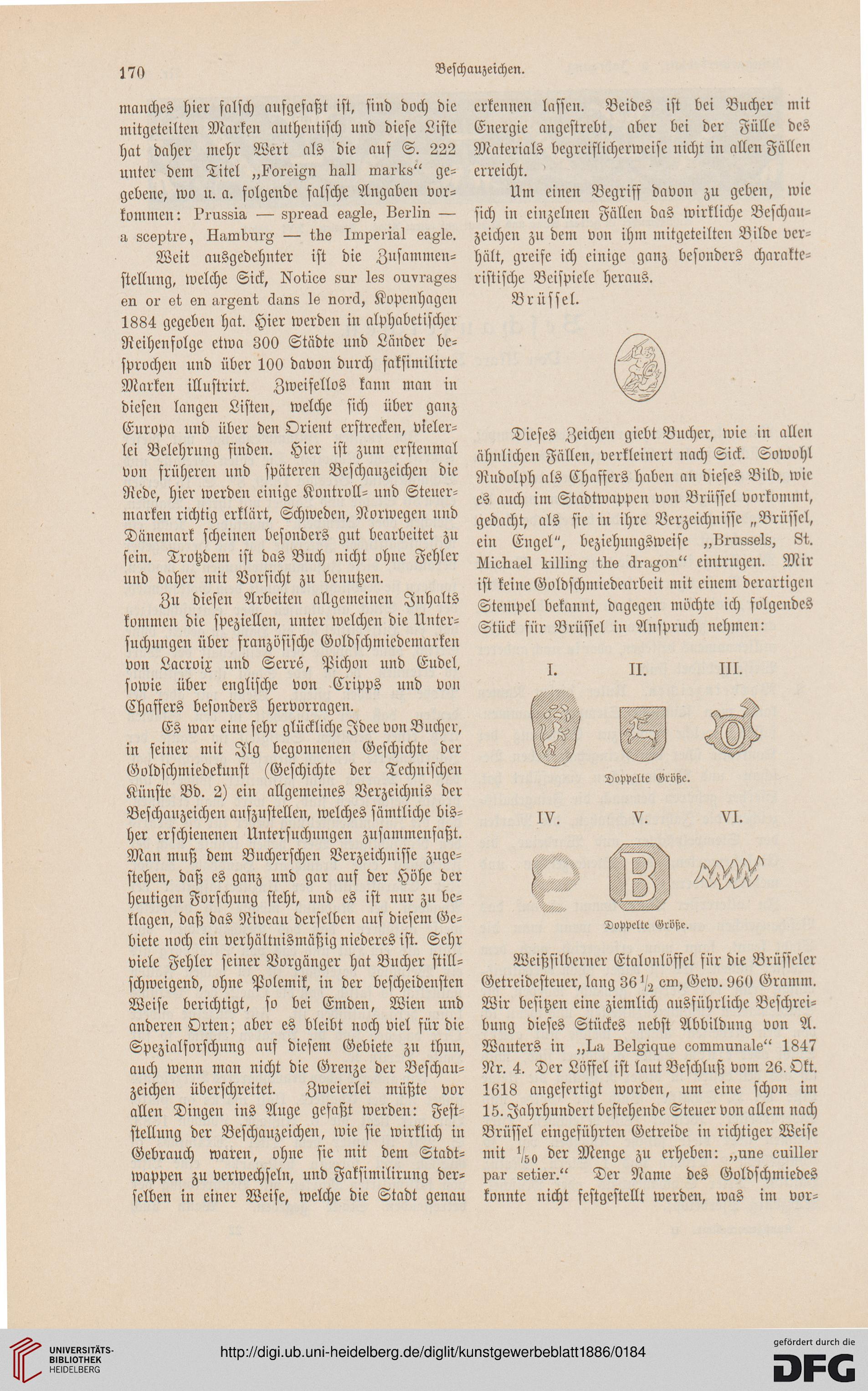170
Beschauzeichen.
manches hier falsch aufgesaßt ist, sind doch die
mitgeteilten Marken anthentisch und diese Liste
hat daher mehr Wert als die anf S. 222
unter dem Titel „k'oreign Iiall marlrk" ge-
gebene, wo u. a. folgende falsche Angaben vor-
kommen: Lrussin — sxraaä eaglo, llarlin —
u sosptrs, Lalnbnr» — tbo Iinpeiial kagls.
Weit ausgedehnter ist die Zusammen-
stellung, welche Sick, Hokios snr lss onvrnAss
Sll or sk sn arASllt äans ls llorä, Kopenhagen
1884 gegeben hat. Hier werden in alphabetischer
Reihenfolge etwa 300 Städte und Länder be-
sprochen nnd nber 100 davon durch faksimilirte
Marken illustrirt. Zweifellos kann man in
diesen langen Listen, welche sich über ganz
Europa und über den Orient erstrecken, vieler-
lei Belehrung finden. Hier ist zum erstenmal
Vvn früheren und späteren Beschauzeichen die
Rede, hier werden einige Kontroll- und Steuer-
marken richtig erklärt, Schweden, Norwegen nnd
Dänemark scheinen besonders gut bcarbeitet zn
sein. Trotzdem ist das Buch nicht ohne Fehler
und daher mit Vorsicht zu benutzen.
Zu diesen Arbeiten allgemeinen Jnhalts
kommen dic speziellen, unter welchen die Nnter-
suchungen über französische Goldschmiedemarken
von Lacroix und Serrs, Pichon und Eudel,
sowie über englische von Cripps und von
Chasfers besonders hervorragen.
Es war eine sehr glückliche Jdee von Buchcr,
in seiner mit Flg begonnenen Geschichte der
Goldschmiedckunst (Geschichte der Tcchnischen
Künste Bd. 2) cin allgemeines Verzcichnis der
Beschauzeichen aufzustellen, welches sämtliche bis-
her erschienenen Untersuchungen zusammenfaßt.
Man muß dem Bucherschen Verzeichnisse zuge-
stehen, daß es ganz und gar auf der Höhe der
heutigen Forschung steht, und es ist nur zu be-
klagen, daß das Niveau derselben auf diesem Ge-
biete noch ein verhältnismäßig niederes ist. Sehr
viele Fehler seiner Vorgänger hat Bucher still-
schweigend, ohne Polemik, in der bescheidensten
Weise berichtigt, so bei Emden, Wien und
anderen Orten; aber es bleibt noch viel für die
Spezialforschung auf diesem Gebiete zu thun,
auch wenn man nicht die Grenze der Beschau-
zeichen überschreitet. Zweierlei müßte vor
allen Dingen ins Auge gefaßt werden: Fest-
stellung der Beschauzeichen, wie sie wirklich in
Gebrauch waren, ohne sie mit dem Stadt-
wappen zu verwechseln, und Faksimilirung der-
selben in einer Weise, welche die Stadt genau
erkenuen lassen. Beides ist bei Bucher mit
Energie angestrebt, aber bei der Fülle dcs
Materials begreiflicherweise nicht in allen Fällcn
erreicht.
Um einen Begriff davon zu geben, wie
sich in einzelnen Fällen das wirkliche Beschan-
zeichen zu dem von ihm mitgeteilten Bilde vcr-
hält, greife ich einige ganz besonders charakte-
ristische Beispiele heraus.
Brüssel.
Dieses Zeichen giebt Bucher, wie in allen
ähnlichen Fällen, verkleinert nach Sick. Sowohl
Nudolph als Chasfers habcn an dieses Bild, wic
es auch im Stadtwappen von Brüssel vorkommt,
gedacht, als sie in ihre Verzeichnisse „Brüssel,
ein Engel", beziehungsweise „vrnsssls, 8t.
Nioliaöl üillinA tlis äraAon" eintrugen. Mir
ist keine Goldschmiedearbeit mit einem derartigen
Stempel bekannt, dagegen möchte ich folgendes
Stück fnr Briissel in Anspruch nehmen:
I. II. III.
Doppclte Grvße.
IV. V. VI.
Doppcltc Größe.
Weißsilberner Etalonlöffel sür die Brüsseler
Getreidesteuer, lang 36^ eiri, Gew. 960 Gramm.
Wir besitzen eine ziemlich aussührliche Beschrei-
bung dieses Stückes nebst Abbildung von A.
Wauters in „I-a LelAigns oommnnals" 1847
Nr. 4. Der Löffel ist laut Beschluß vom 26. Okt.
1618 angefertigt worden, um eine schon im
15. Jahrhundert bestehende Steuer von allem nach
Brüssel eingeführten Getreide in richtiger Weise
mit l/gg der Menge zu erheben: „nns onillsr
par sstisr." Der Name des Goldschmiedes
konnte nicht festgestellt werden, was im vor-
Beschauzeichen.
manches hier falsch aufgesaßt ist, sind doch die
mitgeteilten Marken anthentisch und diese Liste
hat daher mehr Wert als die anf S. 222
unter dem Titel „k'oreign Iiall marlrk" ge-
gebene, wo u. a. folgende falsche Angaben vor-
kommen: Lrussin — sxraaä eaglo, llarlin —
u sosptrs, Lalnbnr» — tbo Iinpeiial kagls.
Weit ausgedehnter ist die Zusammen-
stellung, welche Sick, Hokios snr lss onvrnAss
Sll or sk sn arASllt äans ls llorä, Kopenhagen
1884 gegeben hat. Hier werden in alphabetischer
Reihenfolge etwa 300 Städte und Länder be-
sprochen nnd nber 100 davon durch faksimilirte
Marken illustrirt. Zweifellos kann man in
diesen langen Listen, welche sich über ganz
Europa und über den Orient erstrecken, vieler-
lei Belehrung finden. Hier ist zum erstenmal
Vvn früheren und späteren Beschauzeichen die
Rede, hier werden einige Kontroll- und Steuer-
marken richtig erklärt, Schweden, Norwegen nnd
Dänemark scheinen besonders gut bcarbeitet zn
sein. Trotzdem ist das Buch nicht ohne Fehler
und daher mit Vorsicht zu benutzen.
Zu diesen Arbeiten allgemeinen Jnhalts
kommen dic speziellen, unter welchen die Nnter-
suchungen über französische Goldschmiedemarken
von Lacroix und Serrs, Pichon und Eudel,
sowie über englische von Cripps und von
Chasfers besonders hervorragen.
Es war eine sehr glückliche Jdee von Buchcr,
in seiner mit Flg begonnenen Geschichte der
Goldschmiedckunst (Geschichte der Tcchnischen
Künste Bd. 2) cin allgemeines Verzcichnis der
Beschauzeichen aufzustellen, welches sämtliche bis-
her erschienenen Untersuchungen zusammenfaßt.
Man muß dem Bucherschen Verzeichnisse zuge-
stehen, daß es ganz und gar auf der Höhe der
heutigen Forschung steht, und es ist nur zu be-
klagen, daß das Niveau derselben auf diesem Ge-
biete noch ein verhältnismäßig niederes ist. Sehr
viele Fehler seiner Vorgänger hat Bucher still-
schweigend, ohne Polemik, in der bescheidensten
Weise berichtigt, so bei Emden, Wien und
anderen Orten; aber es bleibt noch viel für die
Spezialforschung auf diesem Gebiete zu thun,
auch wenn man nicht die Grenze der Beschau-
zeichen überschreitet. Zweierlei müßte vor
allen Dingen ins Auge gefaßt werden: Fest-
stellung der Beschauzeichen, wie sie wirklich in
Gebrauch waren, ohne sie mit dem Stadt-
wappen zu verwechseln, und Faksimilirung der-
selben in einer Weise, welche die Stadt genau
erkenuen lassen. Beides ist bei Bucher mit
Energie angestrebt, aber bei der Fülle dcs
Materials begreiflicherweise nicht in allen Fällcn
erreicht.
Um einen Begriff davon zu geben, wie
sich in einzelnen Fällen das wirkliche Beschan-
zeichen zu dem von ihm mitgeteilten Bilde vcr-
hält, greife ich einige ganz besonders charakte-
ristische Beispiele heraus.
Brüssel.
Dieses Zeichen giebt Bucher, wie in allen
ähnlichen Fällen, verkleinert nach Sick. Sowohl
Nudolph als Chasfers habcn an dieses Bild, wic
es auch im Stadtwappen von Brüssel vorkommt,
gedacht, als sie in ihre Verzeichnisse „Brüssel,
ein Engel", beziehungsweise „vrnsssls, 8t.
Nioliaöl üillinA tlis äraAon" eintrugen. Mir
ist keine Goldschmiedearbeit mit einem derartigen
Stempel bekannt, dagegen möchte ich folgendes
Stück fnr Briissel in Anspruch nehmen:
I. II. III.
Doppclte Grvße.
IV. V. VI.
Doppcltc Größe.
Weißsilberner Etalonlöffel sür die Brüsseler
Getreidesteuer, lang 36^ eiri, Gew. 960 Gramm.
Wir besitzen eine ziemlich aussührliche Beschrei-
bung dieses Stückes nebst Abbildung von A.
Wauters in „I-a LelAigns oommnnals" 1847
Nr. 4. Der Löffel ist laut Beschluß vom 26. Okt.
1618 angefertigt worden, um eine schon im
15. Jahrhundert bestehende Steuer von allem nach
Brüssel eingeführten Getreide in richtiger Weise
mit l/gg der Menge zu erheben: „nns onillsr
par sstisr." Der Name des Goldschmiedes
konnte nicht festgestellt werden, was im vor-