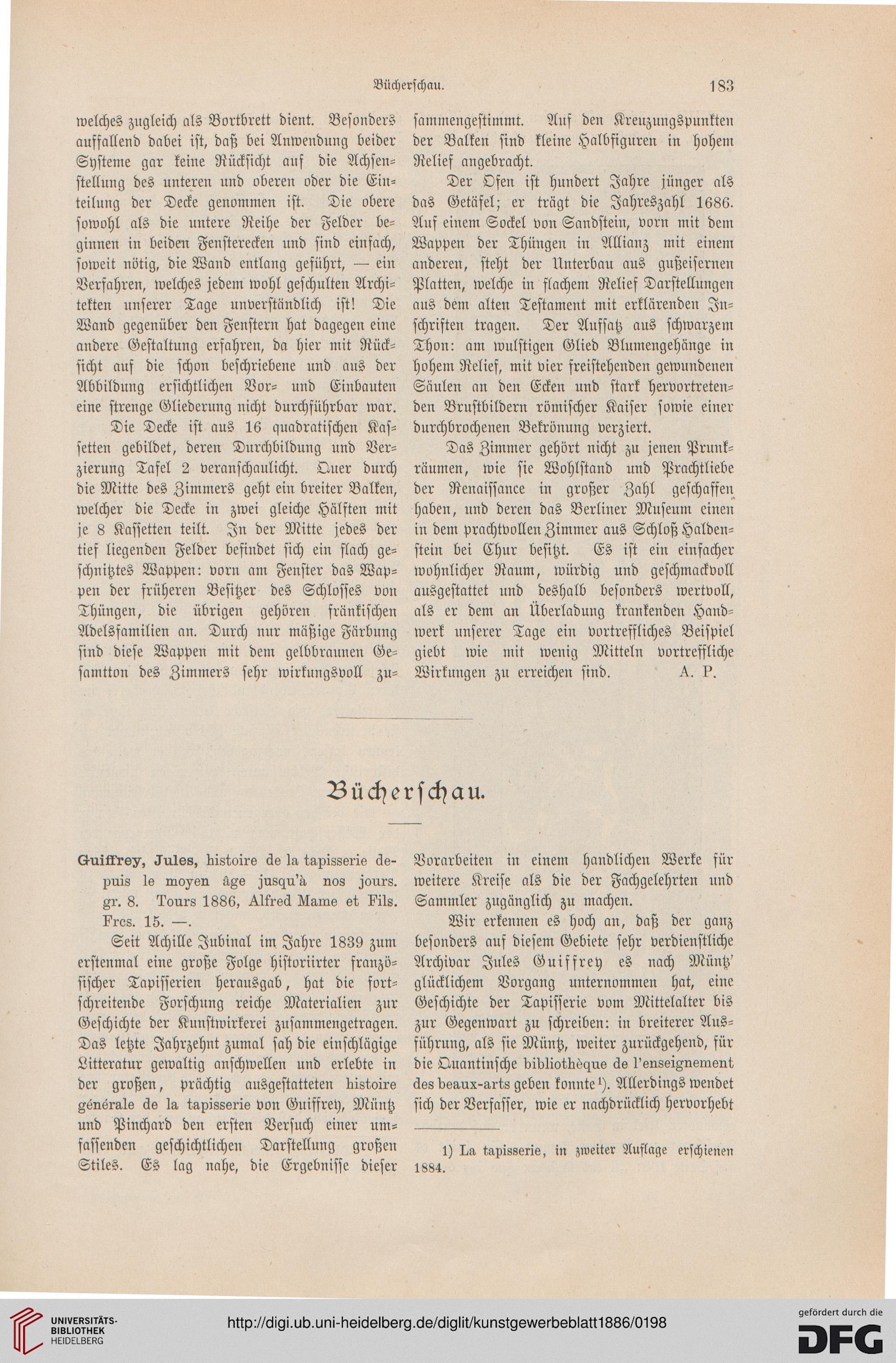BUcherschau.
183
welches zugleich als Bortbrett dient. Besonders
auffallend dabei ist, daß bei Anwendnug beider
Systeme gar keine Rücksicht aus die Achsen-
stellnng des unteren und oberen oder die Ein-
teilung der Decke genommen ist. Die obere
sowohl als die untere Reihe der Felder be-
ginnen in beiden Fensterecken und sind einfach,
soweit nötig, die Wand entlang geführt, — ein
Verfahren, welches jedem wohl geschulten Archi-
tekten unserer Tage unverständlich ist! Die
Wand gegenüber den Fenstern hat dagegen eine
andere Gestaltung erfahren, da hier mit Rück-
sicht auf die schon beschriebene und aus der
Abbildung ersichtlichen Vor- und Einbauten
eine strenge Gliederung nicht durchführbar war.
Die Decke ist aus 16 quadratischen Kas-
setten gebildet, deren Durchbildung und Ver-
zierung Tafel 2 veranschaulicht. Quer durch
die Mitte des Zimmers geht eiu breiter Balken,
welcher die Decke in zwei gleiche Hälften mit
je 8 Kassetten teilt. Jn der Mitte jedes der
tief liegenden Felder befindet sich ein stach ge-
schnitztes Wappen: vorn am Fenster das Wap-
pen der früheren Besitzer des Schlosses von
Thüngen, die übrigen gehören fränkischen
Adelsfamilien an. Durch nur mäßige Fttrbung
sind diese Wappen mit dem gelbbraunen Ge-
samtton des Zimmers sehr wirkungsvoll zu-
sammengestimmt. Anf den Krenzungspnnkten
der Balken sind kleine Halbfiguren in hohem
Relief angebracht.
Der Ofen ist hundert Jahre jünger als
das Getäfel; er trttgt die Jahreszahl 1686.
Auf einem Sockel von Sandstein, vorn mit dem
Wappen der Thüngen in Allianz mit einem
anderen, steht der Ilnterbau aus gußeisernen
Platten, welche in flachem Relief Darstellungen
aus dem alten Testament mit erklärenden Jn-
schriften tragen. Der Aufsatz aus schwarzem
Thon: am wulstigen Glied Blumengehänge in
hohem Relief, mit vier freistehenden gewundenen
Säulen an den Ecken und stark hervortreten-
den Brustbildern römischer Kaiser sowie eiuer
durchbrochenen Bekrönung verziert.
Das Zimmer gehört nicht zu jenen Prunk-
rttumen, wie sie Wohlstand und Prachtliebe
der Renaissance in großer Zahl geschaffen
haben, und deren das Berliner Museum einen
in dem prachtvollen Zimmer aus Schloß Halden-
stein bei Chur besitzt. Es ist ein einfacher
wohnlicher Raum, würdig und geschmackvoll
ausgestattet und deshalb besonders wertvoll,
als er dem an Überladung krankenden Hand-
werk unserer Tage ein vortrefsliches Beispiel
giebt wie mit wenig Mitteln vortreffliche
Wirkungen zu erreichen sind. L.. !?.
Bücherschau.
vuitki'szr, llwlss, llistoirs äs lu ts-pisssris äs-
xuis ls rno^sn ju8gn.'ü nos jours.
gr. 8. lours 1886, ^.ltrsä Nsins st §ils.
l?rss. 15. —.
Seit Achille Jubinal im Jahre 1839 zum
erstenmal eine große Folge historiirter franzö-
sischer Tapisserien herausgab, hat die fort-
schreitende Forschung reiche Materialien zur
Geschichte der Kunstwirkerei zusammengetragen.
Das letzte Jahrzehnt zumal sah die einschlägige
Litteratur gewaltig anschwellen und erlebte in
der großen, prächtig ausgestatteten llistoirs
gönsrals äs la tapisssris von Guiffrey, Müntz
und Pinchard den ersten Versuch einer um-
fassenden geschichtlichen Darstellung grvßen
Stiles. Es lag nahe, die Ergebnisse dieser
Vorarbeiten in einem handlichen Werke sür
weitere Kreise als die der Fachgelehrten und
Sammler zngänglich zu machen.
Wir erkennen es hoch an, daß der ganz
besonders auf diesem Gebiete sehr verdienstliche
Archivar Fules Guiffrey es nach Müntz'
glücklichem Vorgang unternommen hat, eine
Geschichte der Tapisserie vom Mittelalter bis
zur Gegenwart zu schreiben: in breiterer Aus-
führung, als sie Müntz, weiter zurückgehend, für
die Quantinsche läbliotlivgus äs 1'snssiAnsmsnt
äss lissux-arts geben konnte^). Allerdings wendet
sich der Verfasser, wie er nachdrücklich hervorhebt
1) lla taxisserie, in zweiter Auflage erschienen
1884.
183
welches zugleich als Bortbrett dient. Besonders
auffallend dabei ist, daß bei Anwendnug beider
Systeme gar keine Rücksicht aus die Achsen-
stellnng des unteren und oberen oder die Ein-
teilung der Decke genommen ist. Die obere
sowohl als die untere Reihe der Felder be-
ginnen in beiden Fensterecken und sind einfach,
soweit nötig, die Wand entlang geführt, — ein
Verfahren, welches jedem wohl geschulten Archi-
tekten unserer Tage unverständlich ist! Die
Wand gegenüber den Fenstern hat dagegen eine
andere Gestaltung erfahren, da hier mit Rück-
sicht auf die schon beschriebene und aus der
Abbildung ersichtlichen Vor- und Einbauten
eine strenge Gliederung nicht durchführbar war.
Die Decke ist aus 16 quadratischen Kas-
setten gebildet, deren Durchbildung und Ver-
zierung Tafel 2 veranschaulicht. Quer durch
die Mitte des Zimmers geht eiu breiter Balken,
welcher die Decke in zwei gleiche Hälften mit
je 8 Kassetten teilt. Jn der Mitte jedes der
tief liegenden Felder befindet sich ein stach ge-
schnitztes Wappen: vorn am Fenster das Wap-
pen der früheren Besitzer des Schlosses von
Thüngen, die übrigen gehören fränkischen
Adelsfamilien an. Durch nur mäßige Fttrbung
sind diese Wappen mit dem gelbbraunen Ge-
samtton des Zimmers sehr wirkungsvoll zu-
sammengestimmt. Anf den Krenzungspnnkten
der Balken sind kleine Halbfiguren in hohem
Relief angebracht.
Der Ofen ist hundert Jahre jünger als
das Getäfel; er trttgt die Jahreszahl 1686.
Auf einem Sockel von Sandstein, vorn mit dem
Wappen der Thüngen in Allianz mit einem
anderen, steht der Ilnterbau aus gußeisernen
Platten, welche in flachem Relief Darstellungen
aus dem alten Testament mit erklärenden Jn-
schriften tragen. Der Aufsatz aus schwarzem
Thon: am wulstigen Glied Blumengehänge in
hohem Relief, mit vier freistehenden gewundenen
Säulen an den Ecken und stark hervortreten-
den Brustbildern römischer Kaiser sowie eiuer
durchbrochenen Bekrönung verziert.
Das Zimmer gehört nicht zu jenen Prunk-
rttumen, wie sie Wohlstand und Prachtliebe
der Renaissance in großer Zahl geschaffen
haben, und deren das Berliner Museum einen
in dem prachtvollen Zimmer aus Schloß Halden-
stein bei Chur besitzt. Es ist ein einfacher
wohnlicher Raum, würdig und geschmackvoll
ausgestattet und deshalb besonders wertvoll,
als er dem an Überladung krankenden Hand-
werk unserer Tage ein vortrefsliches Beispiel
giebt wie mit wenig Mitteln vortreffliche
Wirkungen zu erreichen sind. L.. !?.
Bücherschau.
vuitki'szr, llwlss, llistoirs äs lu ts-pisssris äs-
xuis ls rno^sn ju8gn.'ü nos jours.
gr. 8. lours 1886, ^.ltrsä Nsins st §ils.
l?rss. 15. —.
Seit Achille Jubinal im Jahre 1839 zum
erstenmal eine große Folge historiirter franzö-
sischer Tapisserien herausgab, hat die fort-
schreitende Forschung reiche Materialien zur
Geschichte der Kunstwirkerei zusammengetragen.
Das letzte Jahrzehnt zumal sah die einschlägige
Litteratur gewaltig anschwellen und erlebte in
der großen, prächtig ausgestatteten llistoirs
gönsrals äs la tapisssris von Guiffrey, Müntz
und Pinchard den ersten Versuch einer um-
fassenden geschichtlichen Darstellung grvßen
Stiles. Es lag nahe, die Ergebnisse dieser
Vorarbeiten in einem handlichen Werke sür
weitere Kreise als die der Fachgelehrten und
Sammler zngänglich zu machen.
Wir erkennen es hoch an, daß der ganz
besonders auf diesem Gebiete sehr verdienstliche
Archivar Fules Guiffrey es nach Müntz'
glücklichem Vorgang unternommen hat, eine
Geschichte der Tapisserie vom Mittelalter bis
zur Gegenwart zu schreiben: in breiterer Aus-
führung, als sie Müntz, weiter zurückgehend, für
die Quantinsche läbliotlivgus äs 1'snssiAnsmsnt
äss lissux-arts geben konnte^). Allerdings wendet
sich der Verfasser, wie er nachdrücklich hervorhebt
1) lla taxisserie, in zweiter Auflage erschienen
1884.